DA Otto Publish Word
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Speciale: Trends
Ora anche WEBZINE www.telecomitalia.com/notiziariotecnico SPECIALE: TRENDS Caro Lettore, da quest’anno il Notiziario Tecnico di Telecom Italia è diventato un nuovo webzine social (www.telecomitalia.com/notiziariotecnico), in cui è possibile discutere in realtime con gli autori i vari temi trattati negli articoli, leggere la rivista ricca di hyperlink multimediali, accedere ai canali social più diffusi; tutto questo continuando ad essere una rivista aumentata, cioè arricchita da contenuti speciali interattivi. Con l’APP in Realtà Aumentata “L’Editoria+” di Telecom Italia, è infatti possibile, sul proprio device mobile, visionare videointerviste ad esperti del settore ICT, ricevere approfondimenti multimediali, consultare photo gallery aggiuntive sui vari articoli della rivista. Per accedere a tutti i contenuti aumentati del Notiziario Tecnico è sufficiente: 1) scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l’APP “L’Editoria+” di Telecom Italia, disponibile su Apple Store, Google Play (Android) e TIM Store 2) cercare nella rivista l’icona sottostante presente sia sulla copertina del Notiziario Tecnico, che in molte pagine interne; 3) attivare l’APP “L’Editoria+” e, tenendo il telefonino a circa 20-30 cm di distanza, inquadrare con la fotocamera l’immagine di proprio interesse. Con questi pochi passi puoi così visualizzare varie icone 3D, che, cliccate singolarmente, ti faranno accedere a un mondo tutto da esplorare. 1 EDITORIALE SPECIALE TRENDS l termine “Comunicazione” non è più sufficiente a descrivere il nostro settore. Non è comunicazione la molteplicità di usi, applicazioni e servizi resi possibili dall‘enorme flusso di dati che miliardi di dispositivi ogni secondo generano ed utilizzano, che unità di elaborazione e memoria custodiscono e Itrasformano, che connessioni di tutti i tipi raccolgono e distribuiscono. -

International Organization For
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION ISO/IEC/JTC 1/SC 29/WG 11 CODING OF MOVING PICTURES AND AUDIO ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 N12456 February 2012 – San Jose, CA, USA Source: Convenor of MPEG Status: Approved by WG11 Subject: MPEG Press Release Date: 10 February 2012 High Efficiency Video Coding Achieves first formal milestone toward completion The 99th MPEG meeting was held in San Jose, California, USA, from the 6th to the 10th of February 2012. HEVC reAches formAl ISO/IEC committee drAft stAtus ISO/IEC’s Moving Picture Experts Group (MPEG) is pleased to announce the completion of the ISO/IEC committee draft of the High Efficiency Video Coding (HEVC) standard developed by the Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC), a joint team between MPEG and the ITU-T’s Video Coding Experts Group (VCEG). The committee draft was approved for balloting at the 99th MPEG meeting and is the first formal ISO/IEC milestone in the HEVC project. HEVC is expected to be submitted for final standardization approval in January 2013, and will be delivered as Part 2 of a new suite of standards known as MPEG-H (ISO/IEC 23008). The design of HEVC, the next generation of video compression standards, incorporates the latest state-of- the-art technologies and algorithmic advances to address the persistent demand for broader usage of video content, video migration to broadband networks, diversification of mobile devices, ever-higher resolutions for cameras and displays, and increasingly high video quality. -

Dmp와 Mpeg-21 기반의 상호운용 가능한 Drm 시스템에 관한 연구
석사학위 논문 DMP와 MPEG-21 기반의 상호운용 가능한 DRM 시스템에 관한 연구 A Study on Interoperable DRM System based on DMP and MPEG-21 2006년 12월 배재대학교 대학원 컴퓨터공학과 컴퓨터공학전공 류 광 희 i DMP와 MPEG-21 기반의 상호운용 가능한 DRM 시스템에 관한 연구 지도교수 정 회 경 배재대학교 대학원 컴퓨터공학과 컴퓨터공학전공 류 광 희 2006년 12월 ii 류광희의 석사학위논문을 제출함 류광희의 석사학위논문을 인준함 심사위원장 김 진 수 (인) 심사위원 조 인 준 (인) 심사위원 정 회 경 (인) 2006년 12월 배재대학교 대학원 iii DMP와 MPEG-21 기반의 상호운용 가능한 DRM 시스템에 관한 연구 류 광 희 지도교수 정 회 경 배재대학교 대학원 컴퓨터공학과 아날로그 콘텐츠의 디지털화는 개인 단말 기기들의 성능 향상으로 점차 가속화되는 현상을 보이고 있으며, 개인 사용자에 의한 콘텐츠 변형이 쉽게 이루어지고 있다. 이렇게 변형되거나 복제된 콘텐츠들은 초고속 인터넷 보급의 확산으로 단순한 유통 구조를 지니며 콘텐츠 시장에 미치는 부정적인 파급 효과를 증가시키는 원인으로 제시되고 있다. 그러므로 다양한 표준화 단체들과 콘텐츠 제공업체들은 불법적으로 유통되는 콘텐츠 및 저작자들의 저작권을 보호하기 위한 솔루션을 개발하고 있으며, 부분적인 상용화를 이루고 있는 상황이다. 그동안 MPEG(Moving Picture Experts Group)-1, MPEG-2, MPEG-4 등의 멀티미디어 데이터에 대한 성공적인 표준을 만든 MPEG 또한 디지털 콘텐츠를 보호하는 방법으로 기존 MPEG 표준들에 적용되는 IPMP 기술들을 개발하였다. 그러나 이러한 IPMP(Intellectual Property Management and Protection) 기술들이 디지털 콘텐츠 보호에 대하여 만족할 정도의 기능을 제시하지 못하면서 이에 대한 대안으로 DMP(Digital Media Project) 표준이 제안되었다. iv DMP 표준은 IPMP와 비교할 때 툴에 대한 은닉성을 가장 큰 차이로 설명할 수 있다. 기존 IPMP 표준들은 서로 다른 DRM(Digital Rights Management) 기술들의 상호운용성(Interoperability)을 지원하기 위하여 인증(Authentication), 워터마킹(Watermarking), 암호화(Encryption) 등의 기능들을 모듈화하여 툴 정보와 API로 외부에 공개하였다. -

1-1 WSC2013 Chiariglione Cedeonet.Pdf
WkiiWorking in s tan ddidards is like working in real life Leonardo Chiariglione Speech at WSC Academic Day, Sophia Antipolis – 2013/06/14 DfiiiDefinitions o f“f “stan dar d” y Webster’s y A conspicuous object (as a banner) formerly carried at the top of a pole and used to mark a rallying point especially in battle or to serve as an emblem y Somethinggyy that is established by authority, custom or general consent as a model or example to be followed y Encyclopaedia Britannica y (A reference that is) established to permit large production runs of component parts that are readily fitted to other parts without adjustment Working in standards is like working in real life 2013/06/14 2 MdfiiiMy definition o f“f “stan dd”dard” y Codified agreement between parties who recognise the advantage of all doing certain things in the same way y NB: The actual “process” (de jure or de facto) is irrelevant, provided it is y Fair to all parties concerned and y Carried out to match the needs of users Working in standards is like working in real life 2013/06/14 3 Why the World Needs Communication Standards y Language requires an agreed correspondence between Utterances and words y WitiWriting requ ires an agree d correspon dence be tween Graphic signs and words y Telegraphy requires an agreed correspondence between Combinations of dots/dashes and characters y Television requires an agreed correspondence between Certain waveforms and visible and audible information y Communication can take place only if an agreement exists about the meaning of the "symbols" used in specific communication system TfSddTypes of Standards y Optional: e . -

Copertina / Cover
copertina / cover Public Smog (2004-ongoing), by Amy Balkin et al. Public Smog is a "clean-air" park in the atmosphere that fluctuates in location and scale. The park is constructed through financial, legal, or political activities that open it for public use. Activities to open Public Smog have included the purchase and retiring emissions offsets (NOX and CO2) in regulated emissions schemes in the US and European Union, making them inaccessible to polluting industries. This activity resulted in the opening of parks above Southern California (June 2004), the European Union (2006-7), and the United States (2010). When Public Smog is built through this process, it exists in the unfixed public airspace above the region where offsets are purchased and withheld from use. The park’s size varies, reflecting the amount of emissions allowances purchased and the length of the contract. Other activities to create Public Smog impact the size, location, and duration of the park. The work is currently focused on building a larger, permanent atmospheric preserve through an effort to inscribe Earth's Atmosphere on the UNESCO World Heritage List, begun in 2006, but developed more fully in collaboration with Documenta (13) since 2010. This undertaking has involved an invitation first presented to Germany, then to all UNESCO States Parties, to act as lead State Party in initiating an extraordinary nomination process for inscription of Earth's atmosphere. With the exception of the Kingdom of Tonga, no reply of interest was received, so a petition was launched from within the exhibition, requesting the audience to further petition their respective governments via signed postcard. -

How MP3 Changed the Music Industry
Page !1 of !11 " " " " " " " " " " " " " " " " " How MP3 Changed The Music Industry! DMT412 Case Study" Maximilian Crosby" Performance Sound BA Hons" Friday 13th June 2014" " " " " " " " " " " " " " " " © Page !2 of !11 " " MP3 is a type of digital format. It’s without doubt the most popular and most used digital format on the planet. In this essay I will be talking about why that is and how it’s popularity has changed the way we listen to music. I’ll be talking about how it works, it’s history, why people choose MP3 over other digital formats, how it compares to other digital formats, why MP3 was invented in the first place, the effect MP3 has had on the music industry and how we listen to music. I’ll also be talking about why we need digital formats to begin with. " " What is MP3? MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer 3, more commonly referred to as MP3 is a lossy encoding format for digital audio. MP3 was designed purely for audio and was designed by the Moving Picture Experts Group (MPEG) http://tools.ietf.org/html/rfc3003. In short it’s a lossy digital format. All digital formats fall under either one of two categories. Lossy or lossless. What I’m talking about here is the type of compression the digital format is using. Lossy data compression is a type of data encoding methods that uses inexact approximations for representing the content that has been encoded. Audio formats that fall under this category are MP3, AAC (Advanced Audio Coding), WMA (Windows Media Audio) and Voribs. -
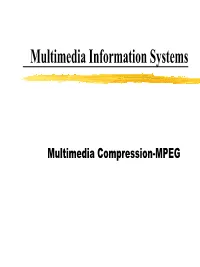
Multimedia Information Systems
Multimedia Information Systems Multimedia Compression-MPEG Multimedia Compression ❚ Fundamentals of Data Compression ❚ Image Compression & JPEG ❚ Video Compression & MPEG-Video ❚ References ❙ V. O. K. Li & W. J. Liao, Distributed Multimedia Systems, Proceedings of IEEE, Vol. 85, No. 7, 1997. (1083-1089) ❙ D. L. Gall, MPEG: A Video Compression Standard for Multimedia Applications, CACM, Vol. 34, No. 4, 1991. ❙ http://www.cis.ohio- state.edu/hypertext/faq/usenet/compression-faq ❙ http://bmrc.berkeley.edu/frame/research/mpeg/mpegfaq.thml Standards ❚ Important for communications ❚ Customers prefer standards (freedom to choose) ❚ Increases volumes and bring down cost of service and SW/HW ❚ Reduce risk of deploying new technology ❚ Major players often participate ❚ Facilitate development on a common background ❚ Provide research opportunity Types of Standards ❚ Industrial/Commercial standards ❙ mutual agreement among companies ❙ may become de facto standards ❚ Voluntary standards ❙ By volunteers in open committee ❙ Based on consensus ❙ Market driven ❙ Stay ahead of technology Global Standards ❚ International ❙ ITU: International Telecommunications Union (UN) ◆ ITU-T: ITU Telecommunication Standardization Sector (CCITT) ◆ ITU-R: ITU Radio Communication Sector (CCIR) ❙ ISO: International Standards Organization ❙ IEC: International Electrotechnical Commission ❙ JTC1: Joint Technical Committee on Information Technology ❚ National ❙ ANSI: American National Standards Institute Organizations of an ISO Standard Body ❚ Group: WG1 (JPEG), WG11(MPEG) ❚ -

NOTIZIARIO TECNICO TELECOM ITALIA - Anno 8 N
TELECOM ITALIA È PRONTA NOTIZIARIO AL MILLENNIUM BUG ADSL: OPPORTUNITÀ TECNICO DI BUSINESS I SERVIZI BASATI SULLA TELECOM PIATTAFORMA IP ITALIA anno8 n.3 DICEMBRE 1999 Ai lettori Uno zèfiro ci sospinge verso il Duemila "Vi immaginate il levar del sole nel primo giorno dell’anno Mille?". Con questa domanda Giosuè Carducci dà inizio al primo discorso sullo “Svolgimento della letteratura nazionale”. E proseguendo si chiede ancora: “questo fatto di tutte le mattine, ricordate, che fu quasi miracolo, fu promessa di vita nuova per le generazioni uscenti dal secolo Decimo?” Il poeta, seguendo una moda cara agli scrittori del secolo scorso, riprende infatti una leggenda romantica che trae origine da uno scritto di un monaco del Convento di Saint Benoit sur Loir del 994: “alcuni preti annunciano a Parigi la fine del mondo per l’anno Mille”. Questi ecclesiastici davano infatti sul finire del primo millennio un’interpretazione errata del passo dell’Apocalisse (20-1-3) che preconizza: “Satana resterà legato mille anni, prima di essere di nuovo liberato, sebbene per poco”. Il passaggio dal primo al secondo millennio avvenne, fortunatamente, senza che si verificasse alcun evento catastrofico. Carducci commenta: “e che stupore di gioia e che grido trionfale la mattina dell’anno Mille!” Anche ai nostri occhi si presenta un importante appuntamento: fra poco più di un mese transiteremo dal secondo al terzo millennio e osserviamo una certa inquetitudine nei Paesi dell’Occidente: mentre per il transito di mille anni fa Carducci narra che “voci correvano tra la gente … di grandi battaglie combattute nel cielo da guerrieri ignoti a cavalcione di draghi”, oggi ci preoccupa il “bug”, il baco (nascosto). -
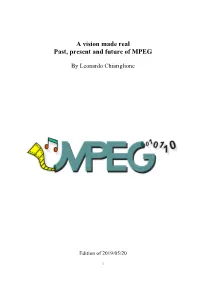
A Vision Made Real Past, Present and Future of MPEG
A vision made real Past, present and future of MPEG By Leonardo Chiariglione Edition of 2019/05/20 1 Table of Contents Why this book? ................................................................................................................................ 3 1 Introduction ............................................................................................................................. 3 2 The discontinuity of digital technologies ................................................................................ 5 3 MPEG and digital media ......................................................................................................... 8 4 The MPEG principles ............................................................................................................ 11 5 The MPEG operation ............................................................................................................ 18 5.1 The MPEG organisation ................................................................................................. 19 5.2 Organisation of work ...................................................................................................... 22 5.3 How MPEG develops standards ..................................................................................... 26 5.4 The ecosystem drives MPEG standards ......................................................................... 30 5.5 Standardisation and product making .............................................................................. 35 5.6 Standards -
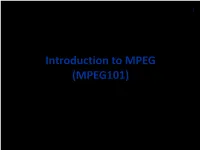
Introduction to MPEG (MPEG101) Entertainment Devices in Daily Life 2
1 Introduction to MPEG (MPEG101) Entertainment Devices in Daily Life 2 JPEG MPEG4 MP3 MPEG2 JPEG MP3 MPEG4 2 Standard Organizations 3 ITU: International Telecommunication Union ISO: International Standardization Organization IEC: International Electrotechnical Commission ISO/IEC MPEG (MPEG2, MPEG4) ITU-T VCEG (H.263, H.264) Organization: from ISO to WG 4 ISO/IEC Geneva, CH ITTF International Technical Task Force Geneva, CH JTC 1 Joint Technical Committee - Information Technology Secretariat - ANSI New YorK City SC xx SC 29 Subcommittee Subcommittee 29 Secretariat - ITSJC/IPSJ Tokyo, Japan WG 1 WG11 WG12 JPEG MPEG MHEG Moving Picture Experts Group (last meeting 2001/03 Milan, IT Organization: from WG to AdHoc 5 WG11 MPEG Committee Leonardo Chiariglione Audio Systems Video MDS Schuyler Quackenbush Olivier Avaro Jen-Rainer Ohm Ian Burnett Liaison Test Requirments ISG Jan Borman Tobias Oelbaum Rob Koenen Marco Mattevelli Integration SNHC Jean-Claude Durford Mickael Borgas-Sevenier Organization: from WG to AdHoc 6 WG11 MPEG Committee Leonardo Chiariglione Audio Systems Video MDS Schuyler Quackenbush Olivier Avaro Jen-Rainer Ohm Ian Burnett Liaison Test Requirments ISG Jan Borman Tobias Oelbaum Rob Koenen Marco Mattevelli Integration SNHC Jean-Claude Durford Mickael Borgas-Sevenier MPEG Committee 7 Convener: Leonardo Chiariglione Standards: – MPEG-1: done – MPEG-2: done – MPEG-4: done?! – MPEG-7: done?! – MPEG-21: done? – MPEG-A,B,C,D,…: on-going MPEG-2:1996 Emmy for Technical Excellence AVC: 2008 ATAS Primetime Emmy Engineering Award 2009 -
![Presentaz-Chiariglione [Modalità Compatibilità]](https://docslib.b-cdn.net/cover/8463/presentaz-chiariglione-modalit%C3%A0-compatibilit%C3%A0-11988463.webp)
Presentaz-Chiariglione [Modalità Compatibilità]
Prospects of multimedia technologies and applications Leonardo Chiariglione IET Lectio Magistralis Bologna – 2013/10/24 The “hard” analogue times Marcus Valerius Martialis (Epigrammata LII) Commendo tibi, Quintiane, nostros -- nostros dicere si tamen libellos possum, quos recitat tuus poeta -- : si de servitio gravi queruntur, adsertor venias satisque praestes, et, cum se dominum vocabit ille, dicas esse meos manuque missos. Hoc si terque quaterque clamitaris, inpones plagiario pudorem. (Slightly less) “hard” analogue times Ludovico Ariosto (1515 AD) was afraid that people would copy his poem without rewarding him He made a business proposition to Duke Alfonso d’Este of Ferrara: YOU fine those who pirate my works and WE share the proceeds Something changed – but not so much – in 2000 years Titus Pomponius Atticus (1 st century BC) employed a large number of trained slaves to copy and produce books with retail branches in the provinces of the Roman empire A Chinese publisher's account (12 th century AC) for a book of 1,300 pages indicates a 3 to 1 ratio of selling price to production costs Gutenberg’s invention fostered the creation of the role of publisher Many analogue media technologies Movable character Cinematography printing Radio Photography Television Telephony Tape recording Facsimile Photocopy Sound recording 5 When professional copy became possible… Whereas Printers, Booksellers, and other Persons, have of late frequently taken the Liberty of Printing, Reprinting, and Publishing, or causing to be Printed, Reprinted, and Published, Books, and other Writings, without the Consent of the Authors or Proprietors of such Books and Writings, to their very great Detriment, and too often to the Ruin of them and their Families: For Preventing therefore such Practices for the future, and for the Encouragement of Learned Men to Compose and Write useful Books; May it please Your Majesty, that it may be Enacted .. -

Lecture 12 Large-Scale Multimedia Analysis: MPEG Video and Visual Search
E6895 Advanced Big Data Analytics Lecture 12 Large-Scale Multimedia Analysis: MPEG Video and Visual Search Guest Speaker: Wen-Hsiao Peng National Chiao Tung University (NCTU), Taiwan Ching-Yung Lin, Ph.D. Adjunct Professor, Dept. of Electrical Engineering and Computer Science IBM Chief Scientist, Graph Computing E6895 Advanced Big Data Analytics – Lecture 12: Large-Scale Multimedia Analysis © 2016 CY Lin, Columbia University Wen-Hsiao (Wen) Peng 2015 -- : Visiting Scholar, IBM T. J. Watson, New York, US 2006 -- : Associate Professor, Nat’l Chiao Tung Univ., CS Dept. 2005 : Ph.D. in EE, Nat’l Chiao Tung Univ., Taiwan 2013 -- : IEEE Senior Member 2009 -- : Technical Committee Member, IEEE CASS Visual Signal Processing and Communications (VSPC) & Multimedia Systems and Applications (MSA) 2003 -- : ISO/IEC MPEG Delegate, Taiwan Team Coordinator 2015 -- : Lead Guest Editor, IEEE J. Emerg. Sel. Topics in Circuits and Systems 2006 -- : TPC Co-Chair/Member/Area Chair for IEEE VCIP, ISCAS, ICME, etc. 2000 -- 2001: Intel Microprocessor Research Lab, Santa Clara, US 2 E6895 Advanced Big Data Analytics – Lecture 12: Large-Scale Multimedia Analysis © 2016 CY Lin, Columbia University Outline Part I – ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) Background Recent Milestones Future Video, Machine Learning, and Media Internet-of-Things Part II – MPEG Compact Descriptor for Visual Search (CDVS) Large-scale Image Retrieval Local Image Descriptors Global Image Descriptors Image Matching Use Case: Mobile Indoor Navigation Part III – Cross-domain