Zur Historie Der Komplexen Dynamischen System
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

On the Origin and Early History of Functional Analysis
U.U.D.M. Project Report 2008:1 On the origin and early history of functional analysis Jens Lindström Examensarbete i matematik, 30 hp Handledare och examinator: Sten Kaijser Januari 2008 Department of Mathematics Uppsala University Abstract In this report we will study the origins and history of functional analysis up until 1918. We begin by studying ordinary and partial differential equations in the 18th and 19th century to see why there was a need to develop the concepts of functions and limits. We will see how a general theory of infinite systems of equations and determinants by Helge von Koch were used in Ivar Fredholm’s 1900 paper on the integral equation b Z ϕ(s) = f(s) + λ K(s, t)f(t)dt (1) a which resulted in a vast study of integral equations. One of the most enthusiastic followers of Fredholm and integral equation theory was David Hilbert, and we will see how he further developed the theory of integral equations and spectral theory. The concept introduced by Fredholm to study sets of transformations, or operators, made Maurice Fr´echet realize that the focus should be shifted from particular objects to sets of objects and the algebraic properties of these sets. This led him to introduce abstract spaces and we will see how he introduced the axioms that defines them. Finally, we will investigate how the Lebesgue theory of integration were used by Frigyes Riesz who was able to connect all theory of Fredholm, Fr´echet and Lebesgue to form a general theory, and a new discipline of mathematics, now known as functional analysis. -

Mathematicians Fleeing from Nazi Germany
Mathematicians Fleeing from Nazi Germany Mathematicians Fleeing from Nazi Germany Individual Fates and Global Impact Reinhard Siegmund-Schultze princeton university press princeton and oxford Copyright 2009 © by Princeton University Press Published by Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540 In the United Kingdom: Princeton University Press, 6 Oxford Street, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TW All Rights Reserved Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Siegmund-Schultze, R. (Reinhard) Mathematicians fleeing from Nazi Germany: individual fates and global impact / Reinhard Siegmund-Schultze. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-691-12593-0 (cloth) — ISBN 978-0-691-14041-4 (pbk.) 1. Mathematicians—Germany—History—20th century. 2. Mathematicians— United States—History—20th century. 3. Mathematicians—Germany—Biography. 4. Mathematicians—United States—Biography. 5. World War, 1939–1945— Refuges—Germany. 6. Germany—Emigration and immigration—History—1933–1945. 7. Germans—United States—History—20th century. 8. Immigrants—United States—History—20th century. 9. Mathematics—Germany—History—20th century. 10. Mathematics—United States—History—20th century. I. Title. QA27.G4S53 2008 510.09'04—dc22 2008048855 British Library Cataloging-in-Publication Data is available This book has been composed in Sabon Printed on acid-free paper. ∞ press.princeton.edu Printed in the United States of America 10 987654321 Contents List of Figures and Tables xiii Preface xvii Chapter 1 The Terms “German-Speaking Mathematician,” “Forced,” and“Voluntary Emigration” 1 Chapter 2 The Notion of “Mathematician” Plus Quantitative Figures on Persecution 13 Chapter 3 Early Emigration 30 3.1. The Push-Factor 32 3.2. The Pull-Factor 36 3.D. -
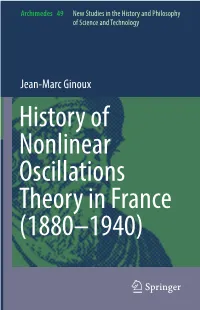
History of Nonlinear Oscillations Theory in France (1880–1940)
Archimedes 49 New Studies in the History and Philosophy of Science and Technology Jean-Marc Ginoux History of Nonlinear Oscillations Theory in France (1880–1940) History of Nonlinear Oscillations Theory in France (1880–1940) Archimedes NEW STUDIES IN THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VOLUME 49 EDITOR JED Z. BUCHWALD, Dreyfuss Professor of History, California Institute of Technology, Pasadena, USA. ASSOCIATE EDITORS FOR MATHEMATICS AND PHYSICAL SCIENCES JEREMY GRAY, The Faculty of Mathematics and Computing, The Open University, UK. TILMAN SAUER, Johannes Gutenberg University Mainz, Germany ASSOCIATE EDITORS FOR BIOLOGICAL SCIENCES SHARON KINGSLAND, Department of History of Science and Technology, Johns Hopkins University, Baltimore, USA. MANFRED LAUBICHLER, Arizona State University, USA ADVISORY BOARD FOR MATHEMATICS, PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY HENK BOS, University of Utrecht, The Netherlands MORDECHAI FEINGOLD, California Institute of Technology, USA ALLAN D. FRANKLIN, University of Colorado at Boulder, USA KOSTAS GAVROGLU, National Technical University of Athens, Greece PAUL HOYNINGEN-HUENE, Leibniz University in Hannover, Germany TREVOR LEVERE, University of Toronto, Canada JESPER LÜTZEN, Copenhagen University, Denmark WILLIAM NEWMAN, Indiana University, Bloomington, USA LAWRENCE PRINCIPE, The Johns Hopkins University, USA JÜRGEN RENN, Max Planck Institute for the History of Science, Germany ALEX ROLAND, Duke University, USA ALAN SHAPIRO, University of Minnesota, USA NOEL SWERDLOW, California Institute of Technology, -

Roman Duda (Wrocław, Poland) EMIGRATION OF
ORGANON 44:2012 Roman Duda (Wrocław, Poland) EMIGRATION OF MATHEMATICIANS FROM POLAND IN THE 20 th CENTURY (ROUGHLY 1919–1989) ∗ 1. Periodization For 123 years (1795–1918) Poland did not exist as an independent state, its territory being partitioned between Prussia (Germany), Austria and Russia 1. It was a period of enforced assimilation within new borders and thus of restraining native language and culture which first provoked several national uprisings against oppressors, and then – in the three decades at the turn of the 19 th to 20 th centuries – of a slow rebuilding of the nation’s intellectual life. Conditions, however, were in general so unfavourable that many talents remained undeveloped while some talented people left the country to settle and work elsewhere. Some of the mathematicians emigrating then (in the chronological order of birth): • Józef Maria Hoene–Wro ński (1776–1853) in France, • Henryk Niew ęgłowski (1807–1881) in Paris, • Edward Habich (1835–1909) in Peru, • Franciszek Mertens (1840–1929) in Austria, • Julian Sochocki (1842–1927) in Petersburg, • Jan Ptaszycki (1854–1912) in Petersburg, • Bolesław Młodziejewski (1858–1923) in Moscow, • Cezary Russyan (1867–1934) in Kharkov, • Władysław Bortkiewicz (1868–1931) in Berlin, • Alexander Axer (1880–1948) in Switzerland. Thus the period of partitions was a time of a steady outflow of many good names (not only mathematicians), barely balanced by an inflow due to assim- ilation processes. The net result was decisively negative. After Poland regained independence in 1918, five newly established or re–established Polish universities (Kraków, Lwów, Warsaw, Vilnius, Pozna ń) ∗ The article has been prepared on the suggestion of Prof. -

HARDY SPACES the Theory of Hardy Spaces Is a Cornerstone of Modern Analysis
CAMBRIDGE STUDIES IN ADVANCED MATHEMATICS 179 Editorial Board B. BOLLOBAS,´ W. FULTON, F. KIRWAN, P. SARNAK, B. SIMON, B. TOTARO HARDY SPACES The theory of Hardy spaces is a cornerstone of modern analysis. It combines techniques from functional analysis, the theory of analytic functions, and Lesbesgue integration to create a powerful tool for many applications, pure and applied, from signal processing and Fourier analysis to maximum modulus principles and the Riemann zeta function. This book, aimed at beginning graduate students, introduces and develops the classical results on Hardy spaces and applies them to fundamental concrete problems in analysis. The results are illustrated with numerous solved exercises which also introduce subsidiary topics and recent developments. The reader’s understanding of the current state of the field, as well as its history, are further aided by engaging accounts of the key players and by the surveys of recent advances (with commented reference lists) that end each chapter. Such broad coverage makes this book the ideal source on Hardy spaces. Nikola¨ı Nikolski is Professor Emeritus at the Universite´ de Bordeaux working primarily in analysis and operator theory. He has been co-editor of four international journals and published numerous articles and research monographs. He has also supervised some 30 PhD students, including three Salem Prize winners. Professor Nikolski was elected Fellow of the AMS in 2013 and received the Prix Ampere` of the French Academy of Sciences in 2010. CAMBRIDGE STUDIES IN ADVANCED MATHEMATICS Editorial Board B. Bollobas,´ W. Fulton, F. Kirwan, P. Sarnak, B. Simon, B. Totaro All the titles listed below can be obtained from good booksellers or from Cambridge University Press. -

Essay Review
HISTORIA MATHEMATICA 23, (1996), 74±84 ARTICLE NO. 0006 ESSAY REVIEW Edited by CATHERINE GOLDSTEIN AND PAUL R. WOLFSON All books, monographs, journal articles, and other publications (including ®lms and other multisensory materials) relating to the history of mathematics are abstracted in the Abstracts Department. The Reviews Department prints extended reviews of selected publications. Materials for review, except books, should be sent to the Abstracts Editor, Professor David E. Zitarelli, Department of Mathematics, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania 19122, U.S.A. Books in English for review should be sent to Professor Paul R. Wolfson, Department of Mathematics, West Chester University, West Chester, Pennsylvania 19383, U.S.A. Books in other languages for review should be sent to Professor Catherine Goldstein, BaÃtiment 425, MatheÂmatiques, UniversiteÂde Paris-Sud, F-91405 Orsay Cedex, France. Most reviews are solicited. However, colleagues wishing to review a book are invited to make their wishes known to the appropriate Book Review Editor. (Requests to review books written in the English language should be sent to Prof. Paul R. Wolfson at the above address; requests to review books written in other languages should be sent to Prof. Catherine Goldstein at the above address.) We also welcome retrospective reviews of older books. Colleagues interested in writing such reviews should consult ®rst with the appropriate Book Review Editor (as indicated above, according to the language in which the book is written) to avoid duplication. A History of Complex Dynamics, from SchroÈ der to Fatou and Julia. By Daniel S. Alexander. Wiesbaden (Vieweg). 1994. REVIEWED BY T. W. GAMELIN Mathematics Department, University of California at Los Angeles, Los Angeles, California 90024 The book under review is a readable and engaging account of the development of complex iteration theory over half a century, from Ernst SchroÈ der's landmark pair of papers of 1870±1871 to the work of Pierre Fatou and Gaston Julia appearing in 1917±1920. -

Grained Integers and Applications to Cryptography
poses. These works may not bemission posted of elsewhere the without copyright the holder. explicit (Last written update per- 2017/11/29-18 :20.) . Grained integers and applications to cryptography Rheinischen Friedrich-Willhelms-Universität Bonn Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ing any of theseeach documents will copyright adhere holder, to and the in terms particular and use constraints them invoked only by for noncommercial pur- Erlangung des Doktorgrades (Dr. rer. nat.) . Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Rheinischen Daniel Loebenberger Bonn, Januar 2012 Dissertation vorgelegt von Nürnberg aus der der zur are maintained by the authors orthese by works other are copyright posted holders, here notwithstanding electronically. that It is understood that all persons copy- http://hss.ulb.uni-bonn.de/2012/2848/2848.htm Grained integers and applications to cryptography (2012). OEBENBERGER L ANIEL D Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. URL This document is provided as aand means to technical ensure work timely dissemination on of a scholarly non-commercial basis. Copyright and all rights therein Angefertigt mit Genehmigung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1. Gutachter: Prof. Dr. Joachim von zur Gathen 2. Gutachter: Prof. Dr. Andreas Stein Tag der Promotion: 16.05.2012 Erscheinungsjahr: 2012 iii Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶ παντὸς τοῦ προτένθος πλήθους πρώτων ἀριθμῶν.1 (Euclid) Problema, numeros primos a compositis dignoscendi, hosque in factores suos primos resolvendi, ad gravissima ac ultissima totius arithmeticae pertinere [...] tam notum est, ut de hac re copiose loqui superfluum foret. [...] Praetereaque scientiae dignitas requirere videtur, ut omnia subsidia ad solutionem problematis tam elegantis ac celibris sedulo excolantur.2 (C. -

Lucjan Emil Böttcher (1872‒1937) ‒ the Polish Pioneer of Holomorphic Dynamics
TECHNICAL TRANSACTIONS CZASOPISMO TECHNICZNE FUNDAMENTAL SCIENCES NAUKI PODSTAWOWE 1-NP/2014 MAŁGORZATA STAWISKA* LUCJAN EMIL BÖTTCHER (1872‒1937) ‒ THE POLISH PIONEER OF HOLOMORPHIC DYNAMICS LUCJAN EMIL BÖTTCHER (1872‒1937) ‒ POLSKI PIONIER DYNAMIKI HOLOMORFICZNEJ Abstract In this article I present Lucjan Emil Böttcher (1872‒1937), a little-known Polish mathematician active in Lwów. I outline his scholarly path and describe briefly his mathematical achievements. In view of later developments in holomorphic dynamics, I argue that, despite some flaws in his work, Böttcher should be regarded not only as a contributor to the area but in fact as one of its founders. Keywords: mathematics of the 19th and 20th century, holomorphic dynamics, iterations of rational functions Streszczenie W artykule tym przedstawiam Lucjana Emila Böttchera (1872‒1937), mało znanego matema- tyka polskiego działającego we Lwowie. Szkicuję jego drogę naukową oraz opisuję pokrótce jego osiągnięcia matematyczne. W świetle późniejszego rozwoju dynamiki holomorficznej do- wodzę, że mimo pewnych wad jego prac należy nie tylko docenić wkład Böttchera w tę dzie- dzinę, ale w istocie zaliczyć go do jej twórców. Słowa kluczowe: matematyka XIX i XX wieku, dynamika holomorficzna, iteracje funkcji wymiernych * Małgorzata Stawiska, Mathematical Reviews, 416 Fourth St., Ann Arbor, MI 48103, USA, email: [email protected]. 234 1. Introduction Holomorphic dynamics – in particular the study of iteration of rational maps on the Riemann sphere – is an active area of current mathematical -

Proceedings of Symposia in PURE MATHEMATICS
Proceedings of Symposia in PURE MATHEMATICS Volume 72, Part 1 Fractal Geometry and Applications: A Jubilee of Benoît Mandelbrot Analysis, Number Theory, and Dynamical Systems Michel L. Lapidus (Managing Editor) Machiel van Frankenhuijsen Editors M THE ATI A CA M L ΤΡΗΤΟΣ ΜΗ N ΕΙΣΙΤΩ S A O C C I I American Mathematical Society R E E T ΑΓΕΩΜΕ Y M A Providence, Rhode Island F O 8 U 88 NDED 1 Proceedings of a special session held in January 2002 during the Annual Meeting of the American Mathematical Society in San Diego, California entitled Fractal Geometry and Applications: AJubileeofBenoˆıt Mandelbrot. Some of the contributions to this volume are by speakers from a related special session on Fractal Geometry, Number Theory, and Dynamical Systems held during the first Joint Meeting of the Soci´et´eMath´ematique de France and the American Mathematical Society at the Ecole´ Normale Sup´erieure de Lyon in July 2001. 2000 Mathematics Subject Classification. Primary 28A12, 28A80, 11K60, 11M41, 37A45, 37F45, 60G57, 60J45, 68U05, 82C41. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Fractal geometry and applications : a jubilee of Benoˆıt Mandelbrot / Michel L. Lapidus (managing editor), Machiel van Frankenhuijsen, editors. p. cm. — (Proceedings of symposia in pure mathematics ; v. 72) Includes bibliiographical references. Contents: pt. 1. Analysis, number theory, and dynamical systems – pt. 2. Multifractals, prob- ability and statistical mechanics, applications. ISBN 0-8218-3292-1 (set : acid-free paper) – ISBN 0-8218-3637-4 (pt. 1 : acid-free paper) – ISBN 0-8218-3638-2 (pt. 2 : acid-free paper) 1. Measure theory–Congresses. 2. -
An Introduction to Fatou and Julia Sets
AN INTRODUCTION TO JULIA AND FATOU SETS SCOTT SUTHERLAND ABSTRACT. We give an elementary introduction to the holomorphic dynamics of mappings on the Riemann sphere, with a focus on Julia and Fatou sets. Our main emphasis is on the dynamics of polynomials, especially quadratic polynomials. 1. INTRODUCTION In this note, we briefly introduce some of the main elementary ideas in holomorphic dynamics. This is by no means a comprehensive coverage. We do not discuss the Mandelbrot set, despite its inherent relevance to the subject; the Mandelbrot set is covered in companion articles by Devaney [Dev13, Dev14]. For a more detailed and and comprehensive introduction to this subject, the reader is refered to the book [Mil06] by John Milnor, the survey article [Bla84] by Blanchard, the text by Devaney [Dev89], or any of several other introductory texts ([Bea91], [CG93], etc.) Holomorphic dynamics is the study of the iterates of a holomorphic map f on a complex man- ifold. Classically, this manifold is one of the complex plane C, the punctured plane C∗, or the Riemann sphere Cb = C [ f1g. In these notes, we shall primarily restrict our attention to the last case, where f is a rational map (in fact, most examples will be drawn from quadratic polynomials f(z) = z2 + c, with z and c 2 C). Based on the behavior of the point z under iteration of f, the Riemann sphere Cb is partitioned into two sets • The Fatou set Ff (or merely F), on which the dynamics are tame, and • The Julia set Jf (or J ), where there is sensitive dependence on initial conditions and the dynamics are chaotic. -
![Pdf/Mehmat/Mm2.Pdf) [23] Siegmund-Schultze, Reinhard: Mathematicians Fleeing from Na- [4] Fricker, François: Einführung in Die Gitterpunktlehre,Birkhäuser, Zi Germany](https://docslib.b-cdn.net/cover/0651/pdf-mehmat-mm2-pdf-23-siegmund-schultze-reinhard-mathematicians-fleeing-from-na-4-fricker-fran%C3%A7ois-einf%C3%BChrung-in-die-gitterpunktlehre-birkh%C3%A4user-zi-germany-6100651.webp)
Pdf/Mehmat/Mm2.Pdf) [23] Siegmund-Schultze, Reinhard: Mathematicians Fleeing from Na- [4] Fricker, François: Einführung in Die Gitterpunktlehre,Birkhäuser, Zi Germany
Von Wiesbaden nach Tiflis Die wechselvolle Lebensgeschichte des Zahlentheoretikers Arnold Walfisz Ekkehard Krätzel und Christoph Lamm 1 Familie und Studium bis 1918 Im Herbst 1914 musste ich meine Studien unter- brechen und nahm in Wiesbaden meinen Wohn- Arnold Walfisz (1892–1962) stammte aus einer wohlha- sitz, wo meine Eltern seit 1906 dauernd wohnhaft benden jüdisch-polnischen Familie. Sein Großvater Aron sind. Ich benutzte diesen Aufenthalt zur weiteren Walfisz (1821–1891) war Papierhändler in Warschau. Arbeit, namentlich in Gruppentheorie und analyti- Zwei der sechs Söhne Arons wurden Chemiker, Arnolds scher Zahlentheorie. 1918 kehrte ich nach Göttin- Vater Zygmunt (1867–1939) war Kaufmann. Im Jahr 1905 gen zurück und studierte, unter privater Anleitung kamen Zygmunt und sein jüngerer Bruder Bronislaw mit von Prof. Landau, die Theorie der Dirichlet’schen ihren Familien nach Deutschland. Die antisemitischen Po- Reihen sowie analytische Zahlen- und Idealtheo- rie. Februar 1919 nahm ich an der Leitung der grome, die 1903–1905 im russischen Reich verstärkt auf- 2 traten, führten zu dieser Zeit zu einer Auswanderungs- von Geh. Klein eingerichteten Repititionskurse für welle. Kriegsteilnehmer teil und habe einen Kursus über Differential- und Integralrechnung gelesen. Während die Familie von Bronislaw nach wenigen Jahren nach Warschau zurückkehrte, blieb Zygmunt Walfisz mit In der Zeit bis August 1920 veröffentlichte er ein Ergeb- seiner Frau Luise und 4 Kindern dauerhaft in Deutsch- nis zusammen mit Edmund Landau (1877–1938), und er land. Nach einem halben Jahr in Seesen am Harz, wo stellte seine Doktorarbeit fertig: Arnold Walfisz und sein jüngerer Bruder Henryk Schü- Von Ende 1919 datiert die in der Anlage beigefügte, ler der Jacobson-Schule waren, zog die Familie im Früh- gemeinsam mit Prof. -
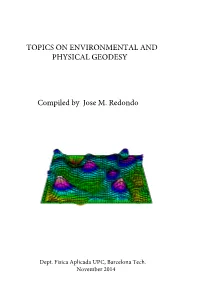
TOPICS on ENVIRONMENTAL and PHYSICAL GEODESY Compiled By
TOPICS ON ENVIRONMENTAL AND PHYSICAL GEODESY Compiled by Jose M. Redondo Dept. Fisica Aplicada UPC, Barcelona Tech. November 2014 Contents 1 Vector calculus identities 1 1.1 Operator notations ........................................... 1 1.1.1 Gradient ............................................ 1 1.1.2 Divergence .......................................... 1 1.1.3 Curl .............................................. 1 1.1.4 Laplacian ........................................... 1 1.1.5 Special notations ....................................... 1 1.2 Properties ............................................... 2 1.2.1 Distributive properties .................................... 2 1.2.2 Product rule for the gradient ................................. 2 1.2.3 Product of a scalar and a vector ................................ 2 1.2.4 Quotient rule ......................................... 2 1.2.5 Chain rule ........................................... 2 1.2.6 Vector dot product ...................................... 2 1.2.7 Vector cross product ..................................... 2 1.3 Second derivatives ........................................... 2 1.3.1 Curl of the gradient ...................................... 2 1.3.2 Divergence of the curl ..................................... 2 1.3.3 Divergence of the gradient .................................. 2 1.3.4 Curl of the curl ........................................ 3 1.4 Summary of important identities ................................... 3 1.4.1 Addition and multiplication .................................