Das Göttinger Nobelpreiswunder
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Böcker Från Svenska Akademien 2018
Böcker från Svenska Akademien 2018 Om Svenska Akademiens bokutgivning Svenska Akademien bedriver en omfattande bokutgivning inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur. Utgivning- en sker i samarbete med Norstedts förlag och Bokförlaget Atlantis med undantag av några titlar som utges i form av behovstryck (»print on demand«). Den språkliga utgivningen innefattar bl.a. standardverk som Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens grammatik. För främjande av svensk litteratur utger Svenska Akademien serien Svenska klassiker. En annan viktig del av utgivningen på det litterära området gäller Nobelpriset i litteratur. Hit hör även böcker om Nobelbiblioteket och böcker utgivna av Nobelbiblioteket. Akademien dokumenterar den egna verksamheten i serien Svenska Akademiens handlingar. I handlingarna ingår också den minnesteckning som Akademien varje år utger över en bemärkt svensk. I serien Minnesbiblioteket utges ett urval biografiska och historiska texter som tidigare publicerats i handlingarna. Ett flertal böcker är avsedda att tillgodose omvärldens behov av information om Akademien själv, dess verksamhet och historia. I utgivningen ingår också enstaka publikationer som mer indirekt har samband med Akademien och dess verksamhet. De presenteras under rubriken »Övrig utgivning«. Några av Akademiens böcker finns även utgivna på andra språk, främst engelska. * I denna katalog presenteras samtliga under året tillgängliga titlar som utgivits av Svenska Akademien. De kan köpas i eller beställas genom bokhandeln. För en mer fullständig förteckning, som även inkluderar äldre titlar vilka inte längre finns i handeln, hänvisas till Akademiens webbplats: www.svenskaakademien.se/publikationer. nyheter 2018 4 Nyheter 2018 Eufemiavisorna I–II (i serien Svenska klassiker) Eufemiavisorna är samlingsnamnet på vår litteraturs tre äldsta skönlitterära verk, versromanerna Flores och Blanzeflor, Hertig Fredrik av Normandie och Ivan lejonriddaren, som översattes till svenska i början av 1300-talet. -

The Role of Translation in the Nobel Prize in Literature : a Case Study of Howard Goldblatt's Translations of Mo Yan's Works
Lingnan University Digital Commons @ Lingnan University Theses & Dissertations Department of Translation 3-9-2016 The role of translation in the Nobel Prize in literature : a case study of Howard Goldblatt's translations of Mo Yan's works Yau Wun YIM Follow this and additional works at: https://commons.ln.edu.hk/tran_etd Part of the Applied Linguistics Commons, and the Translation Studies Commons Recommended Citation Yim, Y. W. (2016). The role of translation in the Nobel Prize in literature: A case study of Howard Goldblatt's translations of Mo Yan's works (Master's thesis, Lingnan University, Hong Kong). Retrieved from http://commons.ln.edu.hk/tran_etd/16/ This Thesis is brought to you for free and open access by the Department of Translation at Digital Commons @ Lingnan University. It has been accepted for inclusion in Theses & Dissertations by an authorized administrator of Digital Commons @ Lingnan University. Terms of Use The copyright of this thesis is owned by its author. Any reproduction, adaptation, distribution or dissemination of this thesis without express authorization is strictly prohibited. All rights reserved. THE ROLE OF TRANSLATION IN THE NOBEL PRIZE IN LITERATURE: A CASE STUDY OF HOWARD GOLDBLATT’S TRANSLATIONS OF MO YAN’S WORKS YIM YAU WUN MPHIL LINGNAN UNIVERSITY 2016 THE ROLE OF TRANSLATION IN THE NOBEL PRIZE IN LITERATURE: A CASE STUDY OF HOWARD GOLDBLATT’S TRANSLATIONS OF MO YAN’S WORKS by YIM Yau Wun 嚴柔媛 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Philosophy in Translation LINGNAN UNIVERSITY 2016 ABSTRACT The Role of Translation in the Nobel Prize in Literature: A Case Study of Howard Goldblatt’s Translations of Mo Yan’s Works by YIM Yau Wun Master of Philosophy The purpose of this thesis is to explore the role of the translator and translation in the Nobel Prize in Literature through an illustration of the case of Howard Goldblatt’s translations of Mo Yan’s works. -

A Propósito Del Sexto Premio Nobel Polaco De Literatura
A propósito del sexto Premio Nobel polaco de Literatura A propósito del sexto Premio Nobel polaco de Literatura Ramón León Universidad Ricardo Palma [email protected] Lima-Perú “Si no hubiera Polonia no habría polacos” (Ubu Rey, de Alfred Jarry) El 10 de octubre del 2019, la Academia Sueca dio a conocer en Estocolmo a los galardonados con el Premio Nobel de Literatura de los años 2018 y 2019, como siempre, ante la presencia de una gran cantidad de periodistas que, de inmediato, difundieron los nombres Resumen de los premiados a través de las agencias de prensa y medios de comunicación: se trataba de Olga Tokarczuk El presente artículo comenta el otorgamiento del Premio (1962), polaca, y Peter Handke (1942), austriaco. Nobel de Literatura del 2018 a la escritora polaca Olga Tokarczuk. Este premio constituye el sexto otorgado a un La concesión de un premio Nobel (ritual que se cumple escritor polaco. Se discute la preeminencia de autores de un cada año), cualquiera que sea la rama en la cual se otorgue, país europeo relativamente pequeño, con una lengua que concita la atención del mundo entero (Zuckerman, solo la hablan treinta millones de personas y que no suele ser 1978), pues es considerado el más importante en traducida; y se señalan algunas causas para ello. Asimismo se el mundo; ningún otro tiene tal resonancia y efecto comenta la escasa presencia de autores de otros continentes en la lista de los premios Nobel de Literatura. consagratorio, casi de inmortalidad. Nadie se ha atrevido a rechazarlo una vez que le ha sido concedido, excepto Palabras clave: Olga Tokarczuk, Polonia, Premio Nobel de Jean Paul Sartre (1905-1980), que se negó a aceptarlo 1 Literatura, poesía. -

Download Som
ARTIKELNAMNET TEXT OCH TRADITION 1 FÖRFATTARENS NAMN Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter 1. Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser. Red. av Lars Burman & Barbro Ståhle Sjönell. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 1999 (distribution: Almqvist & Wiksell International). ISBN 91- 7230-087-6 2. Megen viden i forskellige hoveder. Om kommentering af nordiske klassikere. Red. af Johnny Kondrup & Karsten Kynde. C.A. Reitzels Forlag, København 2000. ISBN 87-7876-200-6 3. Bok og skjerm. Forholdet mellom bokbasert og digitalt basert tekstut- givelse. Red. av Jon Gunnar Jørgensen, Tone Modalsli, Espen S. Ore, Vigdis Ystad. Fagbokforlaget, Oslo 2001. ISBN 82-7322-171-7 ISSN 1601-1562 2 ARTIKELNAMNET Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter. 4 TEXT OCH TRADITION OM TEXTEDERING OCH KANONBILDNING Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 12–14 oktober 2001 Redigerad av Lars Burman och Barbro Ståhle Sjönell SVS SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET STOCKHOLM 2002 3 FÖRFATTARENS NAMN Utgiven med bidrag från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet Abstract Text och tradition. Om textedering och kanonbildning, red. Lars Burman och Barbro Ståhle Sjönell (Text and Tradition. On Text Editing and the Creation of a Literary Canon, ed. Lars Burman and Barbro Ståhle Sjönell), Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer. Skrifter. 4, 178 pp., Svenska Vitterhetssamfundet, Stock- holm 2002. ISBN 91-7230-107-4. ISSN 1601-1562. The volume consists of papers from a conference arranged by the Nordic Network for Textual Critics (Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer, NNE) in 2001. Contributions were centred on the questions if and how critical editions influence the literary canon. Several speakers used a debate that took place in Denmark during the 90’s concerning the literary canon as a point of departure. -

Böcker Från Svenska Akademien 2016 Om Svenska Akademiens Bokutgivning
Böcker från Svenska Akademien 2016 Om Svenska Akademiens bokutgivning Svenska Akademien bedriver en omfattande bokutgivning inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur. Utgivning- en sker i samarbete med Norstedts förlag och Bokförlaget Atlantis med undantag av några titlar som utges i form av behovstryck (»print on demand«). Den språkliga utgivningen innefattar bl.a. standardverk som Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens grammatik. För främjande av svensk litteratur utger Svenska Akademien serien Svenska klassiker. En annan viktig del av utgivningen på det litterära området gäller Nobelpriset i litteratur. Hit hör även böcker om Nobelbiblioteket och böcker utgivna av Nobelbiblioteket. Akademien dokumenterar den egna verksamheten i serien Svenska Akademiens handlingar. I handlingarna ingår också den minnesteckning som Akademien varje år utger över en bemärkt svensk. I serien Minnesbiblioteket utges ett urval biografiska och historiska texter som tidigare publicerats i handlingarna. Ett flertal böcker är avsedda att tillgodose omvärldens behov av information om Akademien själv, dess verksamhet och historia. I utgivningen ingår också enstaka publikationer som mer indirekt har samband med Akademien och dess verksamhet. De presenteras under rubriken »Övrig utgivning«. Några av Akademiens böcker finns även utgivna på andra språk, främst engelska. * I denna katalog presenteras samtliga under året tillgängliga titlar som utgivits av Svenska Akademien. De kan köpas i eller beställas genom bokhandeln. För en mer fullständig förteckning, som inkluderar äldre titlar vilka inte längre finns i handeln, hänvisas till Akademiens webbplats: www.svenskaakademien.se/publikationer nyheter 2016 4 Nyheter 2016 August BlAnche Marmorbruden. Stockholmsberättelser i urval (i serien Svenska klassiker) August Blanche (1811–68) blev med Bilder ur verkligheten en av landets mest lästa författare, känd som både sympatisk samtidsskildrare och politisk opinionsbildare. -
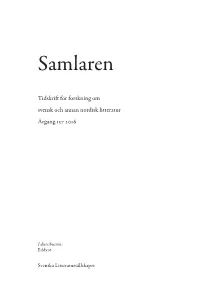
FULLTEXT01.Pdf
Samlaren Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur Årgång 137 2016 I distribution: Eddy.se Svenska Litteratursällskapet REDAKTIONSKOMMITTÉ: Berkeley: Linda Rugg Göteborg: Lisbeth Larsson Köpenhamn: Johnny Kondrup Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius München: Annegret Heitmann Oslo: Elisabeth Oxfeldt Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin Tartu: Daniel Sävborg Uppsala: Torsten Pettersson, Johan Svedjedal Zürich: Klaus Müller-Wille Åbo: Claes Ahlund Redaktörer: Jon Viklund (uppsatser) och Andreas Hedberg (recensioner) Biträdande redaktör: Ljubica Miočević Inlagans typografi: Anders Svedin Utgiven med stöd av Svenska Akademien, Vetenskapsrådet och Sven och Dagmar Saléns Stiftelse Bidrag till Samlaren insändes digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till [email protected]. Konsultera skribentinstruktionerna på sällskapets hemsida innan du skickar in. Sista inläm- ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 15 juni 2017 och för recensioner 1 sep- tember 2017. Samlaren publiceras även digitalt, varför den som sänder in material till Samlaren därmed anses medge digital publicering. Den digitala utgåvan nås på: http://www.svelitt.se/ samlaren/index.html. Sällskapet avser att kontinuerligt tillgängliggöra även äldre årgångar av tidskriften. Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till för- fogande som bedömare av inkomna manuskript. Svenska Litteratursällskapet PG: 5367–8. Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.svelitt.se. -

Homenaje a Inger Enkvist
Homenaje a Inger Enkvist COLECCIÓN DE ARTÍCULOS EN HONOR A SU CARRERA Miscelánea / Festskrift Revista Hispanista Escandinava, vol.4 Pedro de Felipe & Fernando López Serrano (eds.) Revista Hispanista Escandinava, vol.4, 2015 «Un buen profesor es siempre recordado por sus alumnos » Inger Enkvist Gracias por tantos y tan gratos recuerdos, Inger. © Pedro de Felipe & Fernando López Serrano 2015 2 Tabula gratulatoria Pilar Álvarez, Kalmar José María Izquierdo, Oslo Joan Álvarez, Estocolmo Ingela Johansson, Lund Juan Antonio Ardila, Edimburgo Arne Jönsson, Lund Nuria Aris, La Rioja Björn Larsson, Lund Petra Bernardini, Lund Fernando López Serrano, Lund Jerker Blomqvist, Lund Annika Mörte Alling, Lund Karin Blomqvist, Lund Anders Piltz, Lund Roy C. Boland, Sydney Anna Ponnert, Lund Carla Cariboni Killander, Lund Leonardo Rossiello, Uppsala Roberta Colonna Dahlman, Lund Vassilios Sabatakis, Lund Marcelo Cea, Lund Ingmar Söhrman, Gotemburgo Pedro de Felipe, Lund Anita Thomas, Lund Verner Egerland, Lund Paul Touati, Lund Henrietta Godolakis-Carolsson, Mario Vargas Llosa, Madrid Lund Victor Wahlström, Lund Jonas Grandfeldt, Lund Eva Wiberg, Lund Riccardo Guglielmi, Lund Petronella Zetterlund, Lund Sandra Håkansson, Lund Malin Ågren, Lund Revista Hispanista Escandinava, vol.4, 2015 INGER ENKVIST 1986 Ph. D. por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, con la tesis Las técnicas narrativas de Mario Vargas Llosa. 2001 Catedrática de español en la Universidad de Lund 2002-2006 Miembro del Consejo Sueco de Educación Superior. 2007 Miembro de la Academia Argentina de las Ciencias Políticas y Morales. 2008 Condecoración española al mérito civil. 2011 Miembro del Consejo Académico de la Cátedra Vargas Llosa, una organización dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. -

From Comparative Literature to the Study of Mediators
From comparative literature to the study of mediators MICKAËLLE CEDERGREN CECILIA SCHWARTZ Stockholm University To take an active interest in literary mediators means to assume the ongoing dynamics and transformations in the circulation of cultural and literary property, as well as the existence of different national literatures. In the beginning of the Romantic era, the perception of cultural diversity came into play and engendered the discipline of comparative literature studies, which aspires to study the relationships uniting two or more literatures. We owe this perspective in part to Mme de Staël and her work De l’Allemagne (1810), where the ancient method of rhetoric, the one called parallelism, came into force. It is within this “openness to the other”, as defined by Brunel and Chevrel when speaking of the comparative approach (1989: 7), that we are invited to discover foreign literature and cultures, and where the contacts and exchanges between cultures, in an attempt to reconstruct cultural history, are studied and recounted. It is at the heart of this project of cultural history that the presence of intermediaries comes into play, brokers of ideas, or what we today call ferrymen of culture (“passeurs de culture”) and actors of mediation. It is also, within the studies of inter- culturalism that Pageaux proposes to study “the description of the mechanisms of contacts and meetings, the relations between literatures and cultures” (Pageaux 2007: 168). These mediators are present at different moments of the circulation of literary goods. They may be located downstream, at the level of the production chain, but also upstream, at the level of the reception chain. -

Danius Och Engdahl Ur En Journalists Gestaltning
Akademiskandalen- Danius och Engdahl ur en journalists gestaltning En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Sara Danius och Horace Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien The Academy scandal- Danius and Engdahl through the framing of a journalist A quantitative study on the Swedish media framing regarding Sara Danius and Horace Engdahl in the Swedish Academy scandal Clara Reijers och Natalie Chehadé Medie- och kommunikationsvetenskap Kommunikation och PR 15 Hp Handledare Examinator: Johan Lindell Datum: 2020-01-15 Löpnummer Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön. Studiens fokus ligger i att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i krisen kring den Svenska Akademien, för att kunna jämföra svenska mediers rapportering av en kulturskandal, där både en kvinna och en man är inblandad. Det material som undersökts i studien är nyhetsartiklar från de sex största morgon- och kvällstidningarna i Sverige – Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan – vilka analyserats genom en kvantitativ innehållsanalys. Det teoretiska ramverk studien utgår från och som kan ge en förståelse för hur media gestaltar en skandal är; gestaltningsteori, medielogik, tonalitet och teorier om genus. Förutom dessa teorier har vi använt oss av relevant tidigare forskning inom skandaljournalistik och genus som indikerar att kvinnor och män gestaltas olika i media, inom politiska skandaler. Det blir därav intressant att undersöka om det även gäller en kulturell skandal samt om journalistens kön kan ha en betydelse för gestaltningen. Journalisters roll i rapporteringen och gestaltningen av skandalen är viktig, eftersom de har ett ansvar att vara objektiva samt att framställa de båda könen på ett likvärdigt sätt. -

Böcker Från Svenska Akademien 2021 Om Svenska Akademiens Bokutgivning
Böcker från Svenska Akademien 2021 Om Svenska Akademiens bokutgivning Svenska Akademien bedriver en omfattande bokutgivning inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur. Utgivningen sker i samarbete med Norstedts förlag och Bokförlaget Atlantis med undantag av några titlar varav flertalet utges i form av behovstryck (»print on demand«). Den språkliga utgivningen innefattar bl.a. standardverk som Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens grammatik. För främjande av svensk litteratur utger Svenska Akademien serien Svenska klassiker. En annan viktig del av utgivningen på det litterära området gäller Nobelpriset i litteratur. Hit hör även böcker om Nobelbiblioteket och böcker utgivna av Nobelbiblioteket. Akademien dokumenterar den egna verksamheten i serien Svenska Akademiens handlingar. I handlingarna ingår också de minnesteckningar som Akademien utger över bemärkta svenskar. I serien Minnesbiblioteket utges ett urval biografiska och historiska texter som tidigare publicerats i handlingarna. Ett flertal böcker är avsedda att tillgodose omvärldens behov av information om Akademien själv, dess verksamhet och historia. I utgivningen ingår också enstaka publikationer som mer indirekt har samband med Akademien och dess verksamhet. De presenteras under rubriken »Övrig utgivning«. Några av Akademiens böcker finns även utgivna på andra språk, främst engelska. * I denna katalog presenteras samtliga under året tillgängliga titlar som utgivits av Svenska Akademien. De kan köpas i eller beställas genom bokhandeln. För en mer fullständig förteckning, som även inkluderar äldre titlar vilka inte längre finns i handeln, hänvisas till Akademiens webbplats svenskaakademien.se. nyheter nyh nyheter 2021 4 Nyheter 2021 GUSTAF III Dramatik och vältalighet (i serien Svenska klassiker) Gustaf III (1746–92) är i det moderna medvetandet framför allt konstgynnaren och stilskaparen, vars inflytande gjorde sig gällande på alla områden av den svenska kulturen. -

El Premio Nobel De Literatura Y La Búsqueda Del Ideal Literario En Las Trece Mujeres Elegidas
UNIVERSIDAD DE MONTERREY División de Educación y Humanidades Departamento de Humanidades Maestría en Humanidades El Premio Nobel de Literatura y la búsqueda del ideal literario en las trece mujeres elegidas Autor 56149 Raquel Paulina Cevada Álvarez Asesor Dr. Alexander Havemeyer Catlin San Pedro Garza García, N.L. 10 de diciembre, 2014 2 Un eterno agradecimiento a mi padre, por ser mi fuente de inspiración, mi motivación, y mi ejemplo a seguir. Toda mi admiración y el más profundo agradecimiento a mi madre, por su paciencia, su amor, y su apoyo incondicional. Ambos son la fortaleza y la luz que continua iluminando mi camino. Gracias por todo. 3 Índice Introducción. 5 Capítulo 1. Alfred Nobel. 6 Biografía. 6 El Testamento y la Fundación Nobel. 12 El Premio Nobel. 19 Ceremonia y Reconocimientos. 20 Capitulo 2. El Premio Nobel de Literatura. 25 Talento y Gusto: La Academia Sueca. 25 Premio Nobel de Literatura. 29 Kjell Espmark: revelando la misión. 35 Capítulo 3. La búsqueda del “ideal” literario. 38 El “ideal” de Alfred Nobel. 38 El “ideal” de la Academia Sueca. 42 Capítulo 4. La mujer en la Literatura. 55 Un breve recuento. 55 El “ideal” representado en las trece elegidas. 62 4 Capítulo 5. Las idealistas. 68 Capítulo 6. El ideal multicultural. 83 Capítulo 7. Las administradoras del legado. 96 La experiencia femenina. 96 La otra experiencia femenina. 109 Capítulo 8. La maestra Munro. 117 Capitulo 9. La gran apuesta. 126 De Alfred Nobel y la Academia Sueca. 126 De la mujer. 131 De la industria. 135 Conclusiones. 139 Bibliografía. 142 5 Introducción El Premio Nobel de Literatura es entregado cada año ante la expectativa mundial. -

Litteraturbanken
ride. A review journal for digital editions and resources published by the IDE Litteraturbanken Litteraturbanken, Mats Malm, Cai Alfredson, Dick Claésson, Paulina Helgesson, Anja Hellström, Carl-Johan Lind, Ellen Mattson, Ljubica Miočević, Therese Röök, Ilaria Tedde (ed.), 2004ff.. http:// litteraturbanken.se (Last Accessed: 27.07.2017). Reviewed by Mats Dahlström (University of Borås), mats.dahlstrom (at) hb.se and Wout Dillen (University of Antwerp), wout.dillen (at) uantwerpen.be. Abstract Litteraturbanken (The Swedish Literature Bank) is a freely available digital collection of Swedish literary works, ranging from medieval to contemporary literature. It is the result of a cooperation between literary and linguistic scholars, research libraries, and editorial societies and academies. The collection consists not only of digital facsimiles, but of ocr'ed, proof-checked and TEI-encoded transcriptions as well, including EPUB and HTML versions of texts, and in addition scholarly presentations and didactic introductions to works and authors in the collection. It is also being used as a publishing platform for ongoing Swedish scholarly editing projects. Litteraturbanken currently comprises more than 2.000 works, mounting up to more than 100 million of machine-readable words. Litteraturbanken's main weak spot is transparency; it does not openly provide satisfactory ways to ensure the editors accountability for the edited texts and images. As a whole, however, Litteraturbanken is an impressive endeavour and paves the way for fruitful cooperation and massive data exchange with e.g. computational linguistics and bibliographic databases. 1 This review evaluates Litteraturbanken (in English: the Swedish Literature Bank; http://litteraturbanken.se) – a digital text collection of Swedish literary works.1 The review Dahlström, Mats and Wout Dillen.