Albers Mysticeti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

JVP 26(3) September 2006—ABSTRACTS
Neoceti Symposium, Saturday 8:45 acid-prepared osteolepiforms Medoevia and Gogonasus has offered strong support for BODY SIZE AND CRYPTIC TROPHIC SEPARATION OF GENERALIZED Jarvik’s interpretation, but Eusthenopteron itself has not been reexamined in detail. PIERCE-FEEDING CETACEANS: THE ROLE OF FEEDING DIVERSITY DUR- Uncertainty has persisted about the relationship between the large endoskeletal “fenestra ING THE RISE OF THE NEOCETI endochoanalis” and the apparently much smaller choana, and about the occlusion of upper ADAM, Peter, Univ. of California, Los Angeles, Los Angeles, CA; JETT, Kristin, Univ. of and lower jaw fangs relative to the choana. California, Davis, Davis, CA; OLSON, Joshua, Univ. of California, Los Angeles, Los A CT scan investigation of a large skull of Eusthenopteron, carried out in collaboration Angeles, CA with University of Texas and Parc de Miguasha, offers an opportunity to image and digital- Marine mammals with homodont dentition and relatively little specialization of the feeding ly “dissect” a complete three-dimensional snout region. We find that a choana is indeed apparatus are often categorized as generalist eaters of squid and fish. However, analyses of present, somewhat narrower but otherwise similar to that described by Jarvik. It does not many modern ecosystems reveal the importance of body size in determining trophic parti- receive the anterior coronoid fang, which bites mesial to the edge of the dermopalatine and tioning and diversity among predators. We established relationships between body sizes of is received by a pit in that bone. The fenestra endochoanalis is partly floored by the vomer extant cetaceans and their prey in order to infer prey size and potential trophic separation of and the dermopalatine, restricting the choana to the lateral part of the fenestra. -

Catalogue Palaeontology Vertebrates (Updated July 2020)
Hermann L. Strack Livres Anciens - Antiquarian Bookdealer - Antiquariaat Histoire Naturelle - Sciences - Médecine - Voyages Sciences - Natural History - Medicine - Travel Wetenschappen - Natuurlijke Historie - Medisch - Reizen Porzh Hervé - 22780 Loguivy Plougras - Bretagne - France Tel.: +33-(0)679439230 - email: [email protected] site: www.strackbooks.nl Dear friends and customers, I am pleased to present my new catalogue. Most of my book stock contains many rare and seldom offered items. I hope you will find something of interest in this catalogue, otherwise I am in the position to search any book you find difficult to obtain. Please send me your want list. I am always interested in buying books, journals or even whole libraries on all fields of science (zoology, botany, geology, medicine, archaeology, physics etc.). Please offer me your duplicates. Terms of sale and delivery: We accept orders by mail, telephone or e-mail. All items are offered subject to prior sale. Please do not forget to mention the unique item number when ordering books. Prices are in Euro. Postage, handling and bank costs are charged extra. Books are sent by surface mail (unless we are instructed otherwise) upon receipt of payment. Confirmed orders are reserved for 30 days. If payment is not received within that period, we are in liberty to sell those items to other customers. Return policy: Books may be returned within 14 days, provided we are notified in advance and that the books are well packed and still in good condition. Catalogue Palaeontology Vertebrates (Updated July 2020) Archaeology AE11189 ROSSI, M.S. DE, 1867. € 80,00 Rapporto sugli studi e sulle scoperte paleoetnologiche nel bacino della campagna romana del Cav. -

Brochure 130104
GEOLOGICA BELGICA (2004) 7/1-2: 27-39 GEOLOGY AND PALAEONTOLOGY OF A TEMPORARY EXPOSURE OF THE LATE MIOCENE DEURNE SAND MEMBER IN ANTWERPEN (N. BELGIUM) Mark BOSSELAERS1, Jacques HERMAN2, Kristiaan HOEDEMAKERS3, Olivier LAMBERT4,*, Robert MARQUET4 & Karel WOUTERS5,6 (9 figures, 2 tables) 1. Lode Van Berckenlaan, 90, B-2600 Berchem, Antwerpen, Belgium. E-mail: [email protected] 2. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Geological Survey of Belgium, rue Jenner, 13, B-1000 Brussels, Belgium 3. Minervastraat 23, B-2640 Mortsel, Belgium 4. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Department of Palaeontology, rue Vautier, 29, B-1000 Brussels, Belgium 5. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Department of Invertebrates, id. 6. K.U.Leuven, Department of Biology, Laboratory of Comparative anatomy and Biodiversity, De Bériotstraat 32, B-3000 Leuven, Belgium * F.R.I.A Doctoral fellow ABSTRACT. A section of 6.10 m through the Deurne Sand Member (Diest Formation, Late Miocene) in Antwerpen (Antwerp) is described, which has been observed during the construction works of a new hospital building in the southern part of Deurne, and here called “Middelares Hospital Section” after that location. This temporary outcrop section can well be correlated with a similar one which was outcropping some 35 years ago, and was located at some 1.5 km to the NE. It was studied in detail by De Meuter et al. (1967), who called it the “Borgerhout-Rivierenhof VII B.R.” section. Since that section was the most relevant of the previously described sections in the Deurne Sand Member, it is here suggested to designate that section as stratotype for the member. -

Stratigraphy of an Early–Middle Miocene Sequence Near Antwerp in Northern Belgium (Southern North Sea Basin)
GEOLOGICA BELGICA (2010) 13/3: 269-284 STRATIGRAPHY OF AN EARLY–MIDDLE MIOCENE SEQUENCE NEAR ANTWERP IN NORTHERN BELGIUM (SOUTHERN NORTH SEA BASIN) Stephen LOUWYE1, Robert MARQUET2, Mark BOSSELAERS3 & Olivier LAMBERT4† (5 figures, 2 tables & 3 plates) 1Research Unit Palaeontology, Ghent University, Krijgslaan 281/S8, 9000 Gent, Belgium. E-mail: [email protected] 2Palaeontology Department, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Vautierstraat 29, 1000 Brussels. E-mail: [email protected] 3Lode Van Berckenlaan 90, 2600 Berchem, Belgium. E-mail: [email protected] 4Département de Paléontologie, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, rue Vautier 29, 1000 Brussels, Belgium. †Present address: Département Histoire de la Terre, Muséum national d’Histoire naturelle, rue Buffon 8, 75005, Paris, France. E-mail: [email protected] ABSTRACT. The lithostratigraphy and biostratigraphy of a temporary outcrop in the Antwerp area is described. The deposits can be attributed to the Kiel Sands and the Antwerpen Sands members, both belonging to the Lower and Middle Miocene Berchem Formation. Invertebrate and vertebrate macrofossils are abundantly present. The molluscan fauna compares well to former findings in the Antwerpen Sands Member. It can be concluded that the studied sequence is continuously present in the Antwerp area, and thickens in a northward direction. The study of the marine mammal fauna shows that eurhinodelphinids are the most common fossil odontocete (toothed-bearing cetaceans) in the Antwerpen Sands Member, associated here with kentriodontine, physeteroid, squalodontid, mysticete (baleen whales) and pinniped (seals) fragmentary remains. Both the molluscan fauna and the organic-walled palynomorphs indicate for the Antwerpen Sands Member deposition in a neritic, energetic environment, which shallowed upwards. -
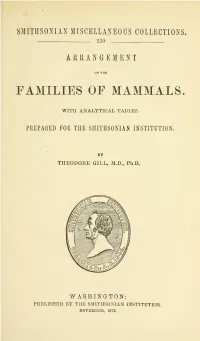
SMC 11 Gill 1.Pdf
SMITHSONIAN MISCELLANEOUS COLLECTIONS. 230 ARRANGEMENT FAMILIES OF MAMMALS. WITH ANALYTICAL TABLES. PREPARED FOR THE SMITHSONIAN INSTITUTION. BY THEODORE GILL, M.D., Ph.D. WASHINGTON: PUBLISHED BY THE SMITHSONIAN INSTITUTION. NOVEMBER, 1872. ADVERTISEMENT. The following list of families of Mammals, with analytical tables, has been prepared by Dr. Theodore Gill, at the request of the Smithsonian Institution, to serve as a basis for the arrangement of the collection of Mammals in the National Museum ; and as frequent applications for such a list have been received by the Institution, it has been thought advisable to publish it for more extended use. In provisionally adopting this system for the purpose mentioned, the Institution, in accordance with its custom, disclaims all responsibility for any of the hypothetical views upon which it may be based. JOSEPH HENRY, Secretary, S. I. Smithsonian Institution, Washington, October, 1872. (iii) CONTENTS. I. List of Families* (including references to synoptical tables) 1-27 Sub-Class (Eutheria) Placentalia s. Monodelpbia (1-121) 1, Super-Order Educabilia (1-73) Order 1. Primates (1-8) Sub-Order Anthropoidea (1-5) " Prosimiae (6-8) Order 2. Ferae (9-27) Sub-Order Fissipedia (9-24) . " Pinnipedia (25-27) Order 3. Ungulata (28-54) Sub-Order Artiodactyli (28-45) " Perissodactyli (46-54) Order 4. Toxodontia (55-56) . Order 5. Hyracoidea (57) Order 6. Proboscidea (58-59) Diverging (Educabilian) series. Order 7. Sirenia' (60-63) Order 8. Cete (64-73) . Sub-Order Zeuglodontia (64-65) " Denticete (66-71) . Mysticete (72-73) . Super-Order Ineducabilia (74-121) Order 9. Chiroptera (74-82) . Sub-Order Aniinalivora (74-81) " Frugivora (82) Order 10. -

Miocene Leatherback Turtle Material of the Genus Psephophorus (Testudines: Dermochelyoidea) from the Gram Formation (Denmark)
ISSN: 0211-8327 Studia Palaeocheloniologica IV: pp. 205-216 MIOCENE LEATHERBACK TURTLE MATERIAL OF THE GENUS PSEPHOPHORUS (TESTUDINES: DERMOCHELYOIDEA) FROM THE GRAM FORMATION (DENMARK) [Tortugas de cuero miocénicas del género Psephophorus (Testudines: Dermochelyoidea) de la Formación Gram (Dinamarca)] Hans-Volker KARL 1,2, Bent E. K. LINDOW 3 & Thomas TÜT K EN 4 1 Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA). Humboldtstr. 11. D-99423, Weimar, Germany. Email: [email protected] 2c\o Geobiology, Center of Earth Sciences at the University of Göttingen. Goldschmidtstraße 3. DE-37077 Göttingen, Germany 3 Natural History Museum of Denmark. University of Copenhagen. Øster Voldgade 5-7. DK-1350 Copenhagen K, Denmark. Email: [email protected] 4 Emmy Noether-Gruppe “Knochengeochemie”. Steinmann Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Arbeitsbereich Mineralogie-Petrologie. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Poppelsdorfer Schloß. 53115 Bonn, Germany. (FECHA DE RECEPCIÓN: 2011-01-12) BIBLID [0211-8327 (2012) Vol. espec. 9; 205-216] ABSTRACT: Several specimens of fossil leatherback turtle from the upper Miocene (Tortonian) Gram Formation are described and illustrated scientifically for the first time. The specimens are all referred to the taxon Psephophorus polygonus and constitute the northernmost occurrence of this taxon in the geological record. Additionally, they indicate that leatherback turtles were a common constituent of the marine fauna of the Late Miocene North Sea Basin. Key words: Testudines, Psephophorus, Miocene, Gram Formation, Denmark. RESUMEN: Se describen y figuran por primera vez algunos ejemplares de tortugas de cuero fósiles del Mioceno superior (Tortoniense) de la Formación Gram, en © Ediciones Universidad de Salamanca Studia Palaeocheloniologica IV (Stud. Geol. Salmant. -

The Upper Miocene Deurne Member of the Diest
GEOLOGICA BELGICA (2020) 23/3-4: 219-252 The upper Miocene Deurne Member of the Diest Formation revisited: unexpected results from the study of a large temporary outcrop near Antwerp International Airport, Belgium Stijn GOOLAERTS1,*, Jef DE CEUSTER2, Frederik H. MOLLEN3, Bert GIJSEN3, Mark BOSSELAERS1, Olivier LAMBERT1, Alfred UCHMAN4, Michiel VAN HERCK5, Rieko ADRIAENS6, Rik HOUTHUYS7, Stephen LOUWYE8, Yaana BRUNEEL5, Jan ELSEN5 & Kristiaan HOEDEMAKERS1 1 OD Earth & History of Life, Scientific Heritage Service and OD Natural Environment, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgium; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]. 2 Veldstraat 42, 2160 Wommelgem, Belgium; [email protected]. 3 Elasmobranch Research Belgium, Rehaegenstraat 4, 2820 Bonheiden, Belgium; [email protected]; [email protected]. 4 Faculty of Geography and Geology, Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, Poland; [email protected]. 5 Department of Earth & Environmental Sciences, KU Leuven, Belgium; [email protected]; [email protected]; [email protected]. 6 Q Mineral, Heverlee, Belgium; [email protected]. 7 Independent consultant, Halle, Belgium; [email protected]. 8 Department of Geology, Campus Sterre, S8, Krijgslaan 281, 9000 Gent, Belgium; [email protected]. * corresponding author. ABSTRACT. A 5.50 m thick interval of fossiliferous intensely bioturbated -

The Taxonomic and Evolutionary History of Fossil and Modern Balaenopteroid Mysticetes
Journal of Mammalian Evolution, Vol. 12, Nos. 1/2, June 2005 (C 2005) DOI: 10.1007/s10914-005-6944-3 The Taxonomic and Evolutionary History of Fossil and Modern Balaenopteroid Mysticetes Thomas A. Demer´ e,´ 1,4 Annalisa Berta,2 and Michael R. McGowen2,3 Balaenopteroids (Balaenopteridae + Eschrichtiidae) are a diverse lineage of living mysticetes, with seven to ten species divided between three genera (Megaptera, Balaenoptera and Eschrichtius). Extant members of the Balaenopteridae (Balaenoptera and Megaptera) are characterized by their engulfment feeding behavior, which is associated with a number of unique cranial, mandibular, and soft anatomical characters. The Eschrichtiidae employ suction feeding, which is associated with arched rostra and short, coarse baleen. The recognition of these and other characters in fossil balaenopteroids, when viewed in a phylogenetic framework, provides a means for assessing the evolutionary history of this clade, including its origin and diversification. The earliest fossil balaenopterids include incomplete crania from the early late Miocene (7–10 Ma) of the North Pacific Ocean Basin. Our preliminary phylogenetic results indicate that the basal taxon, “Megaptera” miocaena should be reassigned to a new genus based on its possession of primitive and derived characters. The late late Miocene (5–7 Ma) balaenopterid record, except for Parabalaenoptera baulinensis and Balaenoptera siberi, is largely undescribed and consists of fossil specimens from the North and South Pacific and North Atlantic Ocean basins. The Pliocene record (2–5 Ma) is very diverse and consists of numerous named, but problematic, taxa from Italy and Belgium, as well as unnamed taxa from the North and South Pacific and eastern North Atlantic Ocean basins. -

The Biology of Marine Mammals
Romero, A. 2009. The Biology of Marine Mammals. The Biology of Marine Mammals Aldemaro Romero, Ph.D. Arkansas State University Jonesboro, AR 2009 2 INTRODUCTION Dear students, 3 Chapter 1 Introduction to Marine Mammals 1.1. Overture Humans have always been fascinated with marine mammals. These creatures have been the basis of mythical tales since Antiquity. For centuries naturalists classified them as fish. Today they are symbols of the environmental movement as well as the source of heated controversies: whether we are dealing with the clubbing pub seals in the Arctic or whaling by industrialized nations, marine mammals continue to be a hot issue in science, politics, economics, and ethics. But if we want to better understand these issues, we need to learn more about marine mammal biology. The problem is that, despite increased research efforts, only in the last two decades we have made significant progress in learning about these creatures. And yet, that knowledge is largely limited to a handful of species because they are either relatively easy to observe in nature or because they can be studied in captivity. Still, because of television documentaries, ‘coffee-table’ books, displays in many aquaria around the world, and a growing whale and dolphin watching industry, people believe that they have a certain familiarity with many species of marine mammals (for more on the relationship between humans and marine mammals such as whales, see Ellis 1991, Forestell 2002). As late as 2002, a new species of beaked whale was being reported (Delbout et al. 2002), in 2003 a new species of baleen whale was described (Wada et al. -

Arrangement of the Families of Mammals. with Analytical Tables. Prepared for the Smithsonian Institution
a 1, LiBRAsy f-'i COLLECTIONS. SMITHSONIAN MISCELLANEOUS 230 • ARRANGE M E N T (.F THE FAMILIES OF MAMMALS WITH ANALYTICAL TABI.KS. INSTITUTION. PRliPAKED FOR THE SMITHSONIAN BY THEODORE GILL, M.D., Ph.D. t WASHINGTON: INSTITUTION. FUBLIBHED BY THE SMITHSONIAN NOVEMBER, 1872. ' J-B-V- ^ 70S ^ Ji'rrrr.. SMITHSONIAN MISCELLANEOUS COLLECTIONS. 230 ARRANGEMENT FAMILIES OF MAMMALS. WITH ANALYTICAL TABLES. PREPARED FOR THE SMITHSONIAN INSTITUTION. BY THEODORE GILL, M.D., Ph.D. WASHINGTON: PUBLISHED BY THE SMITHSONIAN INSTITUTION. NOVEMBER. 1872. VA-Q-Y^VA-^V' ADVERTISEMExNT. The following list of families of Mammals, with analytical tables, has been prepared by Dr. Theodore Gill, at the request of the Smithsonian Institution, to serve as a basis for the arrangement of the collection of Mammals in the National Museum ; and as frequent applications for such a list have been received by the Institution, it has been thought advisable to publish it for more extended use. In provisionally adopting this system for the purpose mentioned, the Institution, in accordance with its custom, disclaims all responsibility for any of the hypothetical views upon which it may be based. JOSEPH HENRY, Secretary, S. I. Smithsonian iNSTiTrrioif, Washington, October, 1872. (iii) CONTENTS. I. List op Families* (including references to synoptical tables) 1-27 Sub-Class (Eutheria) Placentalia s. Monodelphia (1-121) 1, Super-Order Educabilia (1-73) Order 1. Primates (1-8) Sub-Order Antliropoidea (1-5) " Prosimise (6-8) Order 2. Ferae (9-27) Sub-Order Fissipedia (9-24) . " Pinnipedia (25-27) Order 3. Ungulata (28-54) . Sub-Order Artiodactyli (28-45) " Perissodactyli (46-54) Order 4. -

Early Evolution of Whales
Early Evolution of Whales A Century of Research in Egypt Philip D. Gingerich Introduction Living whales are fully aquatic and belong to two suborders of Cetacea: Mysticeti (baleen whales) and Odontoceti (toothed whales). Both of these modern suborders appeared when Earth changed from a ‘greenhouse’ earth to an ‘icehouse’ earth at in about the beginning of the Oligocene epoch (Zachos et al., 2001). Early whales, from the ‘greenhouse’ Eocene, all belong to a distinct paraphyletic suborder Archaeoceti. Archaeocetes differ from later modern whales in retaining many characteristics of land mammals, including complexly occluding cheek teeth, ear bones well integrated with the rest of the cranium, longer necks, less specialized forelimb flippers, and hind limbs with feet and toes. Archaeocetes are, in essence, the transitional forms documenting the origin of whales from an earlier land-mammal ancestry (Gingerich, 2005). The first archaeocete fossil to be studied scientifically was a very large vertebral centrum collected in 1832 near the Ouachita River in Caldwell Parish, Louisiana. This measured some 35 cm in length and was but one of a series of 28 vertebrae found together there. The animal represented was named Basilosaurus or ‘king lizard’ because of its size and presumed reptilian heritage (Harlan, 1834). At the time the British anatomist Richard Owen was busy studying the large reptiles he eventually called dinosaurs. To solve the mystery of Basilosaurus, Owen secured additional remains and showed that it was a mammal because its cheek teeth are double-rooted. Owen (1839) deemed the name Basilosaurus to be inappropriate and proposed Zeuglodon or ‘yoked teeth’ as a replacement name. -

Fragilicetus Velponi: a New Mysticete Genus and Species and Its Implications for the Origin of Balaenopteridae (Mammalia, Cetacea, Mysticeti)
Zoological Journal of the Linnean Society, 2016, 177, 450–474. With 14 figures Fragilicetus velponi: a new mysticete genus and species and its implications for the origin of Balaenopteridae (Mammalia, Cetacea, Mysticeti) MICHELANGELO BISCONTI1* and MARK BOSSELAERS2 1San Diego Natural History Museum, 1788 El Prado, California 92101, USA 2Royal Belgian Institute of Natural Sciences, 29 Vautierstraat, 1000, Brussels, Belgium Received 15 February 2015 revised 2 October 2015 accepted for publication 21 October 2015 A new extinct genus, Fragilicetus gen. nov., is described here based on a partial skull of a baleen-bearing whale from the Early Pliocene of the North Sea. Its type species is Fragilicetus velponi sp. nov. This new whale shows a mix of morphological characters that is intermediate between those of Eschrichtiidae and those of Balaenopteridae. A phylogenetic analysis supported this view and provided insights into some of the morphological transforma- tions that occurred in the process leading to the origin of Balaenopteridae. Balaenopterid whales show special- ized feeding behaviour that allows them to catch enormous amounts of prey. This behaviour is possible because of the presence of specialized anatomical features in the supraorbital process of the frontal, temporal fossa, glenoid fossa of the squamosal, and dentary. Fragilicetus velponi gen. et sp. nov. shares the shape of the supraorbital process of the frontal and significant details of the temporal fossa with Balaenopteridae but maintains an eschrichtiid- and cetotheriid-like squamosal bulge and posteriorly protruded exoccipital. The character combination exhibited by this cetacean provides important information about the assembly of the specialized morphological features re- sponsible for the highly efficient prey capture mechanics of Balaenopteridae.