Stockhausen Unterwegs Zu Wagner
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Shiraz for Piano Solo by Claude Vivier: an Analysis for the Performer
SHIRAZ FOR PIANO SOLO BY CLAUDE VIVIER: AN ANALYSIS FOR THE PERFORMER by DAVID BERGERON Bmus, McGill University, 1999 Mmus, McGill University, 2001 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULLFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MUSICAL ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (Music) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (Vancouver) August 2010 © David Bergeron, 2010 Abstract Claude Vivier wrote Shiraz in 1977, after returning from a trip to Bali and Iran. Linked to the compositional style of his mentors Gilles Tremblay and Karlheinz Stockhausen, Shiraz is the embryo of what would become Vivier’s own mature compositional and expressive language. Its scope and its importance in Vivier’s catalogue make it an essential subject for an exploration of Vivier’s compositional techniques. This thesis aims not only to give a broad sense of Vivier’s musical language, but also to communicate specific insights relevant to pianists who wish to understand better the subtleties of this particular composition. An investigation of selected works written by Vivier in 1975, a comparison with Schumann’s Toccata opus 7, and a consideration of influences from Stockhausen and Messiaen form the background for a thorough analysis of the piece (including its form, pitch structure, and rhythmic techniques). Problems of memorization and fingering are also discussed. The thesis can help the performer who wishes to add Shiraz to his or her repertoire, to understand and successfully prepare the work for performance and interpretation. ii Table of Contents Abstract…………………………………………………………………………… ii Table of Contents………………………………………………………………… iii List of Tables……………………………………………………………………...iv List of Examples…………………………………………………………………...v Acknowledgments………………………………………………………………. vii Dedication………………………………………………………………………. -

Karlheinz Stockhausen: Works for Ensemble English
composed 137 works for ensemble (2 players or more) from 1950 to 2007. SCORES , compact discs, books , posters, videos, music boxes may be ordered directly from the Stockhausen-Verlag . A complete list of Stockhausen ’s works and CDs is available free of charge from the Stockhausen-Verlag , Kettenberg 15, 51515 Kürten, Germany (Fax: +49 [0 ] 2268-1813; e-mail [email protected]) www.stockhausen.org Karlheinz Stockhausen Works for ensemble (2 players or more) (Among these works for more than 18 players which are usu al ly not per formed by orches tras, but rath er by cham ber ensem bles such as the Lon don Sin fo niet ta , the Ensem ble Inter con tem po rain , the Asko Ensem ble , or Ensem ble Mod ern .) All works which were composed until 1969 (work numbers ¿ to 29) are pub lished by Uni ver sal Edi tion in Vien na, with the excep tion of ETUDE, Elec tron ic STUD IES I and II, GESANG DER JÜNGLINGE , KON TAKTE, MOMENTE, and HYM NEN , which are pub lished since 1993 by the Stock hau sen -Ver lag , and the renewed compositions 3x REFRAIN 2000, MIXTURE 2003, STOP and START. Start ing with work num ber 30, all com po si tions are pub lished by the Stock hau sen -Ver lag , Ket ten berg 15, 51515 Kürten, Ger ma ny, and may be ordered di rect ly. [9 ’21”] = dura tion of 9 min utes and 21 sec onds (dura tions with min utes and sec onds: CD dura tions of the Com plete Edi tion ). -

Stockhausen Concerts and Classes for Clarinettists and Others. Clarinettists Have Reason to Be Very Happy with the Development
Stockhausen concerts and classes for clarinettists and others. Clarinettists have reason to be very happy with the development of their repertoire in de 20th century, as it had a previously unseen growth. One of the main figures of post war new music has been Karlheinz Stockhausen (1928-2007). This often controversial composer has enriched clarinet literature with an unprecedented number of works for clarinet, bassethorn and bass clarinet, especially after 1974. These sometimes demanding pieces, often with theatrical elements, require a specific approach and way of playing, easily underestimated. Stockhausen was well aware of this and started coaching a new generation of players in the 1980’s, in order to pass this tradition of interpretation on to others. In spite of Stockhausen’s compositions having the reputation of being difficult and intellectual (if not quasi-religious), to play, watch and listen to them is generally great fun, and very satisfying to work on - if done well. Because the music calls on many apects of performing (e.g. fysical and mental attitude on stage, memory, presentation, awareness of the structure of the music, disciplin) the leaning process has a beneficial influence on performing traditional music too. This series of concerts and courses offers the possibility to watch, listen, study and rehearse a number of Stockhausen’s works with Michel Marang, a clarinettist who worked with the composer since 1986 and performed his music hundreds of times worldwide. The course can have the character of an introductory lecture and concert, but eventually may result in seminars over a longer stretch of time, as much as needed to bring specific works on concert level. -

Jubiläen: Xenakis 2022 | Strawinsky 2021 Thema
NR. 86 FRÜHJAHR 2020 WWW.BOOSEY.DE RELAUNCH: Besuchen Sie JUBILÄEN: unseren YouTube-Kanal Xenakis 2022 | Strawinsky 2021 youtube.com/BooseyTube THEMA: KOMPONISTINNEN Mehr auf Seite 12 in Gegenwart und Vergangenheit hier im Heft EIN VOrwOrt IN KRISENZEITEN Als das vorliegende Heft konzipiert, die Arbeit daran be- gonnen wurde, war das alles so nicht vorauszusehen. Wir Liebe Leserin, lieber Leser, haben intensiv darüber nachgedacht, ob ein solches Maga- zin aktuell versandt werden sollte. Wie ersichtlich, lautete diese Wochen stellen einen Einschnitt dar, den niemand die Antwort, die wir uns gaben: Ja! Die durch das Corona- von uns vergessen wird. Wie so viele andere Lebensbereiche Virus ausgelöste Krankheit wird bezwungen werden, und wurde der internationale Musikbetrieb durch die Corona- unser Musikleben wird wieder erwachen, so wie wir es Pandemie im Innersten verwundet. Das, was unser Dasein kennen und lieben. Insofern ist dieses Heft auch ein Aus- ausmacht, kann plötzlich nicht mehr stattfinden: die Live- druck der Hoffnung, miteinander weiter Pläne zu schmieden, Darbietung vor Publikum und der persönliche Austausch Entdeckungen zu machen und die Musik in die Zukunft zu über Musik. Aufführungen mussten abgesagt werden; tragen. Es kann sein, dass zwischen Drucklegung von Heft Projekte, auf die wir lange hingearbeitet haben, wurden samt Beilagen und Ihrer Lektüre einzelne Ereignisse und vom Virus durchkreuzt. Ganz zu schweigen davon, dass Termine hinfällig geworden sind – vorläufig. so manche/r sich der Erfahrung von Krankheit und Verlust gegenübersieht. Viele Menschen und Institu tionen erleiden Wir bitten um Nachsicht, wünschen trotz allem eine gute immense Einbußen, Existenzen stehen auf dem Spiel, und Lektüre und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit die wirtschaftlichen Folgen sind nicht absehbar. -

Darryl White CV.Pdf
Dr. Darryl A. White University of Nebraska-Lincoln 7932 Bancroft Ave. School of Music Lincoln, NE 68506 226 Westbrook Music Building (402)4899402 Lincoln, NE 68588-0100 (402)4722988 Current Position: Associate Professor of Trumpet University of Nebraska-Lincoln, 1997-present Duties: Recruit and teach applied trumpet students at the undergraduate and graduate levels, coach student chamber ensembles, teach brass skills, and other related courses, perform in the Faculty Jazz Quartet, perform in the Faculty Brass Quintet Education: Doctoral of Musical Arts, 2001 University of Colorado Boulder, Colorado Full Tuition Minority Fellowship Recipient Master of Music Performance, 1991 Northwestern University Evanston, Illinois Graduate Assistant Bachelor of Music, 1987 Youngstown State University Youngstown, Ohio Full Tuition Luley Scholarship Recipient Teaching Previous Sabbatical Replacement, Spring of 1996 Appointments: University of Colorado Boulder, Colorado -Applied Trumpet -Weekly Master Classes Instructor of Trumpet, 1995-1997 University of Denver, Lamont School of Music Denver, Colorado -Applied Trumpet, undergraduate and graduate -Brass Pedagogy -Brass Performance Class -Aries Quintet in Residency -Faculty Jazz Quintet Clinician and Lecturer, 1994-2002 Mile High Jazz Festival Boulder, Colorado -Daily Master Classes -Daily Performances -Conducting Big Band and Small Group Instructor of Trumpet, 1993-1994 Mesa State College Grand Junction, Colorado -Applied Trumpet -Brass Pedagogy -History of American Popular Music -Music Appreciation -Jazz -

A Symphonic Poem on Dante's Inferno and a Study on Karlheinz Stockhausen and His Effect on the Trumpet
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2008 A Symphonic Poem on Dante's Inferno and a study on Karlheinz Stockhausen and his effect on the trumpet Michael Joseph Berthelot Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Music Commons Recommended Citation Berthelot, Michael Joseph, "A Symphonic Poem on Dante's Inferno and a study on Karlheinz Stockhausen and his effect on the trumpet" (2008). LSU Doctoral Dissertations. 3187. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3187 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. A SYMPHONIC POEM ON DANTE’S INFERNO AND A STUDY ON KARLHEINZ STOCKHAUSEN AND HIS EFFECT ON THE TRUMPET A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agriculture and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The School of Music by Michael J Berthelot B.M., Louisiana State University, 2000 M.M., Louisiana State University, 2006 December 2008 Jackie ii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank Dinos Constantinides most of all, because it was his constant support that made this dissertation possible. His patience in guiding me through this entire process was remarkable. It was Dr. Constantinides that taught great things to me about composition, music, and life. -

The Composer's Guide to the Tuba
THE COMPOSER’S GUIDE TO THE TUBA: CREATING A NEW RESOURCE ON THE CAPABILITIES OF THE TUBA FAMILY Aaron Michael Hynds A Dissertation Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS August 2019 Committee: David Saltzman, Advisor Marco Nardone Graduate Faculty Representative Mikel Kuehn Andrew Pelletier © 2019 Aaron Michael Hynds All Rights Reserved iii ABSTRACT David Saltzman, Advisor The solo repertoire of the tuba and euphonium has grown exponentially since the middle of the 20th century, due in large part to the pioneering work of several artist-performers on those instruments. These performers sought out and collaborated directly with composers, helping to produce works that sensibly and musically used the tuba and euphonium. However, not every composer who wishes to write for the tuba and euphonium has access to world-class tubists and euphonists, and the body of available literature concerning the capabilities of the tuba family is both small in number and lacking in comprehensiveness. This document seeks to remedy this situation by producing a comprehensive and accessible guide on the capabilities of the tuba family. An analysis of the currently-available materials concerning the tuba family will give direction on the structure and content of this new guide, as will the dissemination of a survey to the North American composition community. The end result, the Composer’s Guide to the Tuba, is a practical, accessible, and composer-centric guide to the modern capabilities of the tuba family of instruments. iv To Sara and Dad, who both kept me going with their never-ending love. -
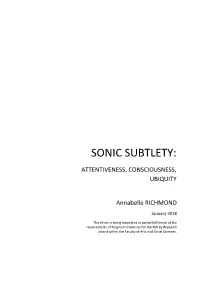
Sonic Subtlety
SONIC SUBTLETY: ATTENTIVENESS, CONSCIOUSNESS, UBIQUITY Annabelle RICHMOND January 2018 This thesis is being submitted in partial fulfilment of the requirements of Kingston University for the MA by Research award within the Faculty of Arts and Social Sciences. 1 Abstract This research branches from the study of silence in sound studies and musicology. It contributes by theorising ‘sonic subtlety’, a new category of sound positioned between silence and sound, where the sound is more restrained, but also not completely silent. Sonic subtlety appears in four aspects of sound: amplitude, spectrum, space and time. This study observes how sonic subtlety performs in 20th-century classical music and contemporary film music and answers the following: • What does sonic subtlety do and in which ways can it perform effects to a listener? • How does sonic subtlety function in 20th-century classical music and contemporary film music? • How does sonic subtlety change the act of listening? In Chapter 1, I explain ‘sonic performativity’, the ability of a sound to perform an effect to an audience. This thesis considers sonic subtlety in terms of its sonic performativity. Most 20th-century classical music has no external, extra-musical functions such as illustrating a narrative or accompanying a visual. Sonic subtlety performs effects for the listener’s enjoyment only. In Chapter 2, sonic subtlety has four modalities of performativity: sonic clarity, sonic environment, sonic preparation and thematic subtlety. Film music has a more functional nature than 20th-century classical music with the addition of three cinematic factors: intermediality, narrative and emotion. In Chapter 3, the modalities of sonic subtlety function in film music to enhance these factors. -

Ferienkurse Für Internationale Neue Musik, 25.8.-29.9. 1946
Ferienkurse für internationale neue Musik, 25.8.-29.9. 1946 Seminare der Fachgruppen: Dirigieren Carl Mathieu Lange Komposition Wolfgang Fortner (Hauptkurs) Hermann Heiß (Zusatzkurs) Kammermusik Fritz Straub (Hauptkurs) Kurt Redel (Zusatzkurs) Klavier Georg Kuhlmann (auch Zusatzkurs Kammermusik) Gesang Elisabeth Delseit Henny Wolff (Zusatzkurs) Violine Günter Kehr Opernregie Bruno Heyn Walter Jockisch Musikkritik Fred Hamel Gemeinsame Veranstaltungen und Vorträge: Den zweiten Teil dieser Übersicht bilden die Veranstaltungen der „Internationalen zeitgenössischen Musiktage“ (22.9.-29.9.), die zum Abschluß der Ferienkurse von der Stadt Darmstadt in Verbindung mit dem Landestheater Darmstadt, der „Neuen Darmstädter Sezession“ und dem Süddeutschen Rundfunk, Radio Frankfurt, durchgeführt wurden. Datum Veranstaltungstitel und Programm Interpreten Ort u. Zeit So., 25.8. Erste Schloßhof-Serenade Kst., 11.00 Ansprache: Bürgermeister Julius Reiber Conrad Beck Serenade für Flöte, Klarinette und Streichorchester des Landes- Streichorchester (1935) theaters Darmstadt, Ltg.: Carl Wolfgang Fortner Konzert für Streichorchester Mathieu Lange (1933) Solisten: Kurt Redel (Fl.), Michael Mayer (Klar.) Kst., 16.00 Erstes Schloß-Konzert mit neuer Kammermusik Ansprachen: Kultusminister F. Schramm, Oberbürger- meister Ludwig Metzger Lehrkräfte der Ferienkurse: Paul Hindemith Sonate für Klavier vierhändig Heinz Schröter, Georg Kuhl- (1938) mann (Kl.) Datum Veranstaltungstitel und Programm Interpreten Ort u. Zeit Hermann Heiß Sonate für Flöte und Klavier Kurt Redel (Fl.), Hermann Heiß (1944-45) (Kl.) Heinz Schröter Altdeutsches Liederspiel , II. Teil, Elisabeth Delseit (Sopr.), Heinz op. 4 Nr. 4-6 (1936-37) Schröter (Kl.) Wolfgang Fortner Sonatina für Klavier (1934) Georg Kuhlmann (Kl.) Igor Strawinsky Duo concertant für Violine und Günter Kehr (Vl.), Heinz Schrö- Klavier (1931-32) ter (Kl.) Mo., 26.8. Komponisten-Selbstporträts I: Helmut Degen Kst., 16.00 Kst., 19.00 Einführung zum Klavierabend Georg Kuhlmann Di., 27.8. -

DUTILLEUX Le Loup
SUPER AUDIO CD DUTILLEUX Le Loup SONATINE SONATE pour Flûte et Orchestre pour Hautbois et Orchestre SARABANDE ET CORTÈGE pour Basson et Orchestre SINFONIA OF LONDON JOHN WILSON Photograph by Boris Lipnitzky (1887 – 1971) / Roger-Viollet / ArenaPAL / Roger-Viollet – 1971) (1887 Boris Lipnitzky by Photograph Henri Dutilleux, February 1947 Henri Dutilleux (1916 – 2013) Le Loup (1953) 28:12 (The Wolf) Ballet in One Act and Three Tableaux for Orchestra Scenario by Jean Anouilh and Georges Neveux Costumes and stage design by Jean Carzou 1 Allegro – Rideau de Scène – Premier Tableau. La Baraque foraine. Les Mystifications (First Tableau. The Fairground Hut. Magic Tricks) La Place du village, aux abords d’une forêt (The village Square, on the edge of a forest). [ ] – Le Loup fait ses tours (The Wolf performs his tricks). Pesant – Le Loup fait encore quelques tours (The Wolf performs a few more tricks). Pesant – Première Danse de la petite Bohémienne (First Dance of the Gypsy Girl). Moins vite (Mouvement de Polka) – Les Mystifications (The Magic Tricks). Première transformation d’un badaud en bête (First transformation of an onlooker into an animal). Tempo I – Meno mosso – Entrée de la Noce (Entry of the Wedding Party). [ ] – Deuxième Danse de la petite Bohémienne (Second Dance of the Gypsy Girl). Un poco più mosso – Troisième Danse de la petite Bohémienne (Third Dance of the Gypsy Girl). Moins vite (Mouvement de Polka) – 3 La petite Bohémienne seule (The Gypsy Girl alone). Mouvement de Valse – Variations de la Bohémienne et Pas de deux (Le Marié et la Bohémienne) (Variations of the Gypsy Girl and Pas de deux [The Bridegroom and the Gypsy Girl]). -

TEXTE Zur MUSIK Band 4 Werk-Einführungen Elektronische Musik Weltmusik Vorschläge Und Standpunkte Zum Werk Anderer
Inhalt TEXTE zur MUSIK Band 4 Werk-Einführungen Elektronische Musik Weltmusik Vorschläge und Standpunkte Zum Werk Anderer „Glauben Sie, daβ eine Gesellschaft ohne Wertvorstellungen leben kann?” „Was steht in TEXTE Band 4?” I Werk-Einführungen CHÖRE FÜR DORIS und CHORAl DREI LIEDER SONATINE KREUZSPIEL FORMEL SPIEL SCHLAGTRIO MOMENTE MIXTUR STOP HYMNEN mit Orchester Zur Uraufführung der Orchesterfassung Eine ‚amerikanische’ Aufführung im Freien PROZESSION AUS DEN SIEBEN TAGEN RICHTIGE DAUERN UNBEGRENZT VERBINDUNG TREFFPUNKT NACHTMUSIK ABWÄRTS OBEN UND UNTEN INTENSITÄT SETZ DIE SEGEL ZUR SONNE KOMMUNION ES Fragen und Antworten zur Intuitiven Musik GOLDSTAUB POLE und EXPO MANTRA FÜR KOMMENDE ZEITEN STERNKLANG 1 TRANS ALPHABET Am Himmel wandre ich... YLEM INORI Neues in INORI Vortrag über Hu Atmen gibt das Leben HERBSTMUSIK MUSIK IM BAUCH TIERKREIS Version für Kammerorchester HARLEKIN DER KLEINE HARLEKIN SIRIUS AMOUR JUBILÄUM IN FREUNDSCHAFT DER JAHRESLAUF II Elektronische Musik Vier Kriterien der Elektronischen Musik Fragen und Antworten zu den Vier Kriterien… Die Zukunft der elektroakustischen Apparaturen in der Musik III Weltmusik Erinnerungen an Japan Moderne Japanische Musik und Tradition Weltmusik IV Vorschläge und Standpunkte Interview I: Gespräch mit holländischem Kunstkreis Interview II: Zur Situation (Darmstädter Ferienkurse ΄74) Interview III: Denn alles ist Musik... Interview IV Die Musik und das Kind Du bist, was Du singst – Du wirst, was Du hörst – Vorschläge für die Zukunft des Orchesters Ein Briefwechsel ‚im Geiste der Zeit’ 2 Brief an den Deutschen Musikrat Briefwechsel über das Urheberrecht Silvester-Umfrage Fragen, die keine sind Finden Sie die Programmierung gut ? (Beethoven – Webern – Stockhausen) V Zum Werk Anderer Mahlers Biographie Niemand kann über seinen Schatten springen? Eine Buchbesprechung Über John Cage Zu Schönbergs 100. -

Karlheinz Stockhausen List of Works
Karlheinz Stockhausen List of Works All works which were composed until 1969 (work numbers ¿ to 29) are published by Universal Edition in Vienna, with the exception of ETUDE, Electronic STUDIES I and II, GESANG DER JÜNGLINGE, KONTAKTE, MOMENTE, and HYMNEN, which are published since 1993 by the Stockhausen-Verlag, and the renewed compositions 3x REFRAIN 2000, MIXTURE 2003, STOP and START. Starting with work number 30, all compositions are published by the Stockhausen-Verlag, Kettenberg 15, 51515 Kürten, Germany, and may be ordered directly. 1 = numeration of the individually performable works. r1 = orchestra works with at least 19 players (or fewer when the instrumentation is unconventional), and works for orchestra with choir. o1 = chamber music works. Among these are several which have more than 18 players, but are usually not performed by orchestras, but rather by chamber ensembles such as the London Sinfonietta, the Ensemble Intercontemporain, the Asko Ensemble, or Ensemble Modern. J35 = Works, which may also be performed as “chamber music” (for example INORI with 2 dancer- mimes and tape [instead of orchestra] or works for choir in which the choir may be played back on tape. 1. ex 47 = 1st derivative of Work No. 47. [9’21”] = duration of 9 minutes and 21 seconds (durations with minutes and seconds: CD durations of the Complete Edition). U. E. = Universal Edition. St. = Stockhausen-Verlag. For most of the works, an electro-acoustic installation is indicated. Detailed information about the required equipment may be found in the scores. In very small halls (for less than 100 people), it is possible to omit amplification for some solo works and works for small ensembles.