Bychkov London Voices 14., 15
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verdi Week on Operavore Program Details
Verdi Week on Operavore Program Details Listen at WQXR.ORG/OPERAVORE Monday, October, 7, 2013 Rigoletto Duke - Luciano Pavarotti, tenor Rigoletto - Leo Nucci, baritone Gilda - June Anderson, soprano Sparafucile - Nicolai Ghiaurov, bass Maddalena – Shirley Verrett, mezzo Giovanna – Vitalba Mosca, mezzo Count of Ceprano – Natale de Carolis, baritone Count of Ceprano – Carlo de Bortoli, bass The Contessa – Anna Caterina Antonacci, mezzo Marullo – Roberto Scaltriti, baritone Borsa – Piero de Palma, tenor Usher - Orazio Mori, bass Page of the duchess – Marilena Laurenza, mezzo Bologna Community Theater Orchestra Bologna Community Theater Chorus Riccardo Chailly, conductor London 425846 Nabucco Nabucco – Tito Gobbi, baritone Ismaele – Bruno Prevedi, tenor Zaccaria – Carlo Cava, bass Abigaille – Elena Souliotis, soprano Fenena – Dora Carral, mezzo Gran Sacerdote – Giovanni Foiani, baritone Abdallo – Walter Krautler, tenor Anna – Anna d’Auria, soprano Vienna Philharmonic Orchestra Vienna State Opera Chorus Lamberto Gardelli, conductor London 001615302 Aida Aida – Leontyne Price, soprano Amneris – Grace Bumbry, mezzo Radames – Placido Domingo, tenor Amonasro – Sherrill Milnes, baritone Ramfis – Ruggero Raimondi, bass-baritone The King of Egypt – Hans Sotin, bass Messenger – Bruce Brewer, tenor High Priestess – Joyce Mathis, soprano London Symphony Orchestra The John Alldis Choir Erich Leinsdorf, conductor RCA Victor Red Seal 39498 Simon Boccanegra Simon Boccanegra – Piero Cappuccilli, baritone Jacopo Fiesco - Paul Plishka, bass Paolo Albiani – Carlos Chausson, bass-baritone Pietro – Alfonso Echevarria, bass Amelia – Anna Tomowa-Sintow, soprano Gabriele Adorno – Jaume Aragall, tenor The Maid – Maria Angels Sarroca, soprano Captain of the Crossbowmen – Antonio Comas Symphony Orchestra of the Gran Teatre del Liceu, Barcelona Chorus of the Gran Teatre del Liceu, Barcelona Uwe Mund, conductor Recorded live on May 31, 1990 Falstaff Sir John Falstaff – Bryn Terfel, baritone Pistola – Anatoli Kotscherga, bass Bardolfo – Anthony Mee, tenor Dr. -
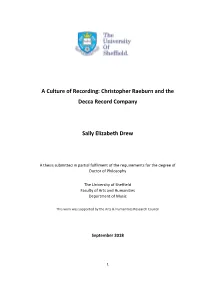
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company Sally Elizabeth Drew A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Sheffield Faculty of Arts and Humanities Department of Music This work was supported by the Arts & Humanities Research Council September 2018 1 2 Abstract This thesis examines the working culture of the Decca Record Company, and how group interaction and individual agency have made an impact on the production of music recordings. Founded in London in 1929, Decca built a global reputation as a pioneer of sound recording with access to the world’s leading musicians. With its roots in manufacturing and experimental wartime engineering, the company developed a peerless classical music catalogue that showcased technological innovation alongside artistic accomplishment. This investigation focuses specifically on the contribution of the recording producer at Decca in creating this legacy, as can be illustrated by the career of Christopher Raeburn, the company’s most prolific producer and specialist in opera and vocal repertoire. It is the first study to examine Raeburn’s archive, and is supported with unpublished memoirs, private papers and recorded interviews with colleagues, collaborators and artists. Using these sources, the thesis considers the history and functions of the staff producer within Decca’s wider operational structure in parallel with the personal aspirations of the individual in exerting control, choice and authority on the process and product of recording. Having been recruited to Decca by John Culshaw in 1957, Raeburn’s fifty-year career spanned seminal moments of the company’s artistic and commercial lifecycle: from assisting in exploiting the dramatic potential of stereo technology in Culshaw’s Ring during the 1960s to his serving as audio producer for the 1990 The Three Tenors Concert international phenomenon. -

To Download the Full Archive
Complete Concerts and Recording Sessions Brighton Festival Chorus 27 Apr 1968 Concert Dome Concert Hall, Brighton Brighton Festival Belshazzar's Feast Walton William Walton Royal Philharmonic Orchestra Baritone Thomas Hemsley 11 May 1968 Concert Dome Concert Hall, Brighton Brighton Festival Kyrie in D minor, K 341 Mozart Colin Davis BBC Symphony Orchestra 27 Oct 1968 Concert Dome Concert Hall, Brighton Brighton Philharmonic Society Budavari Te Deum Kodály Laszlo Heltay Brighton Philharmonic Orchestra Soprano Doreen Price Mezzo-Soprano Sarah Walker Tenor Paul Taylor Bass Brian Kay 23 Feb 1969 Concert Dome Concert Hall, Brighton Brighton Philharmonic Society Symphony No. 9 in D minor, op.125 Beethoven Herbert Menges Brighton Philharmonic Orchestra Soprano Elizabeth Harwood Mezzo-Soprano Barbara Robotham Tenor Kenneth MacDonald Bass Raimund Herincx 09 May 1969 Concert Dome Concert Hall, Brighton Brighton Festival Mass in D Dvorák Václav Smetáček Czech Philharmonic Orchestra Soprano Doreen Price Mezzo-Soprano Valerie Baulard Tenor Paul Taylor Bass Michael Rippon Sussex University Choir 11 May 1969 Concert Dome Concert Hall, Brighton Brighton Festival Liebeslieder-Walzer Brahms Laszlo Heltay Piano Courtney Kenny Piano Roy Langridge 25 Jan 1970 Concert Dome Concert Hall, Brighton Brighton Philharmonic Society Requiem Fauré Laszlo Heltay Brighton Philharmonic Orchestra Soprano Maureen Keetch Baritone Robert Bateman Organ Roy Langridge 09 May 1970 Concert Dome Concert Hall, Brighton Brighton Festival Mass in B Minor Bach Karl Richter English Chamber Orchestra Soprano Ann Pashley Mezzo-Soprano Meriel Dickinson Tenor Paul Taylor Bass Stafford Dean Bass Michael Rippon Sussex University Choir 1 Brighton Festival Chorus 17 May 1970 Concert Dome Concert Hall, Brighton Brighton Festival Fantasia for Piano, Chorus and Orchestra in C minor Beethoven Symphony No. -

News Section
News Section Composers MICHAEL FINNISSY. Tlie History of Photography in Sound (first complete performance —29 January/London, R.A.M./ JOHN ADAMS. El Nino (German premiere)-15 ApriJ/ Ian Pace (pno). Berlin, Philharmonie/Dawn Upshaw, Lorraine Hunt- Lieberson, Willard White, London Voices, Deutsche SO c. GERALD FINZI (d.1956). In Years Defaced (premiere of Kent Nagano. cycle of six songs arrnaged for orchestra by the composer and JUDITH WEIR, COLIN MATTHEWS, ANTHONY JULIAN ANDERSON. Tlie Bird Sings With its Fingers (prePAYNE- , CHRISTIAN ALEXANDER and JEREMY miere)—9 February/London, Imperial College/Sinfonia 21 c. DALE ROBERTS)-19 May/Newbury Festival/Philip Martyn Brabbins. Langridge (ten), Cityu of London Sinfonia c. Richard Hickox. LOUIS ANDRIESSEN. Tlie New Math(s) (UK premiere)-1 DETLEV GLANERT. Mahler/Skizze (UK premiere)-!6 March/London, Barbican/Electra. February/Glasgow/BBC Scottish SO c. Martyne Brabbins. Karikaturcn (premiere)—5 May/Berlin, Konzderthaus/ WILLIAM ATTWOOD. Pascal's Dungeon (premiere)-20 Kammersymphonie Berlin c. Jiirgen Bruns. February/London, Blackheath Concert Halls/Janey Miller (oboe d'amore), Joby Burgess (perc). ALEXANDER GOEHR. Piano Quintet (premiere)-30 March/New York, Carnegie Hall/Peter Serkin (pno), Orion GERALD BARRY has completed a work for the Vanburgh Quartet. Suite for violin and piano (premiere)—25 April/ String Quartet; he is writing a work for children's choir and Harvard/Pamela Frank (vln), Peter Serkin (pno). chamber orchestra, commissioned for the 50' birthday cele- brations of the South Bank Centre, and an opera based on HK GRUBER. Aerial; Charivari (Australian premieres)-28 Fassbaender's Tlie Bitter Tears of Petra von Kant. April/Melbourne/Hakan Hardenberger (tpt), Melbourne SO c. -

Lucia Di Lammermoor
July 30, 2020 – Gaetano Donizetti’s Lucia di Lammermoor “Lammermoor lass goes mad, stabs fiancée to death” is the headline that might have appeared in The Scotsman following the premiere of Gaetano Donizetti’s Lucia di Lammermoor, which is featured on this week’s Thursday Night Opera House. Loosely based on Sir Walter Scott’s historical novel The Bride of Lammermoor, the opera benefitted greatly from a European interest in the history and culture of Scotland: the perceived romance of its violent wars and feuds, as well as its folklore and mythology, intrigued nineteenth-century readers and audiences. Lucia premiered on September 26, 1835 at the Teatro San Carlo in Naples. It has always been the best-known of Donizetti's tragic operas and has never fallen out of the standard repertory. In seventeenth-century Scotland, Lucia (soprano Andrea Rost) loves Edgardo (tenor Bruce Ford), the dispossessed master of Ravenswood and an enemy of her family. The couple exchange rings and vows before Edgardo leaves the country on a mission, and Lucia’s brother Enrico (baritone Anthony Michaels-Moore), learning of this, is outraged. He wants his sister to make a politically advantageous marriage to Lord Arturo Bucklaw (tenor Paul Charles Clark) and shows her a forged letter supposedly written by Edgardo that “proves” his infidelity. In the light of this and persuaded by the chaplain Raimondo (bass Alastair Miles), Lucia reluctantly agrees to the marriage. Months later Edgardo returns, interrupts the wedding celebration, curses Lucia and flings her ring at her, provoking Enrico to challenge him to a duel in the Ravenswood cemetery. -

LONDON METROPOLITAN ARCHIVES BARBICAN CLA/072 Page
LONDON METROPOLITAN ARCHIVES Page 1 BARBICAN CLA/072 Reference Description Dates PRINTED REPORTS CLA/072/01/001 Scheme submitted by the New Barbican 2.12.1954 Committee for the Area North of Route 11. 1 pamphlet Former reference: A5/E COL/PLD/TP/05/008 CLA/072/01/002 Scheme submitted by the New Barbican 26.9.1955 Committee for the Area North of Route 11. 1 pamphlet Former reference: A13/J COL/PLD/TP/05/008 CLA/072/01/003 Confidential Report to the Town Clerk on Jun-55 proposed City Housing. 1 pamphlet Former reference: C90/A COL/PLD/TP/05/008 CLA/072/01/004 Speech made by Mr. Eric F. Wilkins in CoCo 17.11.1955 3rd Nov 1955, Mr. John Batty's Speech and a memorandum of the Town Clerk. Consideration of the Schemes for the development of the Barbican Area. 1 pamphlet Former reference: A7/C COL/PLD/TP/05/008 CLA/072/01/005 Report on residential development within the 31.5.1956 Barbican Area prepared on the instructions of the Special Committee by Chamberl in Powell and Bon Architects. 1 pamphlet Former reference: A89/H COL/PLD/TP/05/008 CLA/072/01/006 Supplementary Report addressed to the Oct. 1956 Conference of Deputations of the Improvements and Town Planning, Public HeaLTH, City of London Schools, Music and Special Committees. 1 pamphlet Former reference: A105/k COL/PLD/TP/05/008 CLA/072/01/007 Barbican Area, Martin - Mealand Scheme 2.4.1957 1 pamphlet Former reference: C90/K COL/PLD/TP/05/008 LONDON METROPOLITAN ARCHIVES Page 2 BARBICAN CLA/072 Reference Description Dates CLA/072/01/008 Redevelopment of the Barbican Area: 12.12.1957 engagement of Architects and other Consultants. -

SCHOENBERG Violin Concerto a Survivor from Warsaw Rolf Schulte, Violin • David Wilson-Johnson, Narrator Simon Joly Chorale • Philharmonia Orchestra Robert Craft
557528 bk Schoenberg 8/18/08 4:10 PM Page 12 SCHOENBERG Violin Concerto A Survivor from Warsaw Rolf Schulte, Violin • David Wilson-Johnson, Narrator Simon Joly Chorale • Philharmonia Orchestra Robert Craft Available from Naxos Books 8.557528 12 557528 bk Schoenberg 8/18/08 4:10 PM Page 2 THE ROBERT CRAFT COLLECTION Robert Craft THE MUSIC OF ARNOLD SCHOENBERG, Vol. 10 Robert Craft, the noted conductor and widely respected writer and critic on music, literature, and culture, holds a Robert Craft, Conductor unique place in world music of today. He is in the process of recording the complete works of Stravinsky, Schoenberg, and Webern for Naxos. He has twice won the Grand Prix du Disque as well as the Edison Prize for his landmark recordings of Schoenberg, Webern, and Varèse. He has also received a special award from the American Academy and 1 A Survivor from Warsaw National Institute of Arts and Letters in recognition of his “creative work” in literature. In 2002 he was awarded the for Narrator, Men’s Chorus and Orchestra, Op. 46 7:11 International Prix du Disque Lifetime Achievement Award, Cannes Music Festival. Robert Craft has conducted and recorded with most of the world’s major orchestras in the United States, Europe, David Wilson-Johnson, Narrator • Simon Joly Chorale • Philharmonia Orchestra Russia, Japan, Korea, Mexico, South America, Australia, and New Zealand. He is the first American to have conducted Berg’s Wozzeck and Lulu, and his original Webern album enabled music lovers to become acquainted with this Recorded at Abbey Road Studio One, London, on 3rd October, 2007 composer’s then little-known music. -

Concerts with the London Philharmonic Orchestra for Seasons 1946-47 to 2006-07 Last Updated April 2007
Artistic Director NEVILLE CREED President SIR ROGER NORRINGTON Patron HRH PRINCESS ALEXANDRA Concerts with the London Philharmonic Orchestra For Seasons 1946-47 To 2006-07 Last updated April 2007 From 1946-47 until April 1951, unless stated otherwise, all concerts were given in the Royal Albert Hall. From May 1951 onwards, unless stated otherwise, all concerts were given in The Royal Festival Hall. 1946-47 May 15 Victor De Sabata, The London Philharmonic Orchestra (First Appearance), Isobel Baillie, Eugenia Zareska, Parry Jones, Harold Williams, Beethoven: Symphony 8 ; Symphony 9 (Choral) May 29 Karl Rankl, Members Of The London Philharmonic Orchestra, Kirsten Flagstad, Joan Cross, Norman Walker Wagner: The Valkyrie Act 3 - Complete; Funeral March And Closing Scene - Gotterdammerung 1947-48 October 12 (Royal Opera House) Ernest Ansermet, The London Philharmonic Orchestra, Clara Haskil Haydn: Symphony 92 (Oxford); Mozart: Piano Concerto 9; Vaughan Williams: Fantasia On A Theme Of Thomas Tallis; Stravinsky: Symphony Of Psalms November 13 Bruno Walter, The London Philharmonic Orchestra, Isobel Baillie, Kathleen Ferrier, Heddle Nash, William Parsons Bruckner: Te Deum; Beethoven: Symphony 9 (Choral) December 11 Frederic Jackson, The London Philharmonic Orchestra, Ceinwen Rowlands, Mary Jarred, Henry Wendon, William Parsons, Handel: Messiah Jackson Conducted Messiah Annually From 1947 To 1964. His Other Performances Have Been Omitted. February 5 Sir Adrian Boult, The London Philharmonic Orchestra, Joan Hammond, Mary Chafer, Eugenia Zareska, -

City Light Symphony Orchestra London Voices Ernst Van Tiel · Leitung 30
WELTPREMIERE CITY LIGHT SYMPHONY ORCHESTRA LONDON VOICES ERNST VAN TIEL · LEITUNG 30. November – 2. Dezember 2018 KKL Luzern · Konzertsaal «How To Train Your Dragon» © 2010 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved LIEBE FILMMUSIK - FREUNDE Es freut uns, Ihnen heute DreamWorks’ «How to Train Your Dragon» als Konzert-Erlebnis hier im KKL Luzern E präsentieren zu dürfen. Ganz besonders hier im Konzertsaal begrüssen möchte ich zudem den preisgekrönten Kompo- nisten John Powell, er uns während des Weltpremiere-Wochenendes mit seiner Anwesenheit beehrt. «How to Train Your Dragon» von DreamWorks Animations ist eine ebenso fesselnde wie originelle Geschichte, die Humor, feurige Action und episches Abenteuer miteinander kombiniert. Als der junge Wikinger Hiccup mit den Traditionen seines Volkes bricht und sich mit dem wilden Drachen Toothless anfreun- det, müssen sie zusammen in der Folge gegen alle Wid- rigkeiten kämpfen, um ihre beiden Welten zu retten. John Powells atemberaubende, von keltischer Musik inspirierte Partitur begleitet die Abenteuer von Hiccup und Toothless mit starken musikalischen Themen, die meisterhaft in tosende Action, herzerwär- mende Romantik und unbeschwerten Humor verwoben werden, was in einem unvergesslichen Musikerlebnis resultiert. Ich wünsche Ihnen im Namen der Musikerinnen und Musiker des City Light Symphony Orchestra, der Sängerinnen und Sänger der London Voices sowie des musikalischen Leiters Ernst van Tiel ein vergnügli- ches, berührendes und mitreissendes Konzerterlebnis. Pirmin Zängerle City Light Concerts -

Christopher Dee 7B Lanhill Road, Maida Vale, London W9 2BP
Maida Vale Singers Director : Christopher Dee 7b Lanhill Road, Maida Vale, London W9 2BP. Tel:-020-7266-1358 Mobile:-07889-153145 E-mail: [email protected] Web-site: www.maidavalesingers.co.uk VAT No: 86356778 CHRISTOPHER DEE Height 6’0” Eyes Brown Hair Grey Vocal Range Tenor THEATRE Company Paul Maida Vale Singers Hackney Empire Man Of La Mancha Jose Covent Garden Festival Peacock Theatre Music in the Air Ensemble Jamie Hammerstein Barbican One Touch of Venus Stanley Kevin Amos (M.D.) Barbican Trouble in Tahiti Jazz Trio Mark Warman (M.D.) Theatre Museum Fanny Louis/Priest Ian Marshall Fisher Theatre Museum Alice in Wonderland Madhatter/Caterpillar Stephen Metcalf Opera House, York Pirates of Penzance Ensemble E&B Productions London Palladium Bernstein: Mass Celebrant Terry John Bates Connaught, Worthing Candide Archbishop/Swing Jonathan Miller Old Vic Iolanthe / Pirates / Ensemble/Swing New D’Oyly Carte British Tour Yeomen / Mikado Opera Company Anything Goes Male Quartet David Firman (M.D.) Opera House, Manchester HMS Pinafore Chorus Master Sir Charles Mackerras (MD) Royal Albert Hall The Beat Is On Leading Man Cabaret L’Hirondelle Hello Dolly Ensemble Donald Pippin (M.D.) London Palladium Oklahoma! Chorus Master David Charles Abell (MD) Royal Albert Hall H.M.S. Pinafore / Mikado / Ensemble London Savoyards Barbican Pirates / Gondoliers RECORDINGS Cole Porter In Hollywood Maida Vale Singers – John Wilson WARNER CLASSICS Rodgers & Hammerstein At The Movies Maida Vale Singers – John Wilson EMI Clare’s Journey Maida Vale Singers – Christopher Dee Claudio Records Nunc Dimittis Maida Vale Singers – Robin White Claudio Records That’s Entertainment Maida Vale Singers – John Wilson EMI Porgy & Bess Maida Vale Singers – David White Porgy & Bess Ltd. -
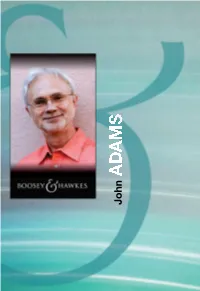
Composer Brochure | Works
Book 3.indb 2 John ADAMS ElliottCARTER 9/5/2008 12:08:42 PM John Adams Introduction English 1 Deutsch 4 Français 7 Abbreviations 10 Works Operas 12 Full Orchestra 16 Chamber Orchestra 20 Solo Instrument(s) and Orchestra 21 TABLE OF CONTENTS TABLE Voice(s) and Orchestra 22 Ensemble and Chamber with out Voice(s) 23 Piano(s) 26 Instrumental 26 Miscellaneous 27 Arrangements 27 Recordings 29 Chronological List of Works 32 Boosey & Hawkes Addresses 34 Composer List Cover photo: Deborah O'Grady Book 3.indb 3 9/5/2008 12:08:42 PM The Music of John Adams ON I The strains of his grandfather’s lakeside New England dance hall were among the earliest layers of John Adams’s aural CT memory. So too were the marching bands in which he played clarinet as a young student. Learning the basic European DU canon in front of the family Magnavox, Adams readily O assimilated it alongside the crazy quilt of American vernacular R music he encountered in the early postwar decades. Duke Ellington is a recurrent inspiration, and Adams’s love of jazz— which returns in unexpected forms, such as the improvisatory NT I “hypermelody” of the Violin Concerto (1993) or the electric violin’s raga-like musings in The Dharma at Big Sur (2003)— was early nurtured by his parents’ activities in jazz groups. As a student at Harvard during the cataclysmic upheavals of the late Sixties, Adams experienced the cognitive dissonance of the arid pronouncements of contemporary serialists when confronted with the fresh, Dionysian inventiveness of this golden age of rock. -

American Record Guide & Independent Critics Reviewing Classical Recordings and Music in Concert
Amer & Independent Crican R itics Re ecor viewing Classical Recor d G dings and Music uidein Concer t American Record Guide Side 1 San Francisco Ring—3 Views Carnegie's “Spring for Music” Buffalo Phil's 2 premieres L.A. Master Chorale Montreal Piano Competition Festivals: Boston Early Music Spoleto USA Fayetteville Chamber Music Montreal Chamber Music Mahler's 100th: MTT's Nos. 2, 6, 9 Crakow Phil Festival September/October 2011 us $7.99 Over 500 Re views Sig01arg.qxd 7/22/2011 4:46 PM Page 1 Contents Sullivan & Dalton Carnegie’s “Spring for Music” Festival 4 Seven Orchestras, Adventurous Programs Gil French Cracow’s Mahler Festival 7 Discoveries Abound Jason Victor Serinus MTT and the San Francisco Symphony 10 Mahler Recapped Brodie, Serinus & Ginell San Francisco Opera’s Ring Cycle 12 Three Views Brodie & Kandell Ascension’s New Pascal Quoirin Organ 16 French and Baroque Traditions on Display Perry Tannenbaum Spoleto USA 19 Renewed Venues, Renewed Spirit John Ehrlich Boston Early Music Festival 22 Dart and Deller Would Be Proud Richard S Ginell Mighty Los Angeles Master Chorale 24 Triumphing in Brahms to Ellington Herman Trotter Buffalo Philharmonic 26 Tyberg Symphony, Hagen Concerto Melinda Bargreen Schwarz’s 26 Year Seattle Legacy 28 Au Revoir But Not Good-Bye Bill Rankin Edmonton’s Summer Solstice Festival 30 Chamber Music for All Tastes Gil French Fayetteville Chamber Music Festival 32 The World Comes to Central Texas Robert Markow Bang! You’ve Won 34 Montreal Music Competition Robert Markow Osaka's Competitions and Orchestras 35