Die Funktionen Des Ke-An-Formativs in Der Bahasa Indonesia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Case Study of Batik in Java and Santiniketan
Universiteit Leiden Journey of Textile Designs: A Case Study of Batik in Java and Santiniketan Master Thesis, Asian Studies (60 EC) 2015-16 Name of student: Deboshree Banerjee Student Number: s1684337 Date: 1st September 2016 Supervisors: Prof. dr. N.K. Wickramasinghe-Samarasinghe Prof. dr. P.R. Kanungo Table of Contents Table of Contents ....................................................................................................................... ii List of Figures and Tables......................................................................................................... iv Abstract ...................................................................................................................................... v Chapter 1: Introduction .............................................................................................................. 1 1.1. Textiles: A Medium of Cultural Studies ......................................................................... 1 1.2. Diffusion Theory ............................................................................................................. 3 1.3. Literature Review: Javanese and Santiniketan Batik ...................................................... 4 1.3.1. Javanese Batik .......................................................................................................... 5 1.3.2 Santiniketan Batik ..................................................................................................... 7 1.4. Proposed Hypothesis ...................................................................................................... -
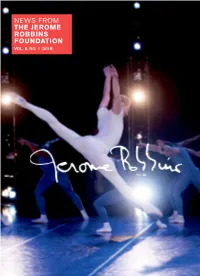
News from the Jerome Robbins Foundation Vol
NEWS FROM THE JEROME ROBBINS FOUNDATION VOL. 6, NO. 1 (2019) The Jerome Robbins Dance Division: 75 Years of Innovation and Advocacy for Dance by Arlene Yu, Collections Manager, Jerome Robbins Dance Division Scenario for Salvatore Taglioni's Atlanta ed Ippomene in Balli di Salvatore Taglioni, 1814–65. Isadora Duncan, 1915–18. Photo by Arnold Genthe. Black Fiddler: Prejudice and the Negro, aired on ABC-TV on August 7, 1969. New York Public Library for the Performing Arts, Jerome Robbins Dance Division, “backstage.” With this issue, we celebrate the 75th anniversary of the Jerome Robbins History Dance Division of the New York Public Library for the Performing Arts. In 1944, an enterprising young librarian at The New York Public Library named One of New York City’s great cultural treasures, it is the largest and Genevieve Oswald was asked to manage a small collection of dance materials most diverse dance archive in the world. It offers the public free access in the Music Division. By 1947, her title had officially changed to Curator and the to dance history through its letters, manuscripts, books, periodicals, Jerome Robbins Dance Division, known simply as the Dance Collection for many prints, photographs, videos, films, oral history recordings, programs and years, has since grown to include tens of thousands of books; tens of thousands clippings. It offers a wide variety of programs and exhibitions through- of reels of moving image materials, original performance documentations, audio, out the year. Additionally, through its Dance Education Coordinator, it and oral histories; hundreds of thousands of loose photographs and negatives; reaches many in public and private schools and the branch libraries. -

Evolution of the Inhabitants of Java
WASON DS 619 N91+ ASIA CORNELL UNIVERSITY LIBRARIES ITHACA, N. Y. 14S53 John M. Echols Collection on Southeast Asia JOHN M. OLIN LIBRARY f IP fjy / Cornell University Library DS 619.N91 Evolution of the inhabitants of Java / 3 1924 023 093 713 * k # # Date Due MEtM Jfl5finHf 24 MAY i:6 1999 Inttrllbrary .oan 23233 ZJresen\ed by ^Javigalion Uompanij, {fie ^QoyJ^PacLt CMmsierdam, 4i KV? EVOLUTION OF THE INHABITANTS OF JAVA by Raden Mas NOTO SOEROTO With coloured illustrations (autochrome) by Prof. Dr' A. H. BLAAUW ; I. A. OCHSE and TASSILO ADAM I. INHABITANTS e is ^ an<^ or Java is inhabited principally by one race, but various \gfSi fS^^ of nationalities. MSjM Besides, in addition to Europeans of various nationalities concerning which we shall S%m Wj not say anything for the present, many foreigners of the most divergent nationalities -">™ from gigantic Asia have established themselves on this island. The inhabitants of other islands of the Indies Archipelago have also yielded their quota. As far as history has allowed this to be seen foreigners have streamed into Java, these, however, have always allowed themselves to become assimilated by the Javanese. It is unknown who were th,e original inhab- itants of that country, it is certain, however, that the three great Javanese peoples who now inhabit the island were once of foreign origin: the actual Javanese, the Sundanese and Madur- ese. These three races speak tongues belonging to the Malay-Polynesian group of languages, extending from Madagascar, off Africa, to Formosa beyond Japan. Moreover that language group extends from the mainland of Asia to close to the coasts of America, throughout the numerous islands comprising that world archipelago. -

October 1997 the UNIVERSITY of HULL BATIK CLOTHS FROM
THE UNIVERSITY OF HULL BATIK CLOTHS FROM JAMBI, SUMATRA being a Thesis submitted for the Degree of PhD in South-East Asian Studies in the University of Hull by Fiona Gordon Kerlogue, B.A., M.A. October 1997 Table of Contents Acknow ledgements I Introduction 1 ,II Iambi History 26 III The fieldwork setting (Olak Kemang village & Seberang) 48 IV Textiles in Use 65 V The Blue batiks 87 VI Characteristics of the blue cloths 102 VII Motifs in the blue cloths 118 VIII The Red Batiks 141 IX The red cloths: use, designs and motifs 169 X The calligraphy batik of Jambi 183 XI [ambi batik in context 205 Glossary References Acknowledgements I would like to thank the following people for their help, inspiration, and support: At the Centre for South East Asia Studies at the University of Hull, I would like to thank my supervisor, Lewis Hill for his guidance, good cheer, and unfailing support. Thanks are also due to Professor Michael Hitchcock for his encouragement throughout this endeavour and to Daniel Patty for his good company and his help with all things Indonesian. I extend special thanks to Judith Doyle for her patient help. In Olak Kemang, I would like to thank the family of the late Ibu Asmah, especially her daughter Ibu Azmiah who allowed me to stay in her house, as well .as Ibu Asiah, Pak Edy and Upik. Their patience in answering my constant questions is much appreciated. Special thanks are due to Supik Hassan who treated me like a daughter and helped me in my search to find examples of Jambi batik. -

Gert Jan Bestebreurtje Rare Books Catalogue 202: Pictures of the East
GERT JAN BESTEBREURTJE RARE BOOKS CATALOGUE 202: PICTURES OF THE EAST BY WESTERN ARTISTS GERT JAN BESTEBREURTJE Rare Books Langendijk 8, 4132 AK Vianen The Netherlands Telephone +31 - (0)347 - 322548 E-mail: [email protected] Visit our Web-page at http://www.gertjanbestebreurtje.com CATALOGUE 202: PICTURES OF THE EAST BY WESTERN ARTISTS Prices are quoted in euro, for clients within the European Community 9 % VAT will be added to the prices. Illustration on cover no. 171 BROCHURE ROTTERDAMSCHE LLOYD. (ca. 1938). 1 ASIAN-ARABIAN SAILING BOATS. - Three original watercolours showing Asian or Arabian sailing boats off the coast with native fishermen, signed by SCHLIEN. One plate is dated 1886. Seize ca. 24 x 19 cm and 2 others ca. 31 x 23,5 cm. € 425,00 Decorative images. € 425,00 2 BATAVIA. Die innere Aussicht des Castells in Batavia nebst der Schloss Kirche. - Vuë interieure du pallais de Batavie avec l'eglise du chateau. Augsburg, François Xavier Habermann, (ca. 1780). Contemporary handcoloured perspective view (vue d'optique or Guckkastenbild), with legend in German and French. Ca 29 x 40 cm. € 350,00 € 350,00 Collection des prospects. - Handsome view, after J.W. Heijdt, inside the castle depicting the parade-ground with on the left side the houses of the Raad van Indië and on the right side the castle-church, the house of the governor-general and the buildings of the government, in the background the sea with ships. - Fine. Feith 78c; Cat. 300-jarig bestaan van Batavia 208,3. 3 BATAVIA. BATAVIA, die Haupt-Stadt, Festung und Residenz des Holländischen Gouverneurs am Fluss Iacatra in Ostindien auf der grossen und herrlichen Insul Java. -

The Batavia Stadhuis (City Hall), Completed in 1710. Photo: Claire Holt, 1936
The Batavia Stadhuis (City Hall), completed in 1710. Photo: Claire Holt, 1936. RACE AND COLOR IN COLONIAL SOCIETY: BIOGRAPHICAL SKETCHES BY A EURASIAN WOMAN CONCERNING PRE-WORLD WAR II INDONESIA* Translated and Edited by Paul W. van der Veur This confession may seem tough, mean, embittered, but it is the truth. I have bared my soul completely, putting my whole being into it and I am open and honest about everything. To answer your questions in a concise form would never do. What * The material for this article was obtained while conducting field research on the political history of the Eurasians of Indonesia in the Netherlands from March 1952 to February 1953 on a grant from Cornell University’s Social Science Research Center. To supplement library and archival research, my wife and I stayed as participant observers in one of the numerous "relocation centers" which had been set up in the Netherlands for those Eurasians who needed help in finding a job and/or a place to live. All the residents of the center were inter viewed concerning a variety of matters, but of particular in terest were their views concerning their past relationships with Dutchmen and Indonesians. In addition, the interviewees were asked three open-ended questions: (a) whether Eurasians considered that they had particular customs as Eurasians; (b) whether they felt there were various groups within their com munity, and (c) what they expected the future of their group to be. Naturally the residents of the center received visits from relatives or friends who were already settled in the Nether lands. -

Oideion 1 (1993)
THE P ORMING ART LD Wi WIM ~ WITf~ TH I G V 0 R MU OL lE RNOLD B KE OIDEION The performing arts world-wide edited by WIM VAN ZANTEN CNWS PUBLICATIONS NO. 14 CENTRE OF NON~WESTERN STUDIES LEIDEN UNIVERSITY, THE NETHERLANDS CNWS PUBLICATIONS is produced by the Centre of Non-Western Studies of Leiden University, Leiden, The Netherlands. Editorial board: M. E. van den Berg; R. T. J. Buve; R. Kruk; G. van Loon; W. van der Molen; J. D. M. Platenkamp (chief-editor); W. J. Vogelsang; W. van Zanten. All correspondence should be addressed to: Dr. J. D. M. Platenkamp, chief-editor CNWS Publications, c/o The Centre of Non-Western Studies, Leiden University, PO Box 9515, 2300 RA Leiden, The Netherlands. arnold bake nederlandse vereniginq voor etnomuslcoloqie This volume was published in cooperation with the Nederlandse Vereniging voor Etnomusicologie, Arnold Bake OIDEION The performing arts worlduwide edited by WIM V AN ZANTEN 1993 CENTRE OF NON-WESTERN STUDIES LEIDEN UNIVERSITY PO BOX 9515 2300 RA LEIDEN THE NETHERLANDS CIP gegevens, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Oideion Oideion : the performing arts world-wide I ed. by Wim van Zanten. - Leiden : Centre of Non-Western Studies, Leiden University. - Ill. - (CNWS publications, ISSN 0925-3084 ; no. 14) Met lit. opg. ISBN 90-73782-17-1 Trefw.: volksmuziek Design front cover: Nelleke Oosten, Oegstgeest. Photograph by Daniel de Coppet, August 1964. Reproduced from Are, are - un peuple melanesien et sa musique. Daniel de Coppet and Hugo Zemp, Editions du Seuil, 1978. Courtesy of Daniel de Coppet. Printing: Haveka, Alblasserdam © Copyright 1993 The Centre of Non-Western Studies, Leiden University, The Netherlands. -

Legacy in Cloth Batak Textiles of Indonesia
Legacy in Cloth Batak textiles of Indonesia Sandra Niessen Legacy in cloth Batak textiles of Indonesia kitlv press leiden 2009 © 2009 Sandra A. Niessen No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission from the copyright owner. isbn 978 90 6718 351 2 First published in 2009 by kitlv Press P.O. Box 9515 2300 ra Leiden The Netherlands www.kitlv.nl kitlv (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) is an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (knaw) Design Marie-Cécile Noordzij-Pulles, Hurwenen Printed by Thoben Offset Nijmegen Bound by Van Waarden, Zaandam Publishing assistance: Bergoord Publishing This publication was realized with the support of: – Netherlands organization for scientific research (nwo) – the Barbas-van der Klaauw Fund, managed by the Prince Bernhard Cultural Foundation Printed in the Netherlands Half title page Toba Batak pinunsaan Cat 7.2f; Detail. Early 20th century, ikat and supplementary warp patterning, natural blue and red dyes. Frontispiece Toba Batak simpar Cat 5.4b; Detail. Early 20th century, chevron ikat, natural red dye. Table of contents Acknowledgements 7 Part iii Catalogue Introduction Cataloguing the Indonesian Catalogue Introduction 169 Textile Arts: a Batak Contribution 13 Catalogue Table of Contents 173 Acronyms of Public Collections Consulted 23 Catalogue 1 The Blue Textiles 175 Catalogue -

Leo Haks Indonesian Photographs Collection 1860S–1940S
collection focus Leo Haks Indonesian photographs collection 1860s–1940s Philip Klier Andamanese This collection allowed me to combine a lifelong passion for photography with a professional fishing in Burma album c.1887 albumen silver interest in Indonesia. A sprinkling of guilt feeling for what my Dutch ancestors had done in photograph 21.1 x 27.0 cm National Gallery of Australia, that country, good and less so, made for an exciting challenge. Canberra Purchased 2007 In the collection I assembled over a 30-year period, I tried to show Indonesia as it was between about 1860 and 1940. Staying away from the colonists and their direct influence on the country, I spent most emphasis on the Indonesian people, their culture and the landscape, without concentrating on portraiture per se. Seeing the collection move to Australia will most hopefully see it being used by scholars of different disciplines so as to gain a better understanding of Indonesia, its closest neighbour, to their mutual and lasting benefit. The prospect of this happening made the parting of the collection a happy rather than dramatic event. I wish the National Gallery of Australia will long cherish the guardianship of this collection. Leo Haks, August 2007 36 national gallery of australia Museum and gallery curators obviously collect for their institutions and apply scholarship to their cataloguing and in presenting works to the public, but they are rarely out there in the junk shops or collectibles auctions or eBay and most often buy through reputable dealers, major auctions and private collectors. Collectors, in turn, vary from the highly intuitive, who rarely write or talk about their collections, to people who are great experts involved in scholarly publications and exhibitions. -

Desa Lingga, a Karo Village in North Central Sumatra 1
Running Head: DESA LINGGA, A KARO VILLAGE IN NORTH CENTRAL SUMATRA 1 The Destruction and Preservation of a Rainforest, a Culture, and its Vernacular Architecture: Desa Lingga, a Karo Village in North Central Sumatra Barbara J. Anello-Adnani Author Note Barbara J. Anello-Adnani is an Independent Scholar Independent Scholar with affiliations to Pratt Institute, IEP, CEP, and Assistant Professor, School of Design and Architecture, Dar al Hekma Univesity, KSA. This research was accomplished with support from, the Fulbright Scholar Program, Southeast Asia Regional Research Program in Art History, Council for the International Exchange of Scholars, Washington D.C., 2008, and in cooperation with, the World Monuments Fund, New York, 2012-15, Badan Warisan Sumatra (Sumatra Heritage Trust), Medan, St. Thomas University, Medan, and The Prince Claus Fund for Culture and Development, Amsterdam. Correspondence concerning this article should be addressed to Barbara J. Anello-Adnani, 119 Sullivan St, New York, NY 10012 USA. Contact: [email protected] Running Head: DESA LINGGA, A KARO VILLAGE IN NORTH CENTRAL SUMATRA 2 Short Abstract The preservation of intangible culture, architectural heritage, and the natural environment are linked in the restoration of traditional structures in Lingga, a Karo village in Sumatra. Managing the dynamics of change in a crisis environment requires multifaceted, local and international alliances. Abstract In North Central Sumatra issues of climate change, deforestation, habitat destruction, and species loss interface directly with the declining state of traditional built forms and intangible culture in a globalized present. Cultural, aesthetic, economic, and historical values coalesce around questions of heritage preservation, architectural and environmental protection, development, ownership, stewardship, and use of resources. -

Intonation in Relation to Syntax in Indonesian
PACIFIC LINGUISTICS Series D - No. 36 INTONATION IN RELATION .TO SYNTAX IN INDONESIAN by Amran Halim (MATERIALS IN LANGUAGES OF INDONESIA, No. 5) W. A. L. Stokhof, Series Editor Department of Linguistics Research School of Pacific Studies THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY Halim, A. Intonation in relation to syntax in Indonesian. D-36, viii + 156 pages. Pacific Linguistics, The Australian National University, 1981. DOI:10.15144/PL-D36.cover ©1981 Pacific Linguistics and/or the author(s). Online edition licensed 2015 CC BY-SA 4.0, with permission of PL. A sealang.net/CRCL initiative. PACIFIC LINGUISTICS is issued through the Linguistic Circle of Canberra and consists of four series: SERIES A - Occasional Papers SERIES B - Monographs SERIES C - Books SERIES D - Special Publications EDITOR: S.A. Wurm ASSOCIATE EDITORS: D.C. Laycock, C.L. Voorhoeve, D.T. Tryon, T.E. Dutton EDITORIAL ADVISERS: B.W. Bender John Lynch University of Hawaii University of Papua New Guinea David Bradley K.A. McElhanon La Trobe University University of Texas A. Capell H.P. McKaughan University of Sydney University of Hawaii S.H. Elbert P. Mtlhlhliusler University of Hawaii Linacre College, Oxford K.J. Franklin G.N. O'Grady Summer Institute of Linguistics University of Victoria, B.C. W.W. Glover A.K. Pawley Summer Institute of Linguistics University of Auckland G.W. Grace K.L. Pike University of Michigan; University of Hawaii Summer Institute of Linguistics M.A.K. Halliday E.C. Polom� University of Sydney University of Texas A. Healey Gillian Sankoff Summer Institute of Linguistics University of Pennsylvania L.A. -

The Knickerbocker Weekly and the Netherlands Information Bureau: A
The Knickerbocker Weekly and the Netherlands Information Bureau: A Public Diplomacy Cooperation During the 1941-1947 Era Charlotte Kok 3229513 MA Thesis, American Studies Program, Utrecht University 24 June 2011 Kok 2 Table of Contents Introduction ................................................................................................................................ 3 1. History of the Netherlands Information Bureau .............................................................. 9 2. History of The Knickerbocker Weekly ....................................................................... 18 3. The portrayal of bilateral political relations in The Knickerbocker Weekly .......... 32 4. The portrayal of bilateral economic relations in The Knickerbocker Weekly .... 55 5. The portrayal of bilateral cultural relations in The Knickerbocker Weekly .... 66 Conclusion .......................................................................................................... 81 Works Cited .................................................................................................... 86 Kok 3 Introduction After the outbreak of World War II and the defeat of the Dutch forces in the Netherlands, the Dutch government in exile recognized the importance of public diplomacy to support its foreign policy. The government established the Netherlands Information Bureau (NIB), the official Dutch press agency, in New York City in the summer of 1941. The bureau‟s main task was to inform the American public about the close relationship between the