Cramerleseprobe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Isaac Lawson, Physician and Naturalist Linnaeus’S Scottish Patron
E. Charles Nelson Isaac Lawson, Physician and Naturalist Linnaeus’s Scottish Patron n 19 December 1735 NS (8 December OS), Johan Frederik Gronovius Oand Isaac Lawson sent from Leiden a copy of Carl Linnaeus’s Systema naturae (1735) to Sir Hans Sloane explaining, in their jointly signed letter, that it has been “sent to the press at our own expense, with an intention to have a few copies; but at the request of several friends we have determined to communicate it fully (judging it might be agreeable to the Learned world. [)]”1 Ten days later, on 18 December 1735 OS, the English naturalist Mark Catesby (1683–1749) presented another copy that he also had received from Gronovius to the Royal Society in London.2 Whereas biographical accounts of Gronovius have been published, Lawson, who is frequently but inaccurately labelled as a botanist, and wrongly named as Andrew (Andry) or John (Johann), is not so well documented although he is accorded an entry (of about 170 words) in the Oxford dictionary of national biography.3 He is also often confused with John Lawson (c. 1674–1711), an English naturalist who explored Carolina in the early 1700s.4 Nor, indeed, has anyone ever questioned how a fellow student from Scotland, only a few years older than Linnaeus, could undertake to fi nance the publication of the Swedish naturalist’s fi rst publication. Lawson family No record of Isaac Lawson’s birth or baptism can be traced in Scottish pa- rochial archives so his year of birth can only be approximated. When his name was inscribed in the “Album Studiosorum” -

Djvu Document
BULL. BOT. SURV. INDIA VoL 21, Nos. 1-4 : pp. 35-67, 1979 COMMEMORATIVE GENERIC NAMES OF FLOWERING PLANTS IN INDIA Botanical Surq of India, Howrah ABSTRACT Commemorative generic names of plants are given in honour of well known botanists and patrons of science for the contributions they made for the cause of botany. The names are given in alphabetical order with their families and one example under each gcnw. A brief biographical sketch of the person is also given. Plants named after botanists and eminent persons form one continuous historical sequence in the development of Natural history. INTRODUCTION In 1867 Alphonse de Candolle, son of A. P. Naming of plants and animals using two- De Candolle with his legal background first word names is as old as human civilization proposed the rules of nomenclature in "Lois and is commonly seen in all languages. In de la Nomenclature Botanique" (1867). In I 753 Carl ~innaeusin his Species Plantarum the Vienna botanical congress (Igo j), these consistently used the two-word system in rules were officially designated as "Interna- Latin for about 5900 Linnean specific epi- tional Rules of Botanical Nomenclature" and thets which was hailed as the binomial since 1952 it is called as "International Code system of nomenclature. In the 18th of Botanical Nomenclature" Plant names century in Europe, Latin was the accepted named after botanists and eminent persous language of scholarship and common form one continuous historical sequence in medium of communication cutting across the development of Natural history. Gen- national boundaries. According to the eric names are given in alphabetical order rules of naming mostly botanical generic and under the first genus Abelia R. -
THE MEANINGS and SYNONYMS of PLUMBAGO. by JOHNW
TRANSACTTONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY, V. -THE MEANINGS AND SYNONYMS OF PLUMBAGO. By JOHNW. EVANS,LL.B., D.Sc., Adviser in Geology and Mineralogy to the Imperial Institute. [Read at the Jfedtiizg of the Philological Society oia January 11, 1907.1 HAYINGbeen consulted by Dr. Murray on the history of the word plumbago’ in connection with the Oxford Dictionary of the English Language on Historical Principles, I gave some attention to the subject, and my interest carried me further than I had originally intended. The main conclusions at which I arrived will be found in the article on that word in the dictionary, but the limits within which it was necessarily compressed did not permit of the presentation of many of the facts disclosed, and at Dr. Murray’s kind suggestion I have communicated the present paper to this Society. I have endeavoured, as far as possible, to exclude matters of purely mineralogical or metallurgical interest, except so far as they have a direct bearing on the subject of the paper, but it will be found that the variations in the use of the words with which I deal reflect in a remarkable manner the changing fortunes of the arts and sciences in the centuries covered by the survey. I have only attempted to follow the history of the word plumbago ’ and its synonyms so far as they relate to minerals or metallurgical products. The botanical aspects of the subject lie beyond my province. I had not completed my investigations when the portion of the dictionary which included the word ‘plumbago’ went to press, and in some cases I have since found earlier instances of the use of words than those which will be found in its pages. -
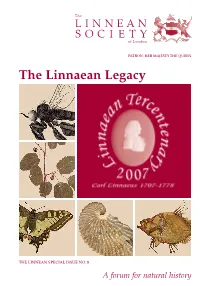
Linnaeus Legacy Pt 1 Web 08-07-08.P65
THE LINNEAN SPECIAL ISSUE No. 8 The Linnaean Legacy: Three Centuries after his Birth Part 1: Unlocking the Past Part 2: Botanical Art in the Age of Linnaeus Part 3: Today and the Future edited by Mary J. Morris and Leonie Berwick 2 THE LINNEAN SPECIAL ISSUE NO 8 WILEY-BLACKWELL 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ Special Issue No. 8 of The Linnean Newsletter and Proceedings of the Linnean Society of London ISSN 0950-1096 © 2008 The Linnean Society of London Burlington House, Piccadilly, London W1J 0BF www.linnean.org Charity Reference No. 220509 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. The designations of geographic entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the publishers, the Linnean Society, the editors or any other participating organisations concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. THE LINNAEAN LEGACY: THREE CENTURIES AFTER HIS BIRTH 3 The Linnaean Legacy: Three Centuries after his Birth Contents Foreword David Cutler 5 Part 1 – Unlocking the Past Commemoration Speech Carl-Olof Jacobson 9 The Keen Eye: Linnaeus – The Man Who Saw Everything Karin Berglund 13 Linnaeus: An 18th Century Background Marie-Christine Skuncke 19 What’s -
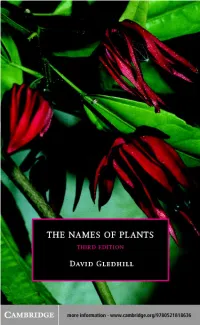
The Names of Plants, Third Edition
THE NAMES OF PLANTS The Names of Plants is a handy, two-part reference book for the botanist and amateur gardener. The book begins by documenting the historical problems associated with an ever-increasing number of common names of plants and the resolution of these problems through the introduction of International Codes for both botanical and horticultural nomenclature. It also outlines the rules to be followed when plant breeders name a new species or cultivar of plant. The second part of the book comprises an alphabetical glossary of generic and specific plant names, and components of these, from which the reader may interpret the existing names of plants and construct new names. For the third edition, the book has been updated to include explanations of the International Codes for both Botanical Nomen- clature (2000) and Nomenclature for Cultivated Plants (1995). The glossary has similarly been expanded to incorporate many more commemorative names. THE NAMES OF PLANTS THIRD EDITION David Gledhill Formerly Senior Lecturer, Department of Botany, University of Bristol and Curator of Bristol University Botanic Garden Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge , United Kingdom Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9780521818636 © Cambridge University Press 2002 This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provision of