Landschaftsqualitätsprojekt Imboden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Zurich, July 16, 2018 NHESS-2017-446
Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering Institute of Construction and Infrastructure Management ETH Zurich Jürgen Hackl PhD Candidate IBI - HIL, Room F 23.1 Stefano-Franscini-Platz 5 8093 Zurich, Switzerland Phone +41 44 633 65 10 Fax +41 44 633 10 88 [email protected] www.ibi.ethz.ch Zurich, July 16, 2018 NHESS-2017-446 - response to the reviewers’ comments for the manuscript: Estimating network related risks: A methodology and an application in the transport sector Dear Prof. Dr. Fuchs and reviewers, Thank you very much for considering our manuscript for possible publication in the Journal of Natural Hazards and Earth System Sciences. We appreciate your careful review of the manuscript and the well structured constructive feedback received. Please find our response below that includes descriptions of the resulting changes in the manuscript. The changes made can be found attached to this commentary. We trust that these changes have improved the work, making it suitable for publication in your journal. We are looking forward to your response. General response to all reviewers’ comments Based on the feedback received, we identified three major areas of concern. 1. The use of an unconventional paper structure The initial idea was to show readers three times the proposed process, each time at a different level of detail: the generic methodology, the application of the methodology, and the modelling. This approach led to the reuse of section headings in some cases and a scattered literature review. We agree with the reviewers that this presentation can cause confusion. Therefore, to improve its readability, we restructured our manuscript as follows: (a) (1. -

Punt Ruinaulta Vorderhein, Switzerland
Punt Ruinaulta Vorderhein, Switzerland Type of building: Bridge Architect: Walter Bieler AG, Bonaduz www.swiss-architects.com Project link: www.rheinschlucht.ch © own work, Punt Ruinaulta nach Norden, CC BY-SA 3.0 The suspension bridge located in Vorderhein, canton Grisons enables pedestrians and cyclists to cross the Rhine. The Rhine Gorge in Grisons is one of the most majestic and diverse landscapes in the Alps. Surrounded by a lot of lakes and a diversity of wildlife and vegetation the gorge is a very popular destination for hikers, cyclists and canoers. Punt Ruinaulta connects the Swiss communities Trin and Bonaduz and is 105 m long with a span of 75 m. The bridge architecture blends in with the landscape due to its clear design and was awarded for its wood construction. Due to the local conditions the bridge was constructed as a two-span beam without any supporting pillars placed in the river. The construction consists of two concrete pylons and a suspension rope. Prefabricated Stremaform® was used to create the gap within the main pylon which simplified the concreting process. MAX FRANK spacers and distance tubes were also supplied for this project. Source: EGCO Magazin edition 3, 2014 German Case Study: Punt Ruinaulta Products used Punt Ruinaulta Max Frank GmbH & Co. KG | Mitterweg 1 | 94339 Leiblfing | Phone: +49 9427 189 - 0 | Fax: +49 9427 1588 [email protected] | www.maxfrank.com Punt Ruinaulta Vorderhein, Switzerland Formwork elements for Fibre concrete spacers Fibre concrete distance tubes working joints Stremaform® © own work, Punt Ruinaulta nach Norden, CC BY-SA 3.0 © own work, Punt Ruinaulta von Osten, CC BY-SA 3.0 Punt Ruinaulta Max Frank GmbH & Co. -

Graubünden for Mountain Enthusiasts
Graubünden for mountain enthusiasts The Alpine Summer Switzerland’s No. 1 holiday destination. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden © Andrea Badrutt “Lake Flix”, above Savognin 2 Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden 1000 peaks, 150 valleys and 615 lakes. Graubünden is a place where anyone can enjoy a summer holiday in pure and undisturbed harmony – “padschiifik” is the Romansh word we Bündner locals use – it means “peaceful”. Hiking access is made easy with a free cable car. Long distance bikers can take advantage of luggage transport facilities. Language lovers can enjoy the beautiful Romansh heard in the announcements on the Rhaetian Railway. With a total of 7,106 square kilometres, Graubünden is the biggest alpine playground in the world. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden. CCNR· 261110 3 With hiking and walking for all grades Hikers near the SAC lodge Tuoi © Andrea Badrutt 4 With hiking and walking for all grades www.graubunden.com/hiking 5 Heidi and Peter in Maienfeld, © Gaudenz Danuser Bündner Herrschaft 6 Heidi’s home www.graubunden.com 7 Bikers nears Brigels 8 Exhilarating mountain bike trails www.graubunden.com/biking 9 Host to the whole world © peterdonatsch.ch Cattle in the Prättigau. 10 Host to the whole world More about tradition in Graubünden www.graubunden.com/tradition 11 Rhaetian Railway on the Bernina Pass © Andrea Badrutt 12 Nature showcase www.graubunden.com/train-travel 13 Recommended for all ages © Engadin Scuol Tourismus www.graubunden.com/family 14 Scuol – a typical village of the Engadin 15 Graubünden Tourism Alexanderstrasse 24 CH-7001 Chur Tel. +41 (0)81 254 24 24 [email protected] www.graubunden.com Gross Furgga Discover Graubünden by train and bus. -

Switzerland 4Th Periodical Report
Strasbourg, 15 December 2009 MIN-LANG/PR (2010) 1 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES Fourth Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter SWITZERLAND Periodical report relating to the European Charter for Regional or Minority Languages Fourth report by Switzerland 4 December 2009 SUMMARY OF THE REPORT Switzerland ratified the European Charter for Regional or Minority Languages (Charter) in 1997. The Charter came into force on 1 April 1998. Article 15 of the Charter requires states to present a report to the Secretary General of the Council of Europe on the policy and measures adopted by them to implement its provisions. Switzerland‘s first report was submitted to the Secretary General of the Council of Europe in September 1999. Since then, Switzerland has submitted reports at three-yearly intervals (December 2002 and May 2006) on developments in the implementation of the Charter, with explanations relating to changes in the language situation in the country, new legal instruments and implementation of the recommendations of the Committee of Ministers and the Council of Europe committee of experts. This document is the fourth periodical report by Switzerland. The report is divided into a preliminary section and three main parts. The preliminary section presents the historical, economic, legal, political and demographic context as it affects the language situation in Switzerland. The main changes since the third report include the enactment of the federal law on national languages and understanding between linguistic communities (Languages Law) (FF 2007 6557) and the new model for teaching the national languages at school (—HarmoS“ intercantonal agreement). -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

Summer in Chur
Summer in Chur Chur Cableways: In summer you can enjoy wonderful hikes, the Alpenbikepark with 5 mountain biking freeride routes, spectacular enduro tours, fun descents with scooter & Co. and several cosy mountain restaurants. Bathing & Swimming: The spacious outdoor swimming pool at the Obere Au and the historic outdoor pool Sand in the city centre provide welcome cooling down on hot days. Those who prefer swimming in the midst of the magnificent natural scenery of Graubünden will find several beautiful mountain lakes around Chur. Guided Tours & City Walks: The oldest city in Switzerland and important episcopal centre has many a story to tell. Centuries of history have shaped and left their mark on this place of transit. Immerse yourself in the past and experience Chur in a variety of ways. The most personal approach is, of course, with our highly knowledgeable tour guides. Audio Guide: Chur Tourism's Audio Guide enables you to explore the city under your own steam using your mobile phone or MP3 player. Its 32 chapters contain all manner of interesting information about the history and culture of both the Alpine city of Chur and the holiday canton of Graubünden. You can find your way around by following a clearly designed map and at each place of attraction you simply select the relevant chapter. Climbing: There are many climbing areas in Graubünden: Prättigau, Puschlav, Bergell or Mesolcina. Chur offers you the possibility to set off in all directions depending on the weather. The Haldenstein climbing garden and the Pinut via ferrata are in close proximity to the Alpine City. -

Geschäftsbericht 2008
1 Geschäftsbericht 08 2 Bilder Die Fotografien in diesem Geschäfts- bericht entstanden bei Kunden des ew tamins. Sie zeigen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Energie und den spannenden Unternehmer-Mix im Einzugsgebiet. Herzlichen Dank allen Beteiligten für die Unterstützung und die Erlaubnis. Titelseite: Abfüllanlage Rhäzüns Feldschlösschen Getränke AG Rückseite: Metallbearbeitung Freymatic AG 3 Auf einen Blick Organe der Gesellschaft 4 Generalversammlung 6 Protokoll 8 Jahresbericht 2008 Vorwort des VR-Präsidenten 10 Gründung Trianel Suisse AG 12 Strommarktöffnung 13 Energiebeschaffung 13 Sponsoring 14 Markt und Kunden 14 Netzbetrieb 16 Mess- und Kontrollwesen 19 Haustechnik 20 Services 21 Organisation 22 Jahresrechnung Energiekennzahlen 23 Bilanz 24 Erfolgsrechnung 25 Anhang zur Jahresrechnung 26 Revisionsbericht 27 4 Organe der Gesellschaft Verwaltungsrat Markus Feltscher, Felsberg, Präsident Christian Demarmels, Bonaduz, Vizepräsident Rino Caduff, Ilanz Gion Jörg, Domat/Ems Armin Meier, Tamins Rudolf Oertle, Rhäzüns Christoph Widmer, Felsberg Sekretär Verwaltungsrat Max Erni-Liesch, Felsberg Personalvorsorge-Kommission Markus Feltscher, Felsberg, Präsident Christian Demarmels, Bonaduz Max Erni-Liesch, Felsberg, Sekretär Andreas Willi, Domat/Ems Revisionsstelle BMU Treuhand AG, Chur Geschäftsleitung Theo Joos, Domat/Ems, Vorsitzender der Geschäftsleitung Peter Casparis, Sils i.D., Leiter Haustechnik (bis 30.09.2008) Max Erni-Liesch, Felsberg, Leiter Services Sitz Elektrizitätswerk Tamins AG Reichenauerstrasse 33 Postfach 30 7015 Tamins Telefon: 081 650 22 50 Fax: 081 650 22 59 E-Mail: [email protected] Internet: www.ewtamins.ch 5 Produktions-Roboter Hamilton Bonaduz AG 6 Generalversammlung Die ordentliche 103. Generalver- 6. Entlastung des Verwaltungsrates sammlung wird einberufen auf Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Freitag, 5. Juni 2009, um 18.00 Uhr Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen. -

MARKTBERICHT 2021 Wissenswertes Zum Immobilienmarkt
MARKTBERICHT 2021 Wissenswertes zum Immobilienmarkt Region Imboden (ex. Flims/Trin) Wohneigentum bleibt gefragt Höchstpreise für Einfamilienhäuser Geringe Neubautätigkeit DIE REGION IM ÜBERBLICK 2021 Immobilienpreise (Bandbreiten) Attraktives Wohngebiet Einfamilienhäuser Gute Kaufkraft (in 1000 CHF pro m2) In den fünf Gemeinden zwischen Chur und der Region Viamala – Bonaduz, Domat/Ems, 12 Felsberg, Rhäzüns und Tamins – leben gut 17’000 Personen. Das steuerbare Medianeinkom- 10 men liegt zwischen CHF 35’000 in Rhäzüns und knapp CHF 40’000 in Felsberg. Damit wird der kantonale Durchschnitt von gut CHF 33’000 deutlich, der schweizweite Mittelwert von 8 CHF 37’000 teilweise übertroffen. Die gute Standortqualität, eine moderate Steuerbelas- 6 tung sowie die einfache Erreichbarkeit für die meist pendelnden Arbeitskräfte – vor allem in 4 der Region sowie Richtung Chur – tragen zur Attraktivität der fünf Wohnstandorte bei. Ins- gesamt erhöhte sich die Wohnbevölkerung in den letzten zehn Jahren in Domat/Ems und 2 Felsberg um mehr als 10%, in Bonaduz und Rhäzüns über 20%, während sie in Tamins stabil blieb. Fläsch Maienfeld Bonaduz Felsberg Tamins Fläsch Domat/Ems Rhäzüns Jenins Eigentumswohnungen Maienfeld Malans (in 1000 CHF pro m2) Preise für Wohnbauland 12 (Einfamilienhäuser, gehobene Lage) Landquart Landquart 10 Zizers Untervaz 2 In CHF pro m 8 Über 1300 Trimmis Haldenstein 6 1100–1300 Tamins Chur 900–1100 Felsberg 4 Unter 900 Domat/Ems 2 Bonaduz Rhäzüns Bonaduz Felsberg Tamins Domat/Ems Rhäzüns Preisanstieg bei Wohneigentum Erläuterung Die Transaktionspreise für Einfamilienhäuser liegen auf neuen Rekordwerten. Ausnahme ist der dynamische Markt in Bonaduz, wo die Höchstwerte nach einer kurzen Korrekturpha- se wieder in Reichweite liegen. Im Segment Eigentumswohnungen zeigte die Preisentwick- Teures Segment lung in allen Gemeinden bis vor wenigen Quartalen eine stetige Aufwärtsentwicklung. -

Graubünden Nummer 64 | November 2020 Pfarreiblatt Fegl Parochial Grischun | Bollettino Parrocchiale Grigione 2 Pfarreiblatt Graubünden | November 2020
GRAUBÜNDEN Nummer 64 | November 2020 PFARREIBLATT Fegl parochial grischun | Bollettino parrocchiale grigione 2 Pfarreiblatt Graubünden | November 2020 HELFEN MIT MESS- Editorial STIPENDIEN Foto: Atelier LE RIGHE GmbH Foto: Liebe Leserin Mess-Stipendien werden von «Kirche in Not (ACN)» an Lieber Leser hilfs bedürftige Priester in Osteuropa, Afrika, Asien und In dieser Ausgabe des «Pfarreiblatts» fin- Lateinamerika weitergeleitet. Für viele Priester sind den Sie eine Beilage von «Kirche in Not Mess- Stipendien die einzige Möglichkeit, ihren Lebens- (ACN)» zum Thema Mess-Stipenden. In unterhalt zu bestreiten. unserem Hauptartikel erfahren Sie anhand eines konkreten Beispiels aus Sierra Leone, In der heiligen Messe sind alle unsere grossen und kleinen Anliegen aufge- hoben. Sie wird in Gemeinschaft mit den Engeln, den Heiligen, den Seelen wie wichtig diese Mess-Stipendien für viele im Läuterungszustand und mit uns gefeiert. Priester auf der ganzen Welt sind. Schon die ersten Christen haben den Gottesdienst als eine Feier verstanden, Über die Plenarversammlung des Kantona- an der alle mitwirken. Es war üblich, dass die Gläubigen Brot, Wein und an- len Seelsorgerats Graubünden lesen Sie auf dere Gaben mitbrachten, sowohl für die Feier selbst als auch zum Unterhalt der Kirche und ihrer karitativen Verpflichtungen. Daraus hat sich der Brauch der Seite 4. Im Anschluss an die Sitzung der Mess-Stipendien entwickelt. beantwortete der Vorsitzende, Generalvikar Andreas Fuchs, einige Fragen zur Vergan- Gottes Gnade ist nicht käuflich Im Kirchenrecht steht, dass Gläubige bei einem Priester eine heilige Messe genheit und Zukunft des Kantonalen Seel- bestellen oder stiften können. Das heisst aber nicht, dass man sich eine hei- sorgerats Graubünden (S. 5). -

Training Programs Is Subject to Change Without Notice
HAMILTON Bonaduz AG INSTINCT V Software Training Introduction For more than 50 years, the name HAMILTON has been associated worldwide with uncompromised quality in precision fluid measuring products. Because of the dedicated nature of the products we supply, it is important to us that our clients have the opportunity to become fully conversant with the operation of our products. Our software training covers the needs of both laboratory operators and Assay programmers. Our courses do follow an established generic structure, suitable for a variety of clients. Additionally, HAMILTON offers customized training courses which can be tailor-made to meet the specific needs of a customer. All training courses combine theoretical knowledge with practical challenges to give the trainee a comprehensive understanding of the course content. We are looking forward to welcome you in Bonaduz and share our knowledge with you! Important notice The content of these training programs is subject to change without notice. Every effort has been made to ensure the accuracy of this manual’s content. Should any errors be detected, HAMILTON Bonaduz AG would greatly appreciate being informed of them. The above notwithstanding, HAMILTON Bonaduz AG can assume no responsibility for any errors in this brochure, or for changes to training dates or the consequences thereof. 2 Basic and Customized INSTINCT V Software Trainings HAMILTON Bonaduz offers different locations Course Material for the INSTINCT V software training. While Each participant will get access to relevant the scheduled courses take place in Bonaduz course materials including PowerPoint at the European HAMILTON headquarter, and presentations, challenges, demo assays, follow a given structure to deliver basic manuals, an installation of the current software content, it is also possible to arrange courses package and additional documentation. -
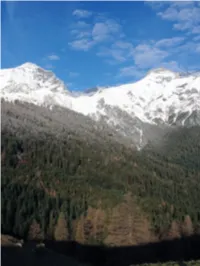
478 How to Balance Forestry and Biodiversity Conservation
How to balance forestry and biodiversity conservation – A view across Europe 478 Tamins – Forest management and the woods of a municipality in Switzerland M. Cathomen¹, M. Vanoni² C 23 ¹ Forest operation manager of Tamins, Tamins, Switzerland ² Division manager in protection forest and forest ecology, Office for forest and natural hazards Chur, Switzerland Location and overview mountain. The Kunkels Pass (1357 m a.s.l.) leads to Vättis in the municipality of Pfäfers in the canton of The municipality of Tamins is located in the Chur St. Gallen. The population of Tamins is around Rhine Valley in the canton of Grisons, Switzerland. 1200. Of the total area of 4084 ha, about 2100 ha is The village of Tamins (662 m a.s.l.) lies between the covered by forest. Large areas of the forest area are towns of Chur and Flims at the foot of the Calanda unproductive, but around 1400 ha is managed. The Switzerland Legend Municipal boundary of Tamins Forest enterprise Tamins N km 0 0,5 1 2 3 4 5 Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, N Robinson, NCEAS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, Esri, Airbus DS, Sources: the GIS User Community © OpenStreetMap contributors, and FAO, NOAA, USGS, Esri, HERE, Garmin, GIS user community; Sources: Intermap and the < Fig. C 23.1. Subalpine forest dominated by Norway spruce and European larch. The steep mountains range up to 3247 m a.s.l. and show a very representative mountain forest in Switzerland with a high topographical diversity and a complex and costly management situation (Photo: Mattiu Cathomen). -

Estimating the Risk Related to Networks: a Methodology and an Application on a Road Network Jürgen Hackl1, Juan Carlos Lam1, Magnus Heitzler2, Bryan T
Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., https://doi.org/10.5194/nhess-2017-446 Manuscript under review for journal Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discussion started: 2 January 2018 c Author(s) 2018. CC BY 4.0 License. Estimating the risk related to networks: a methodology and an application on a road network Jürgen Hackl1, Juan Carlos Lam1, Magnus Heitzler2, Bryan T. Adey1, and Lorenz Hurni2 1Institute of Construction and Infrastructure Management, ETH Zurich, 8092 Zurich, Switzerland 2Institute of Cartography and Geoinformation, ETH Zurich, 8092 Zurich, Switzerland Correspondence to: Jürgen Hackl ([email protected]) Abstract. Networks, such as transportation, water, and power, are critical lifelines to society. Managers plan and execute in- terventions to guarantee the operational state of their networks under various circumstances, including after the occurrence of (natural) hazard events. Creating an intervention program demands knowing the probable consequences (i.e., risk) of the vari- ous hazard events that could occur to be able to mitigate their effects. This paper introduces a methodology to support network 5 managers in the quantification of the risk related to their networks. The method emphasizes the integration of the spatial and temporal attributes of the events that need to be modeled to estimate the risk. This work then demonstrates the usefulness of the methodology through its application to design and implement a risk assessment to estimate the potential impact of flood and mudflow events on a road network located in Switzerland. The example includes the modeling of (i) multiple hazard events, (ii) their physical and functional effects throughout the road network, (iii) the functional interrelationships of the affected objects 10 in the network, (iv) the resulting probable consequences in terms of expected costs of restoration, cost of traffic changes, and duration of network disruption, and (v) the restoration of the network.