In Kleines Ein 2Froße§
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Masterarbeit / Master Thesis
MASTERARBEIT / MASTER THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the master thesis Memory, Ethics and Dark Tourism - The contested historical heritage of Anlong Veng District, Cambodia Verfasser / Author Gisela Wohlfahrt angestrebter akademischer Grad / acadamic degree aspired Master (MA) Wien, den 31.08.2010 Studienkennzahl : A 067 805 Studienrichtung: Individuelles Masterstudium: Global Studies – A European Perspective Betreuer/Supervisor: Ao.Univ.-Prof. Dr. Sigfried Mattl Abstract The purpose of the present thesis, “Memory, Ethics and Dark Tourism”, was to investigate to what extent a contested heritage site like Anlong Veng, the last stronghold of the genocidal Pol Pot regime in Cambodia, can be experienced as a dark tourist destination worth visiting. It was attempted to show, that a proper assessment of morally questionable sites such as Anlong Veng can only be reached if the meaning of such sites for the affected themselves is taken into consideration. Finally, it was intended to examine how far the site is able to reach its overall objective to foster the reconciliation process in Cambodia in the meantime. The research was conducted by means of interdisciplinary and qualitative methods. With the aid of Critical Discourse Analysis (CDA) five internet travel weblogs have been analyzed regarding the experiences of international visitors on site. The qualitative research data consisted of five in-depth interviews with experts in the field of reconciliation and remembrance, conducted in Phnom Penh, Cambodia. The results revealed that moral concerns are justified and also that the site is experienced as not worth visiting by international tourists. However, it was also discovered that Western perceptions of morality and proper heritage management are not applicable to the Cambodian context, as well as that the contested site can be in a metaphorical sense very valuable for Cambodians themselves. -

Carex Barrattii Schwein
New England Plant Conservation Program Conservation and Research Plan Carex barrattii Schwein. & Torr. Barratt's Sedge Prepared by: Penelope C. Sharp Environmental Consultant Northford, Connecticut For: New England Wild Flower Society 180 Hemenway Road Framingham, MA 01701 508/877-7630 e-mail: [email protected] • website: www.newfs.org Approved, Regional Advisory Council, May 2001 SUMMARY Barratt’s sedge (Carex barrattii) is a regionally rare plant species that ranges from Alabama northward along the Atlantic coastal states to Connecticut. Primarily a species of the Atlantic Coastal Plain, it has also been documented at a number of disjunct sites in Virginia, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia, and Alabama. Its presence in New England is limited to Connecticut where there are seven occurrences, five of which are historic. The two extant sites for C. barrattii are in relatively close proximity, and the occurrences may be considered to be sub-populations of a single population. Population size is estimated to exceed 10,000 ramets. The state rank for the species is S1, and it is listed under Connecticut’s Endangered Species Act as State Endangered. The occurrence locations are on private property; therefore, C. barrattii is vulnerable to a number of potential threats including alteration of wetland hydrology and development activities. Natural succession and canopy closure also threaten the species, which appears to produce few fruiting culms under dense shade. Carex barrattii is an obligate wetland species and, in Connecticut, grows in seasonally saturated, acidic, sandy wetlands. In other parts of its range, it is found in wetland depressions in pine barrens, along the shores of rivers and ponds or in peaty bogs. -

MUSIK – Nicht Nur Von RICHARD STRAUSS
MUSIK – nicht nur von RICHARD STRAUSS ____________________ KATALOG NR. 471 Inhaltsverzeichnis Nr. 1-462 Noten Nr. 463-480 Karl Böhm Nr. 481-740 Bücher Nr. 741-882 Sammelstücke MUSIKANTIQUARIAT HANS SCHNEIDER D 82327 TUTZING Es gelten die gesetzlichen Regelungen der Bundesrepublik Deutschland. Alle Angebote sind freibleibend. Preise einschließlich Mehrwertsteuer in Euro (€). Meine Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug zahlbar. Falls Zahlungen nicht in Euro lauten, bitte ich, die Bankspesen in Höhe von € 10.– dem Rechnungsbetrag hinzuzufügen. Versandkosten zu Lasten des Empfängers. Begründete Reklamationen bitte ich innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware geltend zu machen. (Keine Ersatzleistungspflicht). Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Teile Sitz der Lieferfirma. Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB. Die angebotenen Werke befinden sich in gutem Erhaltungszustand, soweit nicht anders vermerkt. Unwesentliche Mängel (z. B. Namenseintrag) sind nicht immer angezeigt, sondern durch Preisherabsetzung berücksichtigt. Über bereits verkaufte, nicht mehr lieferbare Titel erfolgt keine separate Benachrichtigung. Mit der Aufgabe einer Bestellung werden meine Lieferbedingungen anerkannt. Format der Bücher, soweit nicht anders angegeben, 8°, das der Noten fol., Einband, falls nicht vermerkt, kartoniert oder broschiert. ABKÜRZUNGEN: S. = Seiten Pp. = Pappband Bl. (Bll.) = Blatt Kart. = Kartoniert Aufl. = Auflage Brosch. = Broschiert Bd. (Bde.) = Band (Bände) d. Zt. = der Zeit Diss. = Dissertation besch. = beschädigt PN = Platten-Nummer verm. = vermehrt VN = Verlags-Nummer hg. = herausgegeben Abb. = Abbildung bearb. = bearbeitet Taf. = Tafel Lpz. = Leipzig Ungeb. = Ungebunden Mchn. = München o. U. = ohne Umschlag Stgt. = Stuttgart O = Originaleinband Bln. = Berlin des Verlegers Ffm. = Frankfurt/Main Pgt. (Hpgt.) = (Halb-)Pergament o. O. = ohne Verlagsort Ldr. (Hldr.) = (Halb-)Leder o. V. = ohne Verlagsangabe Ln. (Hln.) = (Halb-)Leinen BD = Bibliotheksdublette Köchel6 = Köchel 6. -

The Lieder of Richard Strauss
Central Washington University ScholarWorks@CWU All Master's Theses Master's Theses 1969 The Lieder of Richard Strauss Gary Dwight Welch Central Washington University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.cwu.edu/etd Part of the Musicology Commons Recommended Citation Welch, Gary Dwight, "The Lieder of Richard Strauss" (1969). All Master's Theses. 1244. https://digitalcommons.cwu.edu/etd/1244 This Thesis is brought to you for free and open access by the Master's Theses at ScholarWorks@CWU. It has been accepted for inclusion in All Master's Theses by an authorized administrator of ScholarWorks@CWU. For more information, please contact [email protected]. THE LIEDER OF RICHARD STRAUSS A Covering Paper Presented to the Graduate Faculty Central Washington State College In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts by Gary Dwight Welch July, 1969 ~iltu!G•ll N\ '3mqswua ~00}1103 ~·is U0\1tUNRM J'li108J AJVJ<{n ~ 1111~s ,S" h (YJ I~ '/~~S' 01 APPROVED FOR THE GRADUATE FACULTY ________________________________ John DeMerchant, COMMITTEE CHAIRMAN _________________________________ Wayne S. Hertz _________________________________ Joseph S. Haruda CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC presents in GARY D. WELCH, Baritone VIVIENNE ROWLEY JOHN DeMERCHANT, pianists PROGRAM Ru ggiero Leoncavallo ........ .... " Prologue" to Pagliacci II Richard Strauss Allerseelen Traum durch die Dammerung Stiindchen Die Nacht Cacilie INTERMISSION Ill Nicholas Flagella ............. .. ...... ........ .............. .. ........ ... ..... .. .The Land The Eagle The Owl The Snowdrop The Throstle Flower in the Cranny IV Giuseppe Verdi ..... .... ... ......... ...... .. .................. ... ... E'Sogno? f rom Falstaff Sidney Homer.. ... ...... ................. ..... .... ....... ... .. .. ........ .. .The Pauper's Drive Jean Sibelius ... ........ .... ..... .. ................. ..... ... ....... .. .......... Come Away Death Howard Hanson ..... .. .. .. .... .. .aOh , 'Tis n Earth Defiled from Merry Mount Myron Jacobson . -

SCMS Repertoire List Through 2021 Winter Festival
SEATTLE CHAMBER MUSIC SOCIETY REPERTOIRE LIST, 1982–2021 “FORTY YEARS OF BEAUTIFUL MUSIC” James Ehnes, Artistic Director Toby Saks (1942-2013), Founder Adams, John China Gates for Piano (2013) Arensky, Anton Hallelujah Junction for Two Pianos (2012, 2017W) Piano Quintet in D major, Op. 51 (1997, 2003, 2011W) Road Movies for Violin and Piano (2013) Piano Trio in D minor, Op. 32 (1984, 1990, 1992, 1994, 2001, 2007, 2010O, 2016W) Aho, Kalevi Piano Trio in F minor, Op. 73 (2001W, 2009) ER-OS (2018) Quartet for Violin, Viola and Two Celli in A minor, Op. 35 (1989, 1995, 2008, 2011) Albéniz, Isaac Six Piéces for Piano, Op. 53 (2013) Iberia (3 selections from) (2003) Iberia “Evocation” (2015) Arlen, Harold Wizard of Oz Fantasy (arr. William Hirtz) (2002) Alexandrov, Kristian Prayer for Trumpet and Piano (2013) Arnold, Malcolm Sonatina for Oboe and Piano, Op. 28 (2004) Applebaum "Landscape of Dreams" (1990) Babajanian, Arno Piano Trio in F sharp minor (2015) Andres, Bernard Narthex for Flute and Harp (2000W) Bach, Johann Sebastian “Aus liebe will mein Heiland sterben” from St. Matthew Passion BWV 244 Anderson, David (for flute, arr. Bennett) (2019) Capriccio No. 2 for Solo Double Bass (2006) Brandenburg Concerto No 3 in G major, BWV 1048 (2011) Four Short Pieces for Double Bass (2006) Brandenburg Concertos (Complete) BWV 1046-1051 (2013W) Capriccio “On the Departure of a Beloved Brother” in B flat major, BWV 992 Anderson, Jordan (2006) Drafts for Double Bass and Piano (2006) Chaconne, from Partita for Violin in D minor, BWV 1004 (1994, 2001, 2002) Choral Preludes for Organ (Piano) (Selections) (1998) Anonymous (arr. -

BENNY GOLSON NEA Jazz Master (1996)
1 Funding for the Smithsonian Jazz Oral History Program NEA Jazz Master interview was provided by the National Endowment for the Arts. BENNY GOLSON NEA Jazz Master (1996) Interviewee: Benny Golson (January 25, 1929 - ) Interviewer: Anthony Brown with recording engineer Ken Kimery Date: January 8-9, 2009 Repository: Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution Description: Transcript, 119 pp. Brown: Today is January 8th, 2009. My name is Anthony Brown, and with Ken Kimery we are conducting the Smithsonian National Endowment for the Arts Oral History Program interview with Mr. Benny Golson, arranger, composer, elder statesman, tenor saxophonist. I should say probably the sterling example of integrity. How else can I preface my remarks about one of my heroes in this music, Benny Golson, in his house in Los Angeles? Good afternoon, Mr. Benny Golson. How are you today? Golson: Good afternoon. Brown: We’d like to start – this is the oral history interview that we will attempt to capture your life and music. As an oral history, we’re going to begin from the very beginning. So if you could start by telling us your first – your full name (given at birth), your birthplace, and birthdate. Golson: My full name is Benny Golson, Jr. Born in Philadelphia, Pennsylvania. The year is 1929. Brown: Did you want to give the exact date? Golson: January 25th. For additional information contact the Archives Center at 202.633.3270 or [email protected] 2 Brown: That date has been – I’ve seen several different references. Even the Grove Dictionary of Jazz had a disclaimer saying, we originally published it as January 26th. -

IG FÜR Zeitung RZ.Indd
1 DIE ZEITUNG NEUES VON DER INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR GESUNDE LEBENSMITTEL e. V. NR. 2/2017 Große Bildergalerie IG FÜR Jubiläum Wohlbefi nden als Zielgröße im Vertrieb ab Seite 10 Umstritt enes TTIP-Abkommen: Die Folgen des Handelspakts für den Lebensmitt elbereich Seite 12 Nachhalti ges Handeln Seite 16 Die Rett ung der Schwäbisch-Hällischen Schweinerasse ab Seite 18 2 Inhalt Briefe an die Redaktion Briefe an die Redaktion ................. 2 Lieber Georg, (...) Die Interessengemeinschaft für gesunde Lebensmittel leistet eine sehr wertvolle Grußwort ….….….….….….….….….…... 3 Arbeit. Ich kenne die Initiative nun schon seit vielen Jahren und ich bin froh, dass sie sich so sehr für die Gesundheit engagiert. Dabei geht es um viele wichtige Fragen, die Unsere neuen viele in der Branche nur am Rande wahrnehmen. Bisphenol, Glyphosate, Gentechnik IG FÜR Mitglieder ….….….….….….…. 3 und viele andere Themen, deren Wichtigkeit vielen von uns durchaus bewusst ist. Den meisten unserer Mitstreiterinnen und Mitstreiter fehlt es allerdings an der Zeit, sich mit diesen Themen wirklich zu beschäftigen. Dies gilt im eigenen Tagesgeschäft, im Hinblick 20-jähriges Jubiläum der IG FÜR ... 4 auf die gesellschaftliche Diskussion und erst recht beim Engagement in der Politik. Hier schließt die Interessengemeinschaft eine bedeutende Lücke. Sie greift Themen auf, Die Jubiläumsfeier in Bildern ........ 6 die sonst vielleicht unbeachtet ihrer möglichen Schäden ihren Weg gehen würden. Sie stellt Fragen und geht den Dingen auf den Grund. Und Sie richtet sich an die rich- Wohlbefinden als tigen Menschen, an Meinungsführer, Multiplikatoren und Entscheidungsträger. Und Zielgröße im Vertrieb .................. 10 die IG FÜR hat ein Gesicht. IG FÜR ohne Georg Sedlmaier, das ist unvorstellbar. Er ist bescheiden in seiner Erwartung, aber sehr beharrlich in seinem Engagement. -

47Th SEASON PROGRAM NOTES Week 2 July 21–27, 2019
th SEASON PROGRAM NOTES 47 Week 2 July 21–27, 2019 Sunday, July 21, 6 p.m. The marking for the first movement is of study at the University of California, San Monday, July 22, 6 p.m. unusual: Allegramente is an indication Diego, in the mid-1980s that brought a new more of character than of speed. (It means and important addition to his compositional ZOLTÁN KODÁLY (1882–1967) “brightly, gaily.”) The movement opens palette: computers. Serenade for Two Violins & Viola, Op. 12 immediately with the first theme—a sizzling While studying with Roger Reynolds, Vinko (1919–20) duet for the violins—followed by a second Globokar, and Joji Yuasa, Wallin became subject in the viola that appears to be the interested in mathematical and scientific This Serenade is for the extremely unusual song of the suitor. These two ideas are perspectives. He also gained further exposure combination of two violins and a viola, and then treated in fairly strict sonata form. to the works of Xenakis, Stockhausen, and Kodály may well have had in mind Dvorˇ ák’s The second movement offers a series of Berio. The first product of this new creative Terzetto, Op. 74—the one established work dialogues between the lovers. The viola mix was his Timpani Concerto, composed for these forces. Kodály appears to have been opens with the plaintive song of the man, between 1986 and 1988. attracted to this combination: in addition and this theme is reminiscent of Bartók’s Wallin wrote Stonewave in 1990, on to the Serenade, he wrote a trio in E-flat parlando style, which mimics the patterns commission from the Flanders Festival, major for two violins and viola when he was of spoken language. -

6 X 10.Long.P65
Cambridge University Press 978-0-521-02774-8 - Richard Strauss: Man, Musician, Enigma Michael Kennedy Index More information index Aagard-Oestvig, Karl, 196, 212 Annunzio, Gabriele d’, 175, 187 Abendroth, Walther, 290–1 Arnim, Achim von, 103, 202 Adam, Adolphe, 105 Artôt de Padilla, Lola, 193 Adler, Guido, 295 Aschenbrenner, Carl, 19, 27 Adler, Hans, 374 Asow, Dr Erich Müller von, 18, 347 Adolph, Dr Paul, 262, 285, 298, 299 Astruc, Gabriel, 144 Adorno, Theodor, on R.S., 224 Auber, Daniel, 16–17, 32, 48, 130, 316, 366 Ahlgrimm, Isolde, 353 Audibert, Comte d’, 368 Ahna, Major General Adolf de (father-in- law), 58, 81–3 Bach, Johann Sebastian, 4, 128, 395; Well- Ahna, Mädi de (sister-in-law), 81–2 Tempered Clavier, 15 Ahna, Maria de (mother-in-law), 58 Baden-Baden, 28 Ahna, Pauline de. See Strauss, Pauline Bahr, Hermann, 96, 199, 231, 341; works Aibl, Joseph, 34, 109 on R.S. libretto, 196 Albert, Eugen d’, 32, 56 Bakst, Léon, 186 Albert, Hermann, 328 Bantock, Sir Granville, 284 Allen, Sir Hugh, 312 Bärmann, Carl, 20 Allgemeiner Deutscher Musikverein, 73, Barrymore, Lionel, invites R.S. to 108, 153, 306 Hollywood, 372–3 Allgemeine Musikzeitung, 33, 62, 290 Basile, Armando, 381 Altenberg, Peter (Richard Englander), 148 Bayreuth, 8, 26, 47, 54, 55, 57, 60, 61, 68, Alvary, Max, 68 83, 85, 86, 143, 281, 287; R.S. first Alwin, Carl, 94, 212, 222, 224, 238, 255, conducts at, 78; R.S. conducts Parsifal 256, 329 at, 276–7; Pauline sings at, 66, 78 Ampico (piano rolls, Chicago 1921), 406 Beardsley, Aubrey, 148 Amsterdam. -
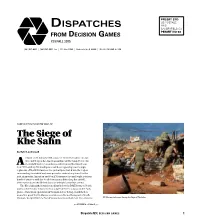
The Siege of Khe Sahn by Kyle Lockwood
PRESRT STD US POSTAGE DISPATCHES PAID BAKERSFIELD CA PERMIT NO 66 FROM DECISION GAMES #29 FALL 2015 (661) 587-9633 | (661) 587-5031 fax | P.O. Box 21598 | Bakersfield CA 93390 | DECISIONGAMES.COM SAMPLE FROM MODERN WAR #21 The Siege of Khe Sahn by Kyle Lockwood t dawn on 21 January 1968 a wave of North Vietnamese troops descended upon the American airbase at Khe Sahn. For weeks A the airfield had come under sporadic fire and bombardment from NVA artillery. US intelligence had been reporting that multiple regiments of North Vietnamese troops had penetrated into the region surrounding the airfield and were poised to strike at any time. For the next six months, American and South Vietnamese troops fought a vicious battle of attrition with the North Vietnamese defending the airfield, and nearly caused the United States to unleash its nuclear arsenal. The Khe Sahn airfield was located just below the DMZ between North and South Vietnam. It had served as a Special Forces outpost in the early phase of American operations in Vietnam before being established as an anchor point for US Marine operations in the northern part of South Vietnam. In April 1967 the North Vietnamese launched their first offensive US Marines take cover during the Siege of Khe Sahn. continued on page 3 » Dispatch #29 | DECISION GAMES 1 2015-2016 ARTICLE LINE-UP ❖ Battle of Nam Dong | Operation Musketeer | Armies & Strategies: Suez 1956 | East African Insurgencies | China’s Liaoning Aircraft Carrier | Iraqi Army vs. ISIS | Matador Missiles Red Dragon Falling | Battle of Chinese -

SW LA Begegnung Strauss and Others
Sarah Wegener, soprano Götz Payer, piano Begegnung… Wegener explores the depths of the soul and lets her marvellously radiant voice, as powerful as it is rich in colour, and calm, perfectly balanced vibrato glide over the water conjured up by pianist Götz Payer, which at times delicately sparkles, at others swells powerfully like waves. FAZ 2017 – zur CD „Into the deepest sea“, CAvi 8553374 Following their first recording „Into the deepest sea“ Sarah Wegener and Götz Payer are in the studio again for their next Lied CD in cooperation with SWR and CAvi. Praised as a specialist for Strauss, especially for her concerts with the London Philharmonic Orchestra under Vladimir Jurowski as well as the Bavarian Radio Symphony Orchestra under Mariss Jansons in 2019, it was only logical to focus on a Strauss programme this time, to be released in summer 2021. CD Programme Cäcilie Breit’ über mein Haupt Ständchen Leises Lied Traum durch die Dämmerung Ruhe, meine Seele Glückes genug Zueignung Das Rosenband Befreit Die erwachte Rose Die Georgine Heimliche Aufforderung Allerseelen Begegnung Freundliche Vision Die Verschwiegenen Die Nacht Gefunden Waldseligkeit Winterweihe Morgen Rote Rosen Song Recital A selection of Strauss songs can be amended and combined with songs by e.g. Schubert, Schumann, Korngold, Reger, A. Mahler, Marx, Zemlinsky, R. Quilter and others. We will be happy to send individually tailored proposals upon request. Wegener [proved that she is a very a fine ] Straussian, with a warm tone, and a telling yet understated way with words, which enabled her to suggest both the cool sensuality of "Freundliche Vision", and the vulnerability of "Allerseelen". -

Download Program Notes
Select Songs Franz Schubert and Richard Strauss n the refined, jewel-like genre of the Lied, bert’s lifetime a few composers were creat - Ithe German art song, the name of Franz ing symphonic arrangements of songs orig - Schubert stands indisputably at the top of a inally written for voice and piano. Most of list that would wend through the 19th cen - these early arrangers are little known today, tury and into the 20th, encompassing such but by the 1860s famous names such as eminences as Schumann, Mendelssohn, Berlioz, Liszt, and Brahms were adding to Brahms, Wolf, Mahler, and Richard Strauss. the repertoire. The set of songs heard in this Matthias Goerne has assembled a set of songs concert affords a glimpse of how gifted by the first and last of those figures, who, in composers paid tribute to Schubert and the classic tradition of the Lied, originally Strauss by adapting their songs to the evolv - crafted their songs for voice with piano. ing orchestral aesthetics of their own Songs with full orchestral accompani - times, as well as to how Strauss crafted ment flourished in the later 19th century, symphonic versions of some songs he had the contributions of Strauss and Mahler originally composed with accompaniments being exemplary — but already in Schu - by piano alone. An Silvia, D.891 Des Fischers Liebesglück, D.933 Greisengesang, D.788 Franz Schubert Born: January 31, 1797, in Liechten thal, then a suburb of Vienna, Austria, now part of the city Died: November 19, 1828, in Vienna Works composed and premiered: An Silvia was composed in early July 1826, and Des Fischers Liebesglück in November 1827; premieres unknown, as Schubert songs were typically unveiled at private gatherings in Vienna, with the composer as piano accompanist to solo vocalists; Alexan - der Schmalcz’s orchestrations were introduced on April 25, 2015, at the Great Hall of the Vienna Musikverein, by the Vienna Symphony Orchestra, Philippe Jordan, conductor, Matthias Goerne, baritone .