Handout VCV W -P-3-42-14
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ludwig Von Hofmann Im Weimarer Kreis
Die Verheissung der Tänzerin Ruth St. Denis : Ludwig von Hofmann im Weimarer Kreis Autor(en): Wintsch, Susann Objekttyp: Article Zeitschrift: Georges-Bloch-Jahrbuch des Kunsthistorischen Instituts der Universität Zürich Band (Jahr): 5 (1998) PDF erstellt am: 10.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-720086 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Susann Wintsch Die Verheissung der Tänzerin Ruth St. Denis Ludwig von Hofmann im Weimarer Kreis 1. Die kunstkritische Abwertung der Malerei Ludwig von Hofmanns: Julius Meier- 1 Meier-Graefe, Julius, Entwicklungsgeschichte Graefe widmete im Jahr 1904 dem Maler Ludwig von Hofmann (1861—1945) in seinem der modernen Kunst. -

A Survey of the Career of Baritone, Josef Metternich: Artist and Teacher Diana Carol Amos University of South Carolina
University of South Carolina Scholar Commons Theses and Dissertations 2015 A Survey of the Career of Baritone, Josef Metternich: Artist and Teacher Diana Carol Amos University of South Carolina Follow this and additional works at: https://scholarcommons.sc.edu/etd Part of the Music Performance Commons Recommended Citation Amos, D. C.(2015). A Survey of the Career of Baritone, Josef Metternich: Artist and Teacher. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/3642 This Open Access Dissertation is brought to you by Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. A SURVEY OF THE CAREER OF BARITONE, JOSEF METTERNICH: ARTIST AND TEACHER by Diana Carol Amos Bachelor of Music Oberlin Conservatory of Music, 1982 Master of Music University of South Carolina, 2011 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of Musical Arts in Performance School of Music University of South Carolina 2015 Accepted by: Walter Cuttino, Major Professor Donald Gray, Committee Member Sarah Williams, Committee Member Janet E. Hopkins, Committee Member Lacy Ford, Senior Vice Provost and Dean of Graduate Studies ©Copyright by Diana Carol Amos, 2015 All Rights Reserved. ii ACKNOWLEDGEMENTS I gratefully acknowledge the help of my professor, Walter Cuttino, for his direction and encouragement throughout this project. His support has been tremendous. My sincere gratitude goes to my entire committee, Professor Walter Cuttino, Dr. Donald Gray, Professor Janet E. Hopkins, and Dr. Sarah Williams for their perseverance and dedication in assisting me. -

Der Menschensammler Bismarck, Rathenau, Rilke, Maillol, Josephine Baker – Harry Graf Kessler Kannte Sie Alle
Kultur KULTURGESCHICHTE Der Menschensammler Bismarck, Rathenau, Rilke, Maillol, Josephine Baker – Harry Graf Kessler kannte sie alle. Der Museumsleiter, Mäzen, Diplomat und Autor regte den „Rosenkavalier“ an und druckte traumhaft schöne Bücher. Seine Tagebücher entfalten eindrucksvoll das Panorama einer Epoche. Gedanken, die was wert sind, wollen Jahrzehnte steigert sich seine Kunst bis zur Einen Händedruck vom US-Präsidenten nicht begriffen sondern erlebt sein. Perfektion. Eine Momentaufnahme vom und Gletschertouren bei Sankt Moritz, ei- Harry Graf Kessler, Mai 1896 Februar 1926 in Berlin: „Ich fuhr also zu nen Blick von der Cheopspyramide und Vollmoeller in seinen Harem am Pariser Nächte in kanadischen Blockhütten, die ie ein „grosser schöner Hund, ein Platz und fand dort … zwischen einem hal- Festspiele in Oberammergau und ein Anti- Bernhardiner“, blickt der Mann ben Dutzend nackter Mädchen auch Miß semitentreffen in Berlin („das Hauptresul- Wauf dem Sofa. Und wie ein Hund Baker, ebenfalls bis auf einen rosa Mull- tat war ein ziemliches Bier-Besäufnis“), gibt er Pfötchen: „Die Finger sind auffal- schurz völlig nackt.“ Josephine Baker, die Opiumhöhlen – plus Kostprobe – in Shang- lend lang und fein gebildet; nur die Farbe er zum ersten Mal sieht, „tanzte mit äu- hai und ein Gespräch mit Cosima Wagner, fast leichenhaft. Er sieht Einen fest und ßerster Groteskkunst und Stilreinheit…So der Herrin von Bayreuth: Das hat schon lange an; Irres ist im Blick Nichts.“ müssen die Tänzerinnen Salomos und Tut- der 25-Jährige hinter sich. Von Helsingör Harry Graf Kessler trifft den geistes- ench-Amuns getanzt haben. Sie tut das bis Syrakus, von Tokio bis zum Sankt- kranken Friedrich Nietzsche. Sprechen stundenlang scheinbar ohne Ermüdung, Lorenz-Strom kennt er die Welt und wird kann der „Gott ist tot“-Denker, den seine immer neue Figuren erfindend wie im doch nicht müde, sie erkennen zu wollen. -

Associació Wagneriana. Apartat Postal 1159. 08080 Barcelona Http
WAGNERIANA CATALANA Nº 37 ANY 2012 TEMA 4: BAYREUTH, FAMÍLIA WAGNER, PROTECTORS TÍTOL: HISTÒRIA DELS FESTIVALS DE BAYREUTH EL NOU BAYREUTH, 1951-1969 CAPÍTOL I AUTOR: Josep Mª. Rota Aleu Es coneix per Nou Bayreuth el període de festivals que arrenquen a partir de 1951, després de la postguerra, i els immediatament posteriors. Si sobre la data d'inici no hi ha cap discussió, no passa el mateix amb el final. Melodram, empresa pionera en l'edició dels enregistraments d'aquesta època (junt amb Cetra i Foyer) va editar-ne una col·lecció que abastava des de 1951 a 1962, dotze festivals. La data es pot allargar fins a 1965, any de la mort de Hans Knappertsbusch o 1966, any de la mort de Wieland Wagner, per citar els dos pilars dels festivals; si comptem la participació dels cantants de l'època, podem allargar fins a 1969, darrera actuació de Josef Greindl i Hans Hotter o 1970 darrer festival de Wolfgang Windgassen; a tot estirar, 1975, darrera actuació de Gustav Neidlinger. Tots el llistats amb els repartiments provenen de la font oficial que dóna la pàgina www.bayreuyher-festspiele.de. Totes les fotografies provenen d'internet; la majoria, com és el cas dels retrats dels cantants, provenen de la pàgina suara citada. 1951 l'any 1944, amb la guerra ja perduda per a Alemanya, el Festival va obrir les portes i va oferir 12 funcions de Meistersinger. Acabat el Festival, es van fer A previsions per a l'estiu següent. No va ser el cas. Alemanya va capitular el 7 de maig. -

Wertvolle Bücher Abendauktion
WERTVOLLE BÜCHER ABENDAUKTION 6. Juli 2020 499. AUKTION Wertvolle Bücher Manuskripte · Autographen Auktion Aufgrund der allgemeinen Maßnahmen und gesetzlichen Vorgaben zur Pandemie-Bekämpfung bitten wir um vorherige Terminvereinbarung für Ihre Buchbesichtigung Montag, 6. Juli 2020 hier in unseren Räumen! 12.30 h Los 150 – 575 Wertvolle Bücher Ob am Auktionstag eine persönliche Beteiligung im 17.00 h Los 1 – 101 Wertvolle Bücher – Abendauktion Auktionssaal möglich ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Wir bitten Sie daher in jedem Fall um vorherige Kontaktaufnahme! Vorbesichtigung | Preview Telefonisch: 040 37 49 61-14 oder per Mail: [email protected] Mo. – Fr. 29. Juni – 3. Juli 11 – 17 Uhr So. 5. Juli 11 – 17 Uhr In line with legal guidelines and current measures taken against the spread of Covid-19 we kindly ask you to make an appointment for your preview at our premises! Ketterer Kunst Hamburg We will decide on short notice if participation in the saleroom will be possible on the day of the auction. We strongly advise you to contact us beforehand! Holstenwall 5 20355 Hamburg Phone: +49 40 37 49 61-14 Anfahrt siehe Lageplan hinten or per e-mail: [email protected] Vorderumschlag Kat.nr. 6 Karl IV., Bulla aurea. Straßburg 1485. Vorderes Vorsatz (doppelblattgr.) Kat.nr. 32 Peter Suhr, Panorama einer Reise von Hamburg nach Altona. Hamburg 1823. Frontispiz Kat.nr. 50 Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle of Population. London 1798. Vorletzte Seite Kat.nr. 92 Paul Éluard und Fernand Léger, Liberté j‘écris ton nom. Paris 1953. Hinteres Vorsatz (doppelblattgr.) Kat.nr. 64 Edoardo Cerillo, Dipinti murali di Pompei. -

Bibliothek Der Universität Kyoto Citation
Title ワイマール共和国時代の文献コレクション目録 Author(s) Bibliothek der Universität Kyoto Citation 京都大学附属図書館. (1983): 1-155 Issue Date 1983-03-19 URL http://hdl.handle. -

The Boston Wagner Society Presented Two Important Events in the Late Winter and Early Spring
Wagneriana Was frommt seine helle Schneide April–May 2006 ist der Stahl nicht hart und fest? Volume 3, Number 2 –Siegfried From the Editor March 26 Recital On March 26 the chapel at First Church of Boston was enchanting. And Brody’s expert accompaniment resounded with magnificent music making. Con- sounded more romantic than ever. The small audi- tralto Marion Dry and pianist Jeffrey Brody per- ence of about 21 people (only 5 of whom were mem- formed a full and unusual program consisting of bers of the BWS) was greatly appreciative of these songs by Wagner father and son, as well as Wag- talented musicians’ generous outpouring. By the end nerian operatic excerpts and Elgar’s Sea Pictures. of the concert, numerous smiling faces and satisfied Dry’s excellent musicianship, coupled with her im- expressions could be spotted. pressive range, terrific intonation, and colorful hues, Pianist Jeffrey Brody and Contralto Marion Dry at the March 26 recital I have followed Marion Dry’s career for many should be heard much more widely, particularly in years now, having heard her sing Erda about 10 the Wagnerian repertoire. She is a far better singer years ago. Even then I was delighted with her exper- than anyone the BSO could conjure up in recent tise and the ease with which she could sing Wagner. memory. Those who did not attend the March 26 re- And ever since, I have been hungry for more. The cital may have another chance to hear her (stay March 26 recital was so satisfying that it surpassed all tuned). -

Henry Van De Velde Year in Germany and Belgium: Part One
Jane Van Nimmen Henry van de Velde Year in Germany and Belgium: Part One Nineteenth-Century Art Worldwide 12, no. 2 (Autumn 2013) Citation: Jane Van Nimmen, “Henry van de Velde Year in Germany and Belgium: Part One,” Nineteenth-Century Art Worldwide 12, no. 2 (Autumn 2013), http://www.19thc- artworldwide.org/autumn13/van-nimmen-on-henry-van-de-velde-year-in-germany-and- belgium-part-one. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art. Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. Nimmen: Henry van de Velde Year in Germany and Belgium: Part One Nineteenth-Century Art Worldwide 12, no. 2 (Autumn 2013) Henry van de Velde Year in Germany and Belgium: Part One Honoring the 150th birthday of painter, architect, and designer Henry van de Velde, Google posted a celebratory doodle on April 3, 2013. It was not a global doodle like the glitzy Kiss commemorating Gustav Klimt, displayed around the world in 2012. The pastel tribute to van de Velde could be seen in only a handful of continental markets: Belgium, where he was born in 1863; France, where in 1884 the young painter studied for a few months in Paris with Carolus- Duran and where in 1895 he created three sensational rooms for Siegfried Bing’s new gallery L’Art Nouveau; Austria, where he showed furniture at the Eighth Vienna Secession exhibition in late 1900; Germany, where he lived with his wife and growing family from 1900 until 1917; the Netherlands, where he settled in the 1920s; and Switzerland, where he died in 1957. -
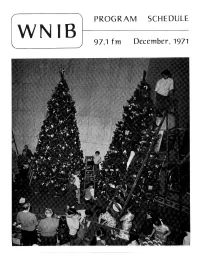
WNIB Program Schedule December 1971
u 1 , 1 The Advent Mode! 201 Tape Deck is, to our way of thinking, the ideal source for playing music in the home. It combines the important characteristics of a high-performance open-reel tape recorder with the convenience of cassettes. The Advent I Model 201 wit! make recordings that are indistinguishable from most source material, including the best stereo records and FM broadcasts. Of equal importance, the Mode! 201 realizes the full potential of the new "Dolbyized" commercially recorded cassettes, the most significant source I of recorded music since the introduc tion of the stereo disc. The best of the "Dolbyized" pre-recorded cas settes are easily the equivalent of the best disc recordings, and the number of releases will be continually in creasing. The Mode! 201 has the ruggedness and day-to-day operating dependability of the best home recorders, and wi!I maintain its original performance over long and constant use. $2 Beverly Near North Morton Grove Oak Park 2035 W. 95 th 48 E.Oak 5700 W Dempster 7045 W. North The performance of the Model 201 337-4\50 967-6690 38'.l-7006 is the result of several important departures in the design and manu 1\JfS()AY. WHJN(Sl)AY FRIDA.¥ & SATURDAY JOAM- 6 PM; MONDAY & THURSDAY 1D AM-9l'M facture of a cassette recorder. "Seigneur, dans votre main''; Louis BROQUET ''Beau Chevalier''; Otto BARBLAN "Hymne a la PROGRAM HEDUlE patrie"; Robert MERMOUD "Pour toi, pays"; Carlo HEMMERLING "0 petit pays"; Gustave DORET "Priere du Ruetli"; Carlo BOLLER I fm December, 1971 "Chant du drapeau"; Emile JAQUES-DALCROZE "Los Vieux11 ; Jean APOTHELOZ "Grand Guillau me"; Joseph BOVET "L'Alpee"; Hermann LANG "Mon pays, rustique sejour''; Henri PLUMHOF "La chanson des etoiles"; Joseph BOVET "La montee a l'alpage"; Gustave DORET "Le peuple des bergers" - Choeurs d'homrnes remands/ Andre Charlet (Swiss Composers CT 64-28) WNIB P rog-ram Schedule is published by Radio Station WNIB, 25 East Chestnut, Chicago, Illinois 60611. -

Decca Discography
DECCA DISCOGRAPHY >>V VIENNA, Austria, Germany, Hungary, etc. The Vienna Philharmonic was the jewel in Decca’s crown, particularly from 1956 when the engineers adopted the Sofiensaal as their favoured studio. The contract with the orchestra was secured partly by cultivating various chamber ensembles drawn from its membership. Vienna was favoured for symphonic cycles, particularly in the mid-1960s, and for German opera and operetta, including Strausses of all varieties and Solti’s “Ring” (1958-65), as well as Mackerras’s Janá ček (1976-82). Karajan recorded intermittently for Decca with the VPO from 1959-78. But apart from the New Year concerts, resumed in 2008, recording with the VPO ceased in 1998. Outside the capital there were various sessions in Salzburg from 1984-99. Germany was largely left to Decca’s partner Telefunken, though it was so overshadowed by Deutsche Grammophon and EMI Electrola that few of its products were marketed in the UK, with even those soon relegated to a cheap label. It later signed Harnoncourt and eventually became part of the competition, joining Warner Classics in 1990. Decca did venture to Bayreuth in 1951, ’53 and ’55 but wrecking tactics by Walter Legge blocked the release of several recordings for half a century. The Stuttgart Chamber Orchestra’s sessions moved from Geneva to its home town in 1963 and continued there until 1985. The exiled Philharmonia Hungarica recorded in West Germany from 1969-75. There were a few engagements with the Bavarian Radio in Munich from 1977- 82, but the first substantial contract with a German symphony orchestra did not come until 1982. -

Johannes R. Becher: Vom Münchner Schüler Zum Expressionisten
, 1 8. APR. 1988 AUS nFM"A-NTWy»AfcTAT 1988 3 Herausgeber: DR. KARL H. PRESSLER, RÖMERSTRASSE 7, 8ooo MÜNCHEN 40 ISSN 0343-186 X München - Beiträge zur Literatur, Buchkunst und Bibliophilie LITERATEN, KUNSTLER Michael Reiter SAMMLER, LESER, ANTIQUARE UND VERLAGE City of Beer and Books. Thomas Wolfe und München A 106 Werner Bodenheimer Eberhard Dünninger Bachmairs >Bücherhirt<. Ludwig Steub (1812-1888). Eine wenig bekannte Zu Leben und Werk eines Bibliophilenzeitschrift aus bayerischen Schriftstellers des München A 146 19. Jahrhunderts A 74 ANSICHTSKARTEN, STADTFÜHRER, SPIELKARTEN Resi-Annusch Dust Organisierte Bibliophilie Hans Ries in München. Ein kurzer Dilettantismus als Kunstform. historischer Überblick A 155 Franz Graf Pocci als Illustrator A 81 Adolf Kugler Münchner Ansichtskarten. Anmerkungen zu ihrer Carl-Ludwig Reichert Rolf Selbmann. Geschichte AHO Versuche und Hindernisse Johannes R. Becher. Vom Carls auf seinen Kreuz- und Münchner Schüler zum Querzügen durch die Expressionisten A 85 Antiquariate Münchens A 158 Ludwig Hollweck Stadtführer geleiten durch München A127 Hans-Dieter Holzhausen Noch mehr Münchner Annette Kolb, ihre Dichtungen Antiquariate A 163 und ihre anderen Schriften aus der Sicht eines Sammlers A 96 Hellmut Rosenfeld Das waren noch Preise . .! Fünfhundert Jahre Münchner (Ruth Steinbauer) A 163 Spielkarten. Von karten Heike Pressler spielenden Fürsten und Jakob Wassermanns literarische Königen zu Kartenspiel- Anfänge in München A 103 Königen A 134 IMPRESSUM A 164 Zu dieser Nummer Die bayerische Landeshauptstadt ist in den kommenden Metropole als eine der großen und bedeutenden Verlags Tagen Schauplatz der >Buchhändlertage 1988< mit einer städte der Welt unserer Tage nicht nur heute leuchtet, Vielzahl von Veranstaltungen rund um das Buch. Als - sondern auch gestern auf dem Gebiet der Buchkunst, wie wir hoffen - bleibender Beitrag dazu erscheint diese Literatur und Bibliophilie in hellem Lichte lag. -

The Cultivation of Class Identity in Max Beckmann's
THE CULTIVATION OF CLASS IDENTITY IN MAX BECKMANN’S WILHELMINE AND WEIMAR-ERA PORTRAITURE by Jaclyn Ann Meade A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Art History MONTANA STATE UNIVERSITY Bozeman, Montana April 2015 ©COPYRIGHT by Jaclyn Ann Meade 2015 All Rights Reserved ii TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION……...................................................................................................1 2. BECKMANN’S EARLY SELF-PORTRAITS ...............................................................8 3. FASHION AND BECKMANN’S MANNERISMS .....................................................11 Philosophical Fads and the Artist as Individual .............................................................27 4. BECKMANN’S IDENTITY AND SOCIAL POLITICS IN HIS MULTIFIGURAL WORK ............................................................................................33 5. BECKMANN AND THE NEW OBJECTIVITY..........................................................45 BIBILIOGRAPHY ..........................................................................................................125 iii LIST OF FIGURES Figure Page 1. Max Beckmann, Three Women in the Studio, 1908 .............................................2 2. Max Beckmann, Die Nacht, 1918 ........................................................................3 3. Max Beckmann, Self-Portrait with a Cigarette, 1923 .........................................3 4. Max Beckmann, Here is Intellect, 1921 ..............................................................3