Novembre 2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Mystery of Fr-Bn Copte 13 and the “Codex St.-Louis”: When Was a Coptic Manuscript First Brought to Europe in “Modern” Times?
Journal of Coptic Studies 6 (2004) 5–23 THE MYSTERY OF FR-BN COPTE 13 AND THE “CODEX ST.-LOUIS”: WHEN WAS A COPTIC MANUSCRIPT FIRST BROUGHT TO EUROPE IN “MODERN” TIMES? BY STEPHEN EMMEL The present investigation seeks to clarify statements in the secondary Coptological literature of the eighteenth and nineteenth centuries con- cerning the existence of a “Codex St.-Louis,”1 that is to say, a Coptic manuscript supposedly brought to Paris by Louis IX at the end of the Sixth Crusade in 1254.2 The Objects of Investigation (1) Bibliothèque Nationale de France (FR-BN), manuscript Copte 13. A beautifully illustrated Tetraevangelium (the four Gospels) in Bohairic Coptic, copied and illuminated between 1178 and 1180 by Michael, 1 So called by René-Georges Coquin in correspondence between us in the early 1990s. 2 Most of the basic research for this investigation was done a little over a decade ago, and I now take the occasion of the Eighth International Congress of Coptic Studies (Paris, June/July 2004, with an accompanying exhibition titled “Pages d’une autre Égypte: les manuscrits des Coptes” planned by the Bibliothèque Nationale de France to include the manuscript in question, Copte 13) to report it. I owe special debts of gratitude for assis- tance of one sort and another to Anne Boud’hors, Jacques Debergh, Michel Garel, Iris Hinerasky, and Bentley Layton. To Dr. Boud’hors I am indebted for the following obser- vation (made in a letter dated 21 March 1991), which eventually altered the course of my thinking on this topic decisively: “Finalement je me demande si tout cela n’est pas une légende, et si ce manuscrit [le “Codex St.-Louis”] n’est pas le Copte 13 (qui aurait pu passer par l’Oratoire?). -

Alexandre GADY
CURRICULUM VITAE Alexandre GADY Né le 1er avril 1968 à Versailles (78) Adresse privée : 54, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris 01.42.23.86.78 / 06.62.60.74.55 Adresse professionnelle : Galerie Colbert (bureau 220) 2, rue Vivienne 75002 01 47 03 85 29 Courriel : [email protected] CURSUS HONORUM 2008 Habilitation à diriger les recherches : « Architecture à l’époque moderne et patrimoine. De l’hôtel parisien au grand style français ». Université de Paris-IV Sorbonne, dir. Claude Mignot. 2001 Doctorat d’histoire de l’art : « Jacques Lemercier, architecte et ingénieur du Roi (avant 1586-1654) ». Université François-Rabelais, Tours, dir. M. Claude Mignot. Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 1992 Diplôme d’études approfondies d’histoire de Paris. École pratique des Hautes Études (IVe section), dir. Michel Fleury. 1990 Maîtrise d'histoire. Université de Paris-IV Sorbonne, dir. Jean Tulard. ENSEIGNEMENTS Depuis 2017 Professeur invité d’histoire de l’architecture à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne Depuis 2012 Professeur d’histoire de l’art moderne à l’université Paris-Sorbonne 2009-2012 Professeur d’histoire de l’art moderne à l’université de Nantes Depuis 2007 Enseignant à l’École de Chaillot (DSA « Architecture et patrimoine ») 2005-2009 Maître de conférences à l’université Paris-IV Sorbonne 2000-2007 Chargé de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris 1995-2001 Enseignant à l’École du Louvre AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 2003-2005 Commissaire invité à la mission « -

L'oratoire Du Louvre
L’ORATOIRE DU LOUVRE : En quoi l’Oratoire du Louvre est-il un symbole d’une histoire religieuse capitale ? Comment permet-il de saisir le passage d’un lieu de culte catholique à un temple protestant ? A) Premiers regards : 1) Le site de l’Oratoire : Où l’Oratoire est-il implanté ? (quartier, bâtiments proches) :…………………………………………………………………… ………..…………………………………………………….…………………… Entoure l’Oratoire de rouge sur le plan du quartier, puis de bleu la partie du Louvre qui figure aussi là. De quand date le plan ? ……………. « le Père de Bérulle, cousin du chancelier Séguier, fonda en novembre 1611 la Congrégation française des Prêtres de l'Oratoire(…) Elle faisait partie du grand plan de la Contre-Réforme établi au Concile de Trente. En janvier 1616, les Oratoriens achetaient l'Hôtel du Bouchage, le faisaient démolir et commençaient la construction d'une chapelle où la messe fut célébrée dès le début du mois de mai. Cette chapelle s'avérant trop petite, le Cardinal de Bérulle voulut bâtir «une église en forme et qui eut plus de rapport avec la grandeur et la majesté divines». À cet effet, la congrégation acquit les terrains voisins et entreprit en 1621 la construction d'un nouveau sanctuaire sur les plans de l'architecte Jacques Lemercier (architecte 18è-plan-quartier-du-louvre-turgot jpg http://oratoire-du-louvre.fr/archit de l'église de la Sorbonne et de Saint-Roch). À la demande de Louis XIII, l'église devient chapelle royale (Brevet du 23 décembre 1623). » http://oratoire-du-louvre.fr http://www.oratoiredulouvre.fr/documents-histoire/photos.html 2) Vue d’ensemble : Ce bâtiment était-il une église paroissiale ? Faisait-il partie d’un monastère ? Justifie ta réponse : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. -

Île-De-France
Île-de-France The Protestants of Paris – Essonne – Eure-et-Loir - Hauts-de- Seine – Loiret - Seine-et-Marne – Seine-Saint-Denis – Val-de- Marne – Val-d’Oise – Yonne – Yvelines of the 16th and 17th centuries Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Île-de-France Archives nationales (France) www.archives-nationales.culture.gouv.fr Site de Pierrefitte-sur-Seine Archives nationales 59, rue Guynemer 900021 – 93383 Pierrefitte-sur-Seine 1 Tel : +33 1 75 47 20 02 Salle de lecture de Paris Archives nationales 11, rue des Quatre-Fils, 75003, Paris Tel : + 33 (0) 1 40 27 64 20 France Archives Protestant Registers Archives des consistoires – Églises réformées de France Archives nationales Inventaire – TT//230-TT//276/B Dates : 1317, 1446, 1520-1740 https://francearchives.fr/fr/findingaid/f6bc0cffa0190ca16c5495b42cd77365abd244ee FamilySearch.org France, registres protestants, 1536-1897 Dossiers des paroisses protestantes de France - Naissances, mariages, et décès – 39,994 images en ligne France Protestant Civil Registers, 1536-1897 Protestant Church Registers – Baptisms, marriages, deaths – 39,994 online images https://www.familysearch.org/search/collection/1582585 FamilySearch.org France, registres protestants de la Société de l’histoire du protestantisme français, 1562-1960 – 341 dossiers numériques. This collection contains records of French Protestants living in France, Germany, Switzerland from 1562 onward – 341 digitized dossiers https://www.familysearch.org/search/collection/1582585 https://www.familysearch.org/en/ 2 FranceGenWeb Guide des -

THE METHODIST CRISIS in NEUCHÂTEL, 1820-1830 David
Methodist History, 54:3 (April 2016) SHOULD THE METHODISTS GET ALL THE CREDIT? THE METHODIST CRISIS IN NEUCHÂTEL, 1820-1830 David Bundy On December 26, 1820, at the request of the “Class” or “Company of Pastors,” 1 the Conseil d’État (Council of State) of the Principality of Neuchâtel (then part of Prussia) agreed to intervene with all of its authority to quell any disturbances made by the Methodists. This carefully worded statement urged caution and wisdom on the part of the “Class” but promised support as needed. This is the text of the decision as ofcially recorded by the Council of State: The Council has taken into very serious consideration on various occasions petitions that have been addressed to it by the honorable Dean and Ministers of the Class about the unrest that has already been caused in this country, by a sect whose views appear to correspond with those of the English Methodists, and especially with one that at this time in Geneva functions under the name of New Church. The honorable Dean and Ministers of the Class added in these petitions the narrative of what they did to stop the unrest which it is, and they conclude by calling for the support of the Council’s authority and that of the luminaries to help reach the goal they propose, which is to maintain the established religion, and prevent that the Church from being divided by opinions that might excite more disorders of which the length and gravity are difcult to predict. It is in response to these petitions that the Commission an- nounces to the honorable Dean and -

President's Message
Autumn 2014 Inside This Issue President’s Message President’s Message 1 t was just a few months ago in July, in our world need Jim and Cindy Craig 2 2014 that we learned that our love and support in Note from AFCU Treasurer I beloved AFCU Board of Directors’ their new member, Jim Craig, had died of a brief communities. We New AFCU Members but devastating illness. He had been give to provide a Martin and Kate Luther 3 active as a member for many years after place where the Heritage Society 4 his years attending the American Church Word of God can Sister Church Support 5 in Paris. He was a tireless worker in his be proclaimed. We various AFCU roles, including President, give to be able to as he helped study issues, propose policy proclaim the Word of God to those who The Berlin Connection changes, develop vision and mission have never heard or who yearn to hear A Note from Pastor Steve 6 statements, and encourage giving of our the Good News. We give to be and to New Praise Band Leader 7 talents and resources to support our provide a beacon of Light in partner churches. We were additionally communities that need to witness God’s devastated and heartbroken when, only people at work. We give because Jesus The Paris Connection a few days later, his wife Cindy, left us taught us to be good and generous and went to join Jim and embark on stewards of our gifts and resources. We A Note from Pastor Scott 8-9 their new heavenly ventures. -
![Patrimoines Du Sud, 5 | 2017, « Les Patrimoines Du Protestantisme » [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Mars 2017, Consulté Le 12 Février 2021](https://docslib.b-cdn.net/cover/8443/patrimoines-du-sud-5-2017-%C2%AB-les-patrimoines-du-protestantisme-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-01-mars-2017-consult%C3%A9-le-12-f%C3%A9vrier-2021-5478443.webp)
Patrimoines Du Sud, 5 | 2017, « Les Patrimoines Du Protestantisme » [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Mars 2017, Consulté Le 12 Février 2021
Patrimoines du Sud 5 | 2017 Les patrimoines du Protestantisme The heritage of Protestantism Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/pds/1443 DOI : 10.4000/pds.1443 ISSN : 2494-2782 Éditeur Conseil régional Occitanie Référence électronique Patrimoines du Sud, 5 | 2017, « Les patrimoines du Protestantisme » [En ligne], mis en ligne le 01 mars 2017, consulté le 12 février 2021. URL : http://journals.openedition.org/pds/1443 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/pds.1443 Ce document a été généré automatiquement le 12 février 2021. La revue Patrimoines du Sud est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. 1 SOMMAIRE Dépasser le Désert : un parcours du patrimoine protestant en France Patrick Cabanel Un volume des principes d’analyse consacré au patrimoine protestant : publication prévue en 2017 Mireille-Bénédicte Bouvet Le temple de la Calade et la maison du consistoire de Nîmes Philippe Chareyre Le château et l’observatoire de Guillaume Le Nautonier (1560-1620), seigneur protestant de Castelfranc (Tarn) Adeline Béa La construction des temples dans le Gard par Charles-Étienne Durand au début du XIXe siècle, ou l’invention d’un temple néoclassique Josette Clier et Théodore Guuinic De la Vaunage à la Petite Camargue, un patrimoine protestant majeur Patricia Carlier Une architecture d’exception pour l’Église réformée de Ganges (Hérault) Yvon Comte La construction du temple protestant d’Albi en 1924 : pour une histoire matérielle, -
Séance 4 : PARIS AU XVII E SIECLE
Musée Carnavalet – Histoire de Paris. Dossier pédagogique Classes culturelles Histoire de France Paris au XVII e siècle Séance 4 : PARIS AU XVII e SIECLE Au XVII e siècle, les rois mènent une politique de grands travaux à Paris. Parallèlement, les nobles se font construire des hôtels particuliers qui suivent le programme architectural défini par le pouvoir royal. De plus, le souverain et ses courtisans font appel aux mêmes architectes qui développent l’art baroque puis l’art classique. Cela donne donc à la ville une certaine unité. Mais cette unité est bien le fruit d’une imitation par la société civile des modèles de la Cour, non d’une volonté délibérée et réfléchie de la part du pouvoir. On ne « pense » pas encore vraiment la Ville. Vivre à Paris au XVII e siècle implique un bon sens de l’orientation car seules quelques rues affichent leur nom gravé dans la pierre. De plus, Paris ne cesse d’attirer de nouveaux citadins et à la ville étroite et tassée du Moyen Age, se sont ajoutés de nouveaux quartiers. Ses 400 000 habitants y vivent comme à la campagne : ils ont des jardins en fond de cour où ils élèvent des poules, des cochons ou des lapins ! Tous les jours, les habitants des villages voisins de Belleville, Ivry, Vaugirard ou des Batignolles viennent travailler, s’approvisionner ou flâner à Paris. Toute la journée, la foule se presse autour des nombreuses échoppes et les rues retentissent des cris de Paris , poussés pour appâter les clients par les multiples camelots de la capitale. La rue Quincampoix dans les 3 e et 4 e arrondissements permet de se représenter l’aspect des rues aux XVIIe et XVIII e siècles : des rues étroites, très animées, au sol mal pavé, ce qui ne manque pas de secouer rudement les nobles et les riches bourgeois qui voyagent en carrosse, mais aussi ceux qui choisissent de faire le voyage en fiacre 1 ou en « vinaigrette »2. -
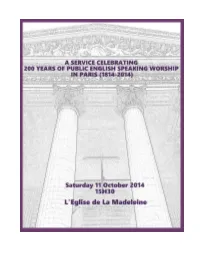
Service Bulletin for the Madeleine.Pdf
WELCOME TO THIS SERVICE OF WORSHIP CELEBRATING 200 YEARS OF PUBLIC ENGLISH SPEAKING WORSHIP IN PARIS The congregation’s spoken words are in bold and the sung words are in bold italics. Those who are able are invited to stand when you see this symbol. Please note: The service is being professionally videotaped. Kindly refrain from using phones, cameras or iPads to take photos or videos during the service. Thank you. ORGAN PRELUDE Toccata, Adagio and Fugue in C Major J.S. Bach Michel Geoffroy, organist WELCOME Père Bruno Horaist Eglise de la Madeleine Pasteur Marc Pernot L’Oratoire du Louvre (Translations by Mathilde Amouroux) CALL TO WORSHIP Felicia Henderson I was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord." Be joyful in the Lord, all you lands; Serve the Lord with gladness and come before his presence with a song. Enter his gates with thanksgiving; Go into his courts with praise; Give thanks to him, And call upon his Name. (All) I was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord." PROCESSION OF THE CLERGY (Please remain seated) The procession will be led by the Amercian Church Bronze Ringers and Members of the Académie Américaine de Danse de Paris. HYMN “From All That Dwell Below the Skies” tune: LASST UNS ERFREUEN LITANY OF CONFESSION AND ABSOLUTION Lord God, our maker and our redeemer, Michelle Wahila This is your world and we are your people: Come among us and save us. We have not loved you with all our heart, Gigi Oyog nor our neighbors as ourselves; In your mercy, Forgive us. -

Francis H. Smith in Europe, 1858. Full-Text, Letterbook #1
VMI Archives www.vmi.edu/archives Francis H. Smith Trip to Europe in 1858 Letterbook # 2 Transcribed, edited, and annotated by Col. Edwin L. Dooley, Jr. Masthead from The Illustrated London News, July 1858 Letter No. 21 Continued So that I may say good night to those so dear to me, whose memory is in my waking and in my dreaming thoughts – by day and by night – may the blessings of God rest upon you all forever. Tuesday morning July 20th It is one month to day since we landed at Liverpool. Time really does fly fast to those who have been so much on the push as we have been. To-day we all are going to Windsor Castle and Palace, one of the residences of Queen Vic. and the mausoleum of the later Kings and Princes. To morrow we contemplate, this is John Cocke and myself, a trip to Chester near Liverpool to a great Agricultural Fair, taken there by regard to John’s interest. In the meantime, I will dispatch this __________ four sheeted letter, and hope that in Seventeen days you will have the happiness of receiving it, and that it may find you all in the enjoyment of good health. You say nothing about your summer plans, but I suppose your next will give me the news. With affectionate love to all the children and remembrances to all friends I am as ever your own dear Husband Francis H Smith Mrs Sarah H. Smith Lexington VA Francis H. Smith in Europe, 1858. Letterbook #2 Page 1 VMI Archives www.vmi.edu/archives P.S. -

117 Année • N° 791 • 15 Juin
Église Réformée de l'Oratoire du Louvre • 145 rue Saint Honoré • Paris 1er 117 année y N° 791 y 15 juin - 15 septembre 2012 oratoiredulouvre.fr SOMMAIRE ÉDITORIAL ACTIVITES DE L’ORATOIRE Ô Dieu ! Je te chanterai un cantique Conférences, études bibliques 22 nouveau… par Marc Pernot 3 Assemblée du Désert 2012 23 DOSSIER NOUVELLES DE L’ORATOIRE L’orgue et le chant dans le culte 5 Restauration de l’Oratoire 24 La musique, élixir de vie. Orgue et formation 25 par James Woody 5 Journées du Patrimoine La spiritualité de Bach par I. Santesteban et A. Ducros 26 par Louis Pernot 7 Concerts spirituels (cantates) 27 A propos de Gustav Leonhardt Prédications chez vous 28 par GillesCastelnau 10 Point financier La place du chant dans le culte par F. Braunstein et A. Moynot 29 par C. Veillet Michelet 12 Nouvelles du secrétariat 30 Théodore de Bèze et Clément Marot Le parcours du pasteur Fath par Rose Marie Boulanger 15 par Ph. Vassaux 31 La musique anglicane La reine des Pays-Bas à l’Oratoire par Nicholas Burton Page 17 par Ch. Guttinger 32 L’AGENDA CARNET 35 Calendrier des cultes 19 Calendrier des activités 20 CONTACTS 36 Directeur de la publication Philippe Gaudin Comité de rédaction (la Feuille Rose) Pasteur Marc Pernot est le bulletin trimestriel Rose-Marie Boulanger de l’Association presbytérale de Pasteur James Woody l’Eglise Réformée de l’Oratoire du Jean-Luc Mouton Louvre (APEROL), Alphonse N’Goma 4 rue de l’Oratoire Secrétariat de rédaction 75001 Paris. Marc Pernot Merci de soutenir l’Oratoire Impression Promoprint par votre don, quel qu’il soit. -

1 the Protestants of Champagne-Ardenne of the 16Th
The Protestants of Champagne-Ardenne of the 16th and 17th centuries Modern-day Ardennes – Aube - Marne – Haute-Marne Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne Archives nationales (France) www.archives-nationales.culture.gouv.fr Site de Pierrefitte-sur-Seine Archives nationales 59, rue Guynemer 900021 – 93383 Pierrefitte-sur-Seine Tel : +33 1 75 47 20 02 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home Salle de lecture de Paris Archives nationales 11, rue des Quatre-Fils, 75003, Paris Tel : + 33 (0) 1 40 27 64 20 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home France Archives 1 Protestant Registers Archives des consistoires – Églises réformées de France Archives nationales > Inventaire – TT//230-TT//276/B Dates : 1317, 1446, 1520-1740 https://francearchives.fr/fr/findingaid/f6bc0cffa0190ca16c5495b42cd77365abd244ee http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home Protestant registers at the Archives départementales de France Série I – Protestant dossiers Série C – Intendances & subdélégations – Government appointees & subdelegations Série E – Familles - Families Archives période de 1685-1787 - Archives départementales de France Archives – Period of 1685-1787 – Archives départementales de France Série A: Acte du pouvoir souverain – Power of the Kings of France in regard to various judgments or laws issued by said Court of France (Kings) Textes réglementaires avec les édits du roi – Laws or official directives rendered by various kings of France Série B - Cours et juridiction