SWR2 Musikstunde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
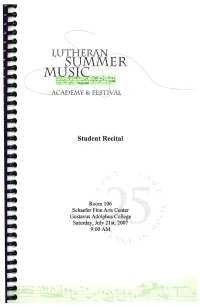
Student Recital
Student Recital Room 106 Schaefer Fine Arts Center Gustavus Adolphus College Saturday, July 21st, 2007 9:00:AM Program » Quintet Op. 77 in G Major Antonin Dvorak (1841-1904) Angela Xie, violin Julia Johnson, violin Elizabeth Johnson, violin Bjorn Hovland, cello Matt Minteer, bass Bourrie 1 from Suite 43 inC Major Johann Sebastian Bach (1685-1750) John Sholund, bass guitar . Preguntale a Las Estrellas Latin American Folk Song Arr, Edward Kilenyi Christine Hoffman, mezzo-soprano Galina Zisk, piano Intorno all’idol mio Marco Antonio Cesti z (1623-1669) Christine Mennicke, soprano Galina Zisk, piano a a i a We ask that all members of the audience refrain from photographing or recording the performance. Please be sure that a all cell phones, beepers, alarms, and similar devices are turned off. cm A high-fidelity recording of this performance may be ordered. A @ brochure will be available following the performance. = You are invited to attend the next events of a The 2007 Lutheran Summer Music Festival: = Student Recitals a Christ Chapel & Room 214, and Room 106 Schaefer Fine Arts Center = Gustavus Adolphus College = Saturday, July 21st, 2007 10:30 AM, 12:00 PM, and 2:30 PM | al Jazz Ensemble Concert Bjérling Recital Hall «a Schaefer Fine Arts Center e Gustavus Adolphus College Saturday, July 21st, 2007 ea 1:00 PM e Festival Orchestra Concert e Christ Chapel a Gustavus Adolphus College Saturday, July 21st, 2007 e 7:00 PM = e This concert is the thirty-eighth event of = Lutheran Summer Music Festival 2007 = = «a «= ee se «= LUTHERAN. UMIME Ro ~~__ACADEMY & FESTIVAL Collegium Musicum S. -

Conference Abstracts
Society for Seventeenth-Century Music A SOCIETY DEDICATED TO THE STUDY AND PERFORMANCE OF 17THCENTURY MUSIC Abstracts of Presentations at the Fifth Annual Conference 1013 April 1997, Florida State University, Tallahassee Index of Presentations Program and Abstracts Program Committee Index of Presentations: Candace Bailey, A Reassessment of Matthew Locke's Keyboard Suites Gregory Barnett, Corrente da piedi, Corrente da orecchie: Two Faces of the Sonata da camera Jennifer Williams Brown, "Innsbruck, ich muss dich lassen": Tracing Orontea's Footprints Joanna Carter, Selle as Music Tutor: A Model for Music Education at Lateinschulen in Northern Germany Stewart Carter, Instructions for the Violin from an Overlooked Source: Bartolomeo Bismantova's Compendio musicale (1677) Tim Carter, ReReading Poppea: Some Thoughts on Music and Meaning in Early Seventeenth Century Italian Opera Georgia Cowart, Carnival, Commedia dell'arte and the Paris Opéra in the Late Years of the Sun King Michael Robert Dodds, Transposition in OrganChoir Antiphony in the Mid and Late Seicento Frederick K. Gable, Eine so viel als die Andere: Rhythm and Tempo in SeventeenthCentury German Chant Beth L. Glixon, Vettor Grimani Calergi as Consumer and Patron of Opera Akira Ishii, ReEvaluation of Minoriten 725 as a Source for the Works of Johann Jacob Froberger YouYoung Kang, Revisiting SeventeenthCentury Counterpoint Kathryn Lowerre, The Sweets of Peace: Reconstructing and Interpreting Europe's Revels (London, 1697) Stephen R. Miller, On the Significance of 'Stile antico' Catherine Moore, Thundering Vortex: The 1631 Eruption of Vesuvius Commemorated in Madrigal Poetry Christopher Mossey, Characteristics of Roles and the Role of Character in Librettos by Giovanni Faustini Janet Pollack, Parthenia: The "Maydenhead of Musicke" as an Epithalamion Kerala J. -

Winged Feet and Mute Eloquence: Dance In
Winged Feet and Mute Eloquence: Dance in Seventeenth-Century Venetian Opera Author(s): Irene Alm, Wendy Heller and Rebecca Harris-Warrick Source: Cambridge Opera Journal, Vol. 15, No. 3 (Nov., 2003), pp. 216-280 Published by: Cambridge University Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3878252 Accessed: 05-06-2015 15:05 UTC REFERENCES Linked references are available on JSTOR for this article: http://www.jstor.org/stable/3878252?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents You may need to log in to JSTOR to access the linked references. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Cambridge University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Cambridge Opera Journal. http://www.jstor.org This content downloaded from 128.112.200.107 on Fri, 05 Jun 2015 15:05:41 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions CambridgeOpera Journal, 15, 3, 216-280 ( 2003 CambridgeUniversity Press DOL 10.1017/S0954586703001733 Winged feet and mute eloquence: dance in seventeenth-century Venetian opera IRENE ALM (edited by Wendy Heller and Rebecca Harris-Warrick) Abstract: This article shows how central dance was to the experience of opera in seventeenth-centuryVenice. -

Antonio Cesti L’Orontea Saturday, June 2 – Tuesday, June 5, 2018 Studebaker Theater | Chicago, Illinois Dear Friends
Antonio Cesti L’Orontea Saturday, June 2 – Tuesday, June 5, 2018 Studebaker Theater | Chicago, Illinois Dear Friends, Thank you for joining us as we close out our 7th season with Antonio Cesti’s sitcom opera L’Orontea. We hope that our performances will help restore this witty masterpiece to its rightful place alongside the works of Monteverdi and Cavalli. We are thrilled to have world famous countertenor Drew Minter join us both as a stage director and as Aristea for this production. Sarah JHP Watkins joins our creative team as stage designer. It is our pleasure to welcome mezzo soprano Emily Fons in her Haymarket debut in the title role of Orontea. New to HOC are also Kimberly Jones as Amore/Tibrino and Addie Hamilton as Filosofia/Giacinta. Dan Bubeck makes his Haymarket stage debut as Corindo after his beautiful performances as Stradella’s St. John the Baptist in our first Lenten Oratorio concerts in 2016. As a repertory company, we are so fortunate to regularly feature such fine Chicago artists as Sarah Edgar, Scott Brunscheen, Nathalie Colas, Ryan de Ryke, and Dave Govertsen. We extend a special welcome to virtuoso lutenist Nigel North who joins our Venetian-style orchestra. The whirlwind of activity behind the scenes is almost as operatic as one of our productions. Haymarket is growing! We continue to receive generous financial support from the Angell Family Foundation, the Richard H. Driehaus Foundation, the Elizabeth F. Cheney Foundation, the Department of Cultural Affairs and Special Events, and the Gaylord and Dorothy Donnelley Foundation. We are excited to announce a new two-year $20,000 “Innovation Grant” from Opera America, generously funded by the Ann and Gordon Getty Foundation. -

Martha Jane Gilreath Submi Tted As an Honors Paper in the Iartment Of
A STTJDY IN SEV CENT1 CHESTRATIO>T by Martha Jane Gilreath SubMi tted as an Honors Paper in the iartment of Jiusic Voman's College of the University of Xorth Carolina Greensboro 1959 Approved hv *tu£*l Direfctor Examining Committee AC! ' IKTS Tt would be difficult to mention all those who have in some way helped me with this thesis. To mention only a few, the following have mv sincere crratitude: Dr. Franklyn D. Parker and members of the Honors -fork Com- mittee for allowing me to pursue this study; Dr. May ". Sh, Dr. Amy Charles, Miss Dorothy Davis, Mr. Frank Starbuck, Dr. Robert Morris, and Mr, Robert Watson for reading and correcting the manuscript; the librarians at Woman's College and the Music Library of the University of North Carolina through whom I have obtained many valuable scores; Miss Joan Moser for continual kindness and help in my work at the Library of the University of North Carolina; mv family for its interest in and financial support of my project; and above all, my adviser, Miss Elizabeth Cowlinr, for her invaluable assistance and extraordinary talent for inspiring one to higher scholastic achievenent. TAm.E OF COKTB 1 1 Chapter I THfcl 51 NTURY — A BACKGROUND 3 Chapter II FIRST RUB OR( 13 Zhapter III TT*rn: fTIONS IN I] 'ION BY COMPOSERS OF THE EARLY SEVE TORY 17 Introduction of nasso Continuo 17 thods of Orchestration 18 Duplication of Instruments 24 Pro.gramatic I'ses of Scoring .25 id Alternation between Instruments. .30 Introduction of Various Instrumental devices 32 Dynamic Contrasts 32 Rowing Methods 33 Pizzicato -

22. (5/8) VENICE 3 1. Exam
2 2 . ( 5 / 8 ) V E N I C E 3 1. Exam: Similar to midterm. Essay question will ask you to discuss how musical compositions are related to the culture and the (biography of the) person that produced them. 2. Squarely in the Baroque — music, art, and literature a. Literature, mainly German: Grimmelhausen (novels), Martin Opitz (poetry) 3. Other developments in Venice: a. Biagio Marini (Brescia 1594–Venice 1663) and the violin sonata i. Violinist, student of Monteverdi ii. Sonata IV per il violino per sonar con due corde (ca. 1626) iii. Seconda prattica—monody for instruments (different from Gabrielli) iv. Sections of different style and tempo, some arialike, are connected all in a row; later these will be expanded and become separate movements. v. This piece was written when Marini was away from Venice, but it was for Venice, and he first used the special technique of this piece in a composition written in Venice. b. Later Opera Composers [nice to know, not NEED to know] i. Both more enduring in their time than Monteverdi ii. [Pier] Francesco Cavalli (1602–1676) 1. Second Organist at S. Marco 2. The major opera composer after Monteverdi 3. Established an “accademie in musica” at the major theater in Venice, the Teatro S. Cassiano. 4. Tended to write one opera a year in good times. 5. Giasone (Jason) (1649) — with the wonderfully stuttering Hunchback Demo [1.vi–vii] iii. Antonio Cesti (16231669) 1. Name often given as “Marc Antonio Cesti” but is incorrect. 2. As famous as a tenor as a composer in his life. -

5021524-Dbac9e-827949064661.Pdf
Prologue Luigi Rossi (1597-1653) 6 Il palazzo incantato overo La guerriera amante: 3. 22 Claudio Monteverdi (1567-1643) Prologue Vaghi rivi (La Pittura) 1 L’Orfeo: Toccata and Prologue Dal mio Permesso amato 7. 21 Premiered in Rome, Teatro delle Quattro Fontane, 1642 (La Musica) Premiered in Mantova, Palazzo Ducale, 1607 Francesco Cavalli (1602-1676) 7 L’Ormindo: Sinfonia and Prologue Non mi è Patria l’Olimpo 7. 24 Giulio Caccini (1551-1618) (L’Armonia) 2 L’Euridice: Prologue Io che d’alti sospir (La Tragedia) 3. 59 Premiered in Venice, Teatro San Cassiano, 1644 Premiered in Florence, Palazzo Pitti, 1602 Pietro Antonio Cesti (1623-1669) Francesco Cavalli (1602-1676) 8 Il Pomo d’oro, Sinfonia and Prologue Amore et Imeneo 6. 12 3 La Didone: Sinfonia and Prologue Caduta è Troia (Iride) 4. 03 (La Gloria Austriaca) Premiered in Venice, Teatro San Cassiano, 1640 Premiered in an open-air theatre in Vienna, 1668 Francesco Cavalli (1602-1676) Alessandro Stradella (1639-1682) 4 L’Eritrea: Prologue Nelle grotte arimaspe (Iride) 3. 29 9 Sinfonia a due violini e basso 6. 42 Premiered in Venice, Teatro Sant’Apollinare, 1652 Pietro Antonio Cesti (1623-1669) Stefano Landi (1587-1639) 10 L’Argia: Sinfonia e Prologo De’ gotici splendori (Amore) 5. 03 5 Il Sant’Alessio: Sinfonia and Prologue Roma son io (Roma) 9. 54 Premiered in Innsbruck’s Court Theatre, 1655 Premiered in Rome, Palazzo Barberini, 1632 Alessandro Stradella (1639-1682) il pomo d’oro 11 Prologo per musica. La Pace incatenata che dorme, 9. 19 si risveglia e dice: Con meste luci Enrico Onofri first violin (Marco Minnozzi, Ravenna 2016) Premiered in Rome, [?] 1668 Alfia Bakieva second violin (Eriberto Attili, Rome 2010) Maria Cristina Vasi viola (Franz Josef Knitl, Mittenwald 1795) Alessandro Scarlatti (1660-1725) Ludovico Minasi cello (Eriberto Attili, Rome 2011), gamba (Marco Nuñez Rodriguez, Sevilla 2009) 12 Gli equivoci in amore, o vero La Rosaura: 7. -

475255 2.Pdf
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ The Chamber Duets of Agostino Steffani (1654-1728), with Transcriptions and Catalogue. Timms, C. R The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 10. Oct. 2021 175 9 THE TEXTS OP STEFFNI'S DUETS The first consideration in the study of alnxst any type of vocal music should be the text • After looking at this separately, one should be in a position to see why the music is in its present form, to distinguish between the contributions of the composer and poet and to point out eys in which they may have collaborated. -

Society for Seventeenth-Century Music Twelfth Annual Conference
Society for Seventeenth-Century Music A SOCIETY DEDICATED TO THE STUDY AND PERFORMANCE OF 17TH-CENTURY MUSIC Twelfth Annual Conference La Jolla, California 1517 April 2004 ABSTRACTS OF PRESENTATIONS * Index of presentations * Abstracts * Program Committee Index of Presentations Antonia L. Banducci (University of Denver), “Staging Music: The Dramatic Role of Preludes and Ritournelles in French Baroque Opera” Gregory Barnett (Rice University), “Church Music, Musical Topoi, and the Ethos of the Sonata da chiesa” Grey Brothers (Westmont College) and the Westmont Chamber Singers, “The Polyphonic Passion in Mexico City: The Passio secundum Mattheum of Antonio Rodríguez de Matta (d. 1643)” Michele Cabrini (Princeton University), “From the Visual to the Aural: Tempête and the Power of Instrumental Sound in the French Cantata” Stuart Cheney (Goucher College), ”Transcriptions for Solo Viol of the Music of Jean- Baptiste Lully” Michael R. Dodds (Southern Methodist University), “Plainchant at Florence Cathedral in the Late Seicento: Unwritten Sharps and Shifting Concepts of Tonal Space” David Dolata (Eastern Washington University), “Bellerofonte Castaldi’s Extraordinary Capricci a due stromenti” Don Fader (Indiana University), “Marin Mersenne and the French View of Musical Rhetoric” Alex Fisher (University of British Columbia), “Approaching Music and Religious Identity in Early Modern Germany: Sacred Music in Augsburg during the Thirty Years’ War" Wendy Heller (Princeton University), “I pianti d’Apollo: Desire, Melancholy, and the Power of Song” -

NAWM Composers Found in Our Collections: Special Collections Research Center (SCRC), 2Nd Floor Fenwick Library Medieval/Renaissa
NAWM composers found in Our Collections: Special Collections Research Center (SCRC), 2nd floor Fenwick Library Note: the asterisks are for items of composers not featured in the Norton Anthology. Medieval/Renaissance i. Directorivm chori: ad vsvm omnivm ecclesiarvm cathedralium & collegiatarum M2153.2 .C36 1665 Notes: A Catholic service book, vocal music in neume notation. Includes music by Giovanni Pierluigi da Palestrina. ii. *Osculetor me osculo oris sui* NE671.16 .V58 1610 Notes: Motet, chorus. In mensural notation. iii. *Vellum manuscript leaf from a choir book in Latin* M2147 XVI .M4 Notes: Illuminated manuscript, in neume notation. From some time between 1475 and 1525; published in Italy, from a Catholic choir book – Mass celebrating nativity of Blessed Virgin Mary. iv. *Antiphonal: fragment* M2147 XV .M3 Notes: Illuminated vellum manuscript, in neume notation – c. 1500, published in Spain or Italy. From a large antiphonal (antiphonary). v. *Bifolium from the Missale Brixinense with the Lord’s Prayer in Gothic musical notation* BX2015 .A2 1493 Notes: Catholic Missal in neume notation. Printed by Erhard Ratdolt in 1493. vi. *Wind instruments: 16th century woodcut* ML931 .A66 1568 Notes: Engraved by the Swiss artist Jost Amman for his Ständebuch (Book of trades). Published in Frankfurt. 1 Baroque i. *Antonio Cesti – Il Pomo D’Oro* SCA C0215 Notes: Lithograph of a scene from his opera, in the Performing Arts Graphic Material Collection ii. XII sonatas in three parts: six of which are for two violins and a bass, three for two German flutes, and three for a hautboy & common flute, with a bass for the violoncello and a thorough bass for the harpsichord. -

A Performing Edition of the Opera La Lotta D'ercole Con
A PERFORMING EDITION OF THE OPERA LA LOTTA D'ERCOLE CON ACHELOO BY AGOSTINO STEFFANI (1654–1728) BY CINTHIA PINHEIRO ALIRETI Submitted to the faculty of the Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree, Doctor of Music, Indiana University May 2012 Accepted by the faculty of the Jacobs School of Music, Indiana University, in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music. __________________________________ Dr. Massimo Ossi, Research Director __________________________________ Dr. Carmen Helena Tellez, Chairperson __________________________________ Dr. William Jon Gray __________________________________ Dr. Michael Schwarzkopf ii To my family, Prof. Carmen Helena Tellez, Elisabeth Wright and Stanley Ritchie iii Acknowledgements I would like to thank Prof. Massimo Ossi and Prof. Carmen Helena Tellez for their encouragement to the initiation of this work. They have always given me full credit to the expression and development of my ideas during the course of the program. In the same extent, I would like to thank Prof. Dr. Rainer Kleinertz and Dr. Stephanie Klauk, as well as the Universität des Saarlandes, for their inestimable support for the conclusion of my dissertation. This project would not have been possible without their interest in helping me with the acquisition of the four main manuscript sources copied from the British Library, the Staatsbibliothek zu Berlin Preusischer Kulturbesitz and the Bayerische Staatsbibliothek. I would like to acknowledge as well Mme. Raphaëlle Legrand and her classes at the Sorbonne, whose advices and ideas have considerably enriched the research and presentation of this work. All my friends, family and professors have played a special role in the course of this period, which I would like to recognize as essential for the conclusion of this work. -

Music in the Pavilion
UNIVERSITY of PENNSYLVANIA LIBRARIES KISLAK CENTER Music in the Pavilion Tempesta di Mare Chamber Players A Tale of Two Italian Cities Chamber Music from Venice and Naples Friday, April 5, 2019 Class of 1978 Orrery Pavilion Van Pelt-Dietrich Library Center library.upenn.edu/exhibits/music_series.html A Tale of Two Italian Cities Chamber Music from Venice and Naples TEMPESTA DI MARE CHAMBER PLAYERS Gwyn Roberts, recorder Emlyn Ngai & Rebecca Harris, violin Richard Stone, theorbo Lisa Terry, cello Adam Pearl, harpsichord VENICE Two Sonatas (early 17th century) Giovanni Valentini (1582–1649) Sonata in D minor for three treble instruments • Sonata in C for two violins Sonata No. 4 from Sonate concertante in stil moderno (Venice, 1629) Dario Castello (1602–1631) Two Sonatas from La Cetra, Op 10 (Venice, 1673) Giovanni Legrenzi (1626–1690) Sonata à 3 No. 1 in C • Sonata à 3 No 5 in D Concerto in A minor, RV 108 (Venice, 1720s) Antonio Vivaldi (1678–1741) Allegro • Largo • Allegro A Tale of Two Italian Cities Chamber Music from Venice and Naples INTERMISSION NAPLES Sonata a quattro no. 2 in F (Naples, ca. 1710) Pietro Marchitelli (1643–1729) Adagio • Presto • Adagio • [Allegro] Concerto in A minor (Naples, by 1725) Francesco Mancini (1672–1737) Allegro • Andante • Spiritoso • Largo • Allegro from Canzone… con il basso continuo (Naples, 1650) Andrea Falconieri (1585–1656) L’Eroica • Fantasia • Folias • L’Arcibizzarra Program Notes by Richard Stone and Gwyn Roberts Venice and Naples were Italy’s two main musical hubs in the 17th and 18th centuries. Opera figured large in both places, with Naples training many of Europe’s finest singers in its four conservatories and Venice employing them in its six—or more, depending on the year—opera companies.