Stadt Bietigheim-Bissingen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
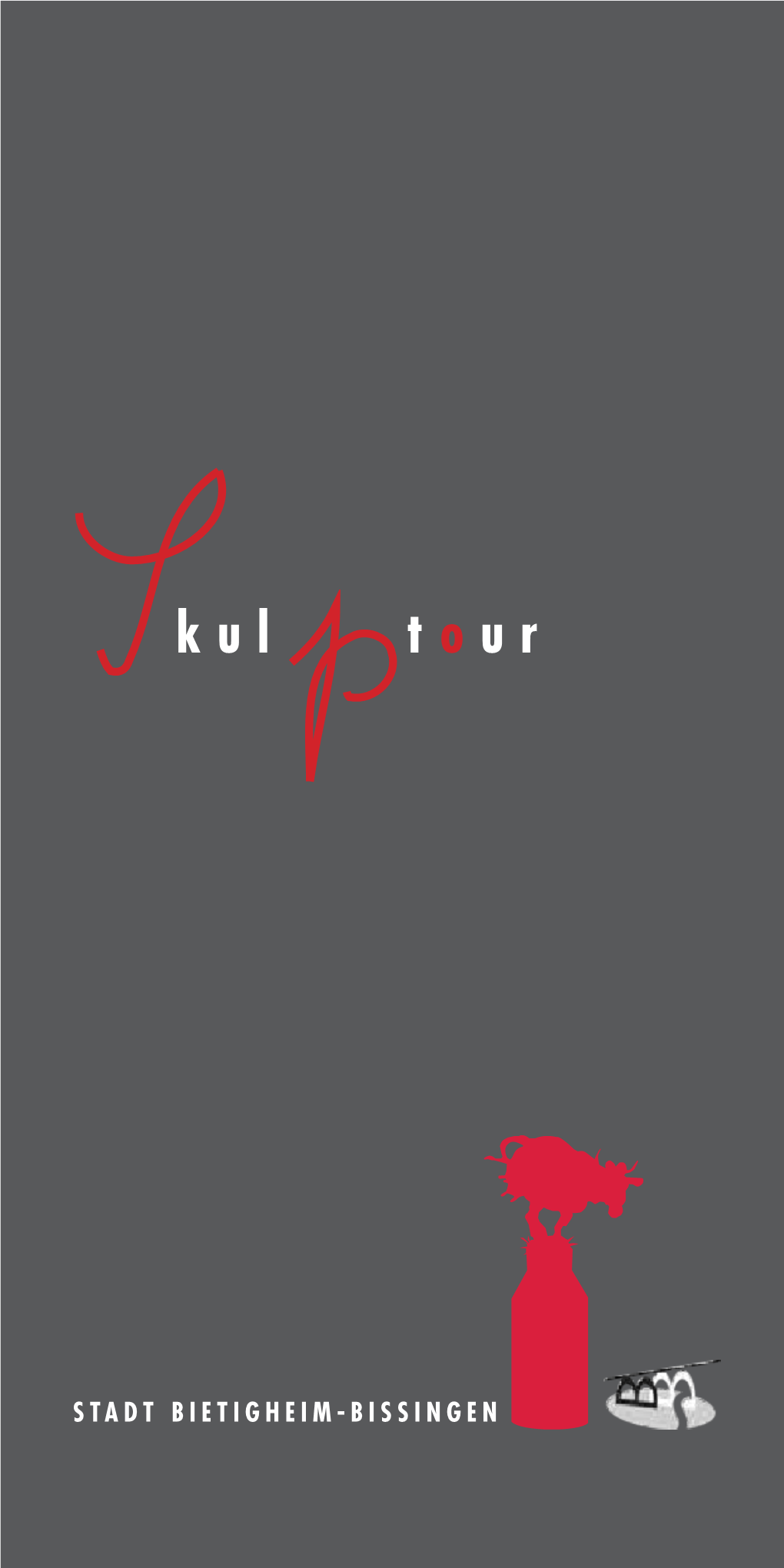
Load more
Recommended publications
-

Frau Und Kultur E.V
Deutscher Verband Frau und Kultur e.V. gegründet 1903 als „Verein für Fraueninteressen“ Als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt Mitglied im Deutschen Frauenrat Die Vorträge finden als Veranstaltung der VHS statt Programm Januar bis August 2020 J a n u a r Do 09.01. Literaturzirkel Wir besprechen das Buch Der kaukasische Kreidekreis von Bertold Brecht begleitet von Gabriela Weber-Schipke, Germanistin. 15.00 Uhr Raum 107, VHS Ludwigshafen, Bürgerhof Information: Liselotte Guntrum 0621-559229 / Isolde Scholz 0621-531485 Mo 13.01. Theatergespräch Der Schimmelreiter / Schauspiel von Theodor Storm / Theater Bremen Das Gespräch wird von einer der Dramaturginnen, Carolin Grein oder Dr. Roswita Schwarz, begleitet. 10.00 Uhr Theater im Pfalzbau, Ludwigshafen / Bühneneingang Berliner Straße Vorstellung: 09. und 10.01.2020 Anmeldung: Hannelore Mächtle 0621-554245 Di 14.01. Philosophie im Alltag In einem Kreis interessierter Laien wird über philosophische Themen gesprochen, die auch unseren Alltag prägen. Philosophische Fragen begleiten uns täglich, ohne dass wir immer darauf achten. Ausgewählte kurze Texte werden zur Verfügung ge- stellt und gemeinsam besprochen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Dr. Andreas Scheib, Philosophiehistoriker 18.30 Uhr VHS, Raum 102, Ludwigshafen Mi 15.01. Kunstforum Darf ich dir meine Sammlung zeigen – Teil II Anne Rittig, Kunsthistorikerin 11.00 Uhr Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Straße 23, Ludwigshafen Gebühr: 10.- € / Div. Pässe 5,- € / Anmeldung: Brigitte Seiler 0621-552679 Do 16.01. Kunstseminar Der Blaue Reiter – Teil I Kandinsky äußerte sich 1930 in seinem Rückblick zur Namensgebung „Den Namen Der Blaue Reiter erfanden wir am Kaffeetisch in der Gartenlaube in Sindelsdorf. Beide liebten wir blau, Marc – Pferde, ich – Reiter. So kam der Name von selbst.“ Gordana Mlakar, M.A., Kunsthistorikerin 15.00 Uhr VHS-Vortragssaal, 2. -

East German Art Collection, 1946-1992
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/ft538nb0c2 No online items Guide to the East German art collection, 1946-1992 Processed by Special Collections staff; machine-readable finding aid created by Steven Mandeville-Gamble. Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc © 2002 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Guide to the East German art M0772 1 collection, 1946-1992 Guide to the East German art collection, 1946-1992 Collection number: M0772 Department of Special Collections and University Archives Stanford University Libraries Stanford, California Contact Information Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Processed by: Special Collections staff Encoded by: Steven Mandeville-Gamble © 2002 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Descriptive Summary Title: East German art collection, Date (inclusive): 1946-1992 Collection number: M0772 Extent: 21 linear ft. (ca. 1300 items) Repository: Stanford University. Libraries. Dept. of Special Collections and University Archives. Language: English. Access Restrictions None. Publication Rights Property rights reside with the repository. Literary rights reside with the creators of the documents or their heirs. To obtain permission to publish or reproduce, please contact the Public Services Librarian of the Dept. of Special Collections. Provenance Purchased, 1995. Preferred Citation: East German art collection. M0772. Dept. of Special Collections, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. Historical note The collection was put together by Jurgen Holstein, a Berlin bookseller. -

Zugelassene Osteopathen Der AOK Nach Namen Sortiert
Name Behandler PLZ Ort Straße Aaza, Katrin 61118 Bad Vilbel Marktplatz 2 Aaza, Katrin 63225 Langen Dieburger Str.2 Aaza, Katrin 60322 Frankfurt/Main Wolfsgangstr. 65 Aaza, Katrin 61184 Karben Ludwigstr. 20 Abel, Karin 61250 Usingen Bahnhofstr.18 a Abel, Karin 61273 Wehrheim Am Kappengraben 22 Abel, Karin 61250 Usingen Bahnhofstr.3 Abeln, Veronique 55232 Alzey Bleichstr.21 Ablaßmeier, Veronika 83703 Gmund Miesbacher Str. 1 Aboulyazid, Stephan 66798 Wallerfangen Hospitalstr. 5 Abramovic, Dahlia 97877 Wertheim Gustav-Freytag-Str.26 Abrantes Ferreira, Anabela 45147 Essen Planckstr. 115 Abt, Karin 56355 Nastätten Steinsberg 3 Achtenhagen, Christin 14467 Potsdam Hegelallee 16 Achtenhagen, Christin 14797 Kloster Lehnin Bahnhofsallee 15 Achtenhagen, Christin 16321 Bernau Jahnstr. 52 Achtnich, Andrea 68163 Mannheim Gustav-Seitz-Str. 4 Acker, Sophie 67346 Speyer Wormser Str. 7 Ackermann, Britta 64283 Darmstadt Rheinstraße 20 Ackermann, Britta 64367 Mühltal Römerweg 4 Ackermann, Rainer 67063 Ludwigshafen Sternstraße 116 Ackermann, Rainer 67063 Ludwigshafen Kreuzstr. 2 Ackermann, Susann 21335 Lüneburg Gaußstr.2 Adam, Ariane Ria 50674 Köln Händelstr. 25 Adam, Mohamad 60311 Frankfurt/Main Kaiserstr. 3 Adam, Mohamad 60311 Frankfurt/Main Kaisertr. 3 Adams, Philip 50676 Köln Mauritiussteinweg 36a Adermann, Kristin 55543 Bad Kreuznach Dr.Karl Aschoff-Str.17 Adler, Angela 56412 Großholbach Hohe Str. 18 Adolf, Nicole 31188 Holle Landwehr 28 Adomat, Gesa 33378 Rheda-Wiedenbrück Krumholzstraße 8 Adorjan-Schaumann, Kristina 80336 München Sendlingertorplatz 11 Adrat, Tanja 56593 Horhausen Alter Weg 6 Am Kardinal Höffner-Platz Agné, Claudia 35630 Ehringshausen Siegener Str. 29 Ahlbrecht, Christoph 38300 Wolfenbüttel Reichsstrasse 5 Aido, Hannah 23566 Lübeck Moltkeplatz 4a Aido, Hannah 23611 Bad Schwartau Lübecker Str. 18 Albat-Rahmian, Kerstin 32257 Bünde Von-Schütz-Str. -

Germany and German-Speaking Europe
Originalveröffentlichung in: W. Briggs - J. Gaisser - C. Martindale (Hg.) A companion to the classcal tradition, Malden 2007, S. 169-191 CHAPTER TWELVE Germany and German-Speaking Europe Volker Riedel 1 The Middle Ages Classical, predominantly Roman, culture had continued to influence most Germanic tribes, especially the Ostrogoths but also the Franks under Merovingian rule, following the late classical and early medieval Christianization of Europe. However the first major reorientation of the Roman Catholic Middle Ages to its classical inheritance took place later, from the second half of the eighth to the beginning of the tenth century, under the Carolingians. Charlemagne (768-814, crowned emperor 800) initiated this cultural renewal, the so-called "Carolingian Renaissance." Reaching back to late antiquity in particular, it led to a synthesis of Germanic traditions, classical culture, and Christianity. Charlemagne undertook a far-reaching reform of the educa tional system, as part of his attempt to emulate the former Roman emperors and to gain preeminence for the Frankish state in western Europe, as a counterweight to the Byzantine empire in the east. He attracted scholars from across Europe to his court, including the Anglo-Saxon Alcuin (ca. 730-804), the Lombard Paul the Deacon (ca. 720 - ca. 799), and the Visigoth Theodulf (ca. 760-821). Alcuin, the most significant scholar of his age, wrote theological treatises and textbooks on grammar, rhetoric, and dialectic as well as on lyric verse and fables. Yet his main legacy lies in advancing education by rediscovering classical achievements (especially the concept of the septem artesliberales[scven liberal arts] as constituting the basic curriculum), which exerted a lasting influence throughout the Middle Ages. -

East German Poster Collection, Series 4: Art Exhibition Posters, Special
East German Poster Collection, Series 4: Art Exhibition Posters, Special Collections and Archives, GMU Libraries item: AE‐0001 title: Sowjetishes Künstlerishes Glas und Gobelins date: 1977 size (cm): 57.5 x 81 summary: This poster is green with a center image of a blue blown glass vase holding blown glass flowers. It is for an art exhibit of Soviet glass and tapestries at the Exhibition Center in Berlin (July ‐ August 1977). item: AE‐0002 title: Ausstellung Glas aus zwei Jahrtausenden date: 1977 size (cm): 57 x 81 summary: This poster shows an ornate glass vase painted with scenes of villages and people. It is for an exhibit of glass art at the State Gallery in Halle (August 1977 ‐ July 1978). item: AE‐0003 title: Grafik zur Sowjetischen Literatur date: 1977 size (cm): 81 x 57 summary: This poster shows a black and white painting of stylized people spinning in a vortex surrounded by a Soviet cityscape. It is for an exhibit of art in Soviet literature at the Club of Culture in Berlin (October 15, 1977 ‐ November 8, 1977). item: AE‐0004 title: Galerie der Fruendschaft 1973 date: 1973 size (cm): 58.5 x 84 summary: This poster shows a black and white painting of young child in the style of folk art. Behind the child are five circles of bright colors. It is for an exhibit entitled "Gallery of Friendship" at the State Museum in Schwerin (June ‐ July 1973). item: AE‐0005 title: Hans Grundig date: 1973 size (cm): 57 x 81 summary: This poster shows a painting of a pack of wolves surrounding a larger wolf in the middle. -

CSR Report 2004
Social Responsibility Deutsche Bank’s worldwide commitment to culture, education, community development and sustainability 2004 2003 2002 Structural Data Number of countries in which Deutsche Bank operates (including offshore sites) 74 74 76 Key Figures Spending by Deutsche Bank (in ¤ million) Donations 42.82 34.8 50.5 Sponsoring1 24.3 25.6 21.2 Sub-total 67.1 60.4 71.7 thereof: Deutsche Bank Americas Foundation 15.82 10.6 15.7 Deutsche Bank Citizenship UK 3.5 3.4 4.1 Deutsche Bank Asia Foundation 0.9 0.1 – Spending by endowed foundations of Deutsche Bank (in ¤ million) Deutsche Bank Foundation Alfred Herrhausen Helping People to Help Themselves3 2.6 4.0 4.0 Cultural Foundation of Deutsche Bank3 2.0 2.3 3.6 Other foundations 1.2 0.7 0.7 Sub-total 5.8 7.0 8.3 Total 72.9 67.4 80.0 1 Only sponsoring for culture and society 2 ¤ 4.3 million of which through the sale of an investment of the Community Development Group 3 Merged to become the Deutsche Bank Foundation on January 1, 2005 1 Global Responsibility – Global Solidarity A letter to our readers Whenever globalization is debated, the primary focus is usually on inter- national competition and the resulting pressures to conform to its dictates. However, the tsunami in Asia, an event that overshadowed all others in 2004, has shown that globalization means more than doing business across international borders and cooperating in the political decision-making process. In the wake of the tsunami, humanity shared a new and very different experience — an outburst of solidarity with the victims that genuinely ignored all political boundaries. -

Wilhelm Arntz Papers, 1898-1986
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt8d5nf2w0 No online items INVENTORY OF THE WILHELM ARNTZ PAPERS, 1898-1986 Finding aid prepared by Isabella Zuralski. INVENTORY OF THE WILHELM 840001 1 ARNTZ PAPERS, 1898-1986 Descriptive Summary Title: Wilhelm Arntz papers Date (inclusive): 1898-1986 Number: 840001 Creator/Collector: Arntz, Wilhelm F. Physical Description: 159.0 linear feet(294 boxes) Repository: The Getty Research Institute Special Collections 1200 Getty Center Drive, Suite 1100 Los Angeles, California, 90049-1688 (310) 440-7390 Abstract: Comprehensive research collection on twentieth century art, especially German Expressionism, compiled by the art expert Wilhelm Friedrich Arntz. A vast portion of the collection consists of research files on individual artists. Of particular interest are files concerning the so-called degenerate art campaign by the Nazis and the recovery of confiscated artwork after the World war II. Extensive material documents Arntz's professional activities. Request Materials: Request access to the physical materials described in this inventory through the catalog record for this collection. Click here for the access policy . Language: Collection material is in German Biographical/Historical Note Wilhelm Friedrich Arntz (1903-1985) was a German lawyer, art expert and independent researcher of twentieth century art. He was also one of the early collectors of German Expressionism. Parallel to collecting artworks, he aquired publications on 20th century art and compiled a wealth of archival material, including newspaper clippings, correspondence of artists, art historians and dealers, and ephemeral items such as invitations to exhibition openings. Trained as a lawyer, Arntz began his professional career as political editor for the newspaper Frankurter Generalanzeiger, but he lost his job in 1933 after the Nazis came to power. -

Isbn 978-3-00-044316-9 Gustav Seitz
ISBN 978-3-00-044316-9 GUSTAV SEITZ 50 KÖPFE Frontispiz Bild: G. S. im Atelier GUSTAV SEITZ 50 KÖPFE Bearbeitet von Brigitte Heise und Bernd Schälicke Herausgegeben von der Gustav Seitz Stiftung, Hamburg Inhalt Seite Vorwort . 7 Brigitte Heise Im Spannungsfeld von Ähnlichkeit und Wahrheit Zur Porträtkunst von Gustav Seitz . 9 Katalog der Porträts 1 – 50 . 25 – 142 Gustav Seitz Das Porträt ist mehr als Abbild . 143 Über das Porträtieren . 145 Liebe zum Objekt . 147 Lebensdaten von Gustav Seitz . 148 Ausgewählte Literatur . 151 Liste der dargestellten Personen . 152 Dank . 153 Impressum Frontispiz: Gustav Seitz im Atelier, 1964 Seite 6: Gustav Seitz im Atelier, 1954 Abb. 57: Gustav Seitz im Atelier, 1964 Abb. 58: Gustav Seitz im Atelier, 1949 Abb. 59: Gustav Seitz im Atelier, 1968 Herausgeber: Gustav Seitz Stiftung, Hamburg, 2013 Autoren: Brigitte Heise (bh), Bernd Schälicke (bs) Die G Nummer bezeichnet das Werk in Grohn 1980 Redaktion: Bernd Schälicke Druck: Dräger+Wullenwever print+media Lübeck GmH + Co. KG / Schmidt Römhild Druckerei ISBN 978-3-00-044316-9 5 Vakat Vorwort Vor 25 Jahren hatte Luise Seitz in ihrem Testament Heise, die bereits 1994 an der Ausstellung der Por- festgelegt, dass der künstlerische Nachlass ihres träts der „Vier Dichter. Francois Villon, Heinrich Mannes in einer Stiftung betreut werden sollte. In Mann, Bertolt Brecht, Thomas Mann“ in Lübeck der zu Grunde gelegten Satzung heißt es dement- mitgearbeitet hat. In dem von ihr geleiteten Mu- sprechend: „Ausschließlicher und unmittelbarer seum Behnhaus/Drägerhaus, MKK in Lübeck, hat Zweck der Stiftung ist die Pflege von Werk und sie später die Wanderausstellung „Von Liebe und Wirken des Bildhauers und Zeichners Gustav Schmerz“ zur 100. -

Durch Das Gustav Seitz Museum
Leitfaden durch das Gustav Seitz Museum Inhalt Stiftung und Museum ............................................................................................................................................................................................................... 3 Die künstlerische Perspektive ......................................................................................................................................................................................... 4 Ausbildung und Wirken in der Vorkriegszeit ..................................................................................................................................................... 5 Künstlerische Entwicklung nach 1945 ..................................................................................................................................................................... 7 Die 1960er Jahre ............................................................................................................................................................................................................................. 10 Der Torso – eine eigene Kunstform ............................................................................................................................................................................. 11 Das letzte Werk „Porta d’Amore“................................................................................................................................................................................... 12 -

The Transfiguration of the Hero: a Memory Politics of the Everyday in Berlin and Budapest
THE TRANSFIGURATION OF THE HERO: A MEMORY POLITICS OF THE EVERYDAY IN BERLIN AND BUDAPEST by Júlia Székely Submitted to Central European University Department of Sociology and Social Anthropology In partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Supervisors: Judit Bodnár CEU eTD Collection Jean-Louis Fabiani Budapest, Hungary 2016 STATEMENT I hereby state that this dissertation contains no materials accepted for any other degrees in any other institutions. The thesis contains no materials previously written and/or published by another person, except where appropriate acknowledgement is made in the form of bibliographical reference. Budapest, February 29, 2016. CEU eTD Collection i | P a g e ABSTRACT Although after the period of the Second World War the death of the hero was loudly announced (Münkler 2006), in recent years, the academic interest in heroes has been reemerging. Authors not only established a critical understanding of the hero who came to be defined as an end-product of a careful construction (e.g., Todorova 1999, Giesen 2004a), but ―new heroes‖ also made their mass appearance (Jones 2010). Yet, in contrast to the majority of these analyses that either concentrate on one particular hero (e.g, Verdery 1999) or on one specific period (e.g., Lundt 2010), I discuss the conceptual and aesthetic transformation of the hero. Focusing on the genre of public works of art in Berlin and Budapest from 1945 up to the present time, I study various processes of the transfiguration of the hero. Besides the linguistic and cultural connections between Berlin and Budapest beginning from the 19th century, I assumed that the two cities can represent many of the dual arguments of memory studies. -

Der Bildhauer Gustav Seitz
Gefördert durch die www.digiporta.net Der Bildhauer Gustav Seitz Porträtierte Person: Seitz, Gustav Die Wiedergabe der Abbildung ist aus Kurzbiografie: Der Bildhauer Gustav Seitz wurde am 11.9.1906 in Neckarau bei rechtlichen Gründen Mannheim geboren. Von 1922 bis 1924 absolvierte er eine Lehre bis 31.12.2088 als Bildhauer in Ludwigshafen am Rhein, die er mit der gesperrt Gesellenprüfung abschloss. Gleichzeitig nahm Seitz auch Zeichenunterricht an der Gewerbeschule in Mannheim. In den Jahren 1924 und 1925 war Seitz Schüler von Georg Schreyögg an der Landeskunstschule Karlsruhe, ab 1925 bei Ludwig Gies an der Staatsschule für Freie und Angewandte Kunst in Berlin- Charlottenburg. Von 1926 bis 1932 war er Meisterschüler von Wilhelm Gerstel. In den Jahren 1927 und 1928 unternahm Seitz Studienreisen nach Florenz und Paris. In den 1930er Jahren folgten weitere Reisen nach Griechenland, Ägypten, Paris und Kopenhagen. Von 1933 bis 1938 war er zudem Inhaber eines Meisterateliers an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin unter Hugo Lederer. Ab 1937 arbeitete Seitz mit dem Architekten Heinrich Tessenow zusammen, allerdings war sein Schaffen während der Zeit des Nationalsozialismus nur eingeschränkt möglich. Von 1940 bis 1945 war er Soldat im Zweiten Weltkrieg. Schon 1943 waren seine sämtlichen Arbeiten durch die Zerstörung seines Berliner Ateliers vernichtet worden. 1946 wurde er auf den Lehrstuhl für plastisches Gestalten an der Technischen Universität Berlin-Charlottenburg berufen. Ab 1947 war er Professor an der Hochschule für bildende Künste Berlin- Charlottenburg, ab 1950 an der Akademie Berlin-Weißensee. 1949 erhielt Seitz den Nationalpreis der DDR III. Klasse für das Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Berlin-Weißensee.