Automized Production of Bibliographical Information Of
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

C•CURE Solutions SALTO Offline Locks
C•CURE Solutions SALTO Offline Locks Features That Make a Difference: • Seamless integration with C•CURE 9000 security and event management system • Offline, wireless and wireless-ready locks supported The C•CURE 9000 integration with SALTO access to offline locks will expire after • High level interface between offline locks allows communication with the one day, unless a card is updated with C•CURE 9000 and offline lock system SALTO server and control of cardholder a fresh update point transaction. using SHIP (SALTO Host Interface access permissions to offline locks, directly Protocol) from the C•CURE 9000 system. This SHIP Interface • SALTO online readers to update cards for seamless interface supports bi-directional C•CURE 9000 support for SALTO offline offline reader access communication with the SALTO system locks utilizes a high level interface to • Offline transactions shared via cards are using SHIP (Salto Host Interface Protocol). SHIP (SALTO Host Interface Protocol). synchronized with C•CURE 9000 server The SALTO offline lock solution offers C•CURE 9000 and the SALTO offline lock flexibility within any project where the solution exchange cardholder data via • Suitable for storage areas, office spaces cost of a fully wired door is not justified. SHIP communications over an Ethernet and other areas where real-time security monitoring is not a priority SALTO offline locks can be installed on network. SALTO online readers (control almost any type of door ranging from points) are used to update a card with • Flexible design that can be fitted to almost narrow profile, aluminum doors, heavy duty access permissions for offline lock any type of door doors, panic bars, glass doors and many use. -
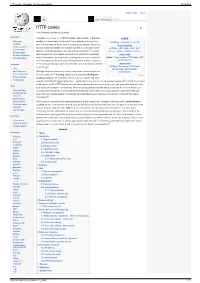
HTTP Cookie - Wikipedia, the Free Encyclopedia 14/05/2014
HTTP cookie - Wikipedia, the free encyclopedia 14/05/2014 Create account Log in Article Talk Read Edit View history Search HTTP cookie From Wikipedia, the free encyclopedia Navigation A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser HTTP Main page cookie, is a small piece of data sent from a website and stored in a Persistence · Compression · HTTPS · Contents user's web browser while the user is browsing that website. Every time Request methods Featured content the user loads the website, the browser sends the cookie back to the OPTIONS · GET · HEAD · POST · PUT · Current events server to notify the website of the user's previous activity.[1] Cookies DELETE · TRACE · CONNECT · PATCH · Random article Donate to Wikipedia were designed to be a reliable mechanism for websites to remember Header fields Wikimedia Shop stateful information (such as items in a shopping cart) or to record the Cookie · ETag · Location · HTTP referer · DNT user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, · X-Forwarded-For · Interaction or recording which pages were visited by the user as far back as months Status codes or years ago). 301 Moved Permanently · 302 Found · Help 303 See Other · 403 Forbidden · About Wikipedia Although cookies cannot carry viruses, and cannot install malware on 404 Not Found · [2] Community portal the host computer, tracking cookies and especially third-party v · t · e · Recent changes tracking cookies are commonly used as ways to compile long-term Contact page records of individuals' browsing histories—a potential privacy concern that prompted European[3] and U.S. -

Creating Permanent Test Collections of Web Pages for Information Extraction Research*
Creating Permanent Test Collections of Web Pages for Information Extraction Research* Bernhard Pollak and Wolfgang Gatterbauer Database and Artificial Intelligence Group Vienna University of Technology, Austria {pollak, gatter}@dbai.tuwien.ac.at Abstract. In the research area of automatic web information extraction, there is a need for permanent and annotated web page collections enabling objective performance evaluation of different algorithms. Currently, researchers are suffering from the absence of such representative and contemporary test collections, especially on web tables. At the same time, creating your own sharable web page collections is not trivial nowadays because of the dynamic and diverse nature of modern web technologies employed to create often short- lived online content. In this paper, we cover the problem of creating static representations of web pages in order to build sharable ground truth test sets. We explain the principal difficulties of the problem, discuss possible approaches and introduce our solution: WebPageDump, a Firefox extension capable of saving web pages exactly as they are rendered online. Finally, we benchmark our system with current alternatives using an innovative automatic method based on image snapshots. Keywords: saving web pages, web information extraction, test data, Firefox, web table ground truth, performance evaluation 1 Introduction In the visions of a future Semantic Web, agents will crawl the web for information related to a given task. With the current web lacking semantic annotation, researchers are working on automatic information extraction systems that allow transforming heterogonous and semi-structured information into structured databases that can be later queried for data analysis. For testing purposes researchers need representative and annotated ground truth test data sets in order to benchmark different extraction algorithms against each other. -

B-GPT: Grundlagen Der EDV Version: 16
World Wide Web - 1 / 4 - World Wide Web. Aufbau Full Qualified Domain Name (FQDN). Der Name eines Hosts setzt sich aus mehreren Teilen zusammen, die durch Punkte voneinander getrennt sind und deren Gesamtheit als FQDN bezeichnet wird. Nicht erlaubt in FQDN's sind Sonderzeichen mit Ausnahme des Binde- strichs (dh. auch Leerzeichen sind nicht erlaubt), erlaubt dagegen sind Buchstaben und Ziffern, wobei zwischen Groß- und Kleinbuchstaben nicht unterschieden wird. Rechnername.[[Fourth-Level-Domain.]Third-Level-Domain.]Second-Level-Domain.TLD TLD = Top-Level-Domain (First-Level-Domain) Als Beispiel diene der Web Server der University of Texas in Austin, USA, mit dem FQDN www1.cc.utexas.edu • Hostname: Dies ist der eigentliche Name des Rechners. Im Beispiel www1 • 3rd, 4th usw. Level Domain (falls verwendet, wahlfrei): Subdomains (bzw. auch Zonen genannt). Wird eine Domain in Subdomains unterteilt, folgt deren Bezeichnung. Im Beispiel cc • 2nd Level Domain: Dies ist die Bezeichnung des Bereiches, in dem alle Hosts des Betreibers mit eventuellen Subdomains zu- sammengefasst sind. Im Beispiel utexas • Top-Level-Domain - TLD oder 1st Level Domain: Diese Domain gehört einer übergeordneten Struktur an. Die Top-Level Domain wird nicht willkürlich bei Namens- adressen vergeben, sie hat eine feste Bedeutung. Im Beispiel edu. Top Level und 2nd Level Domain sind für Hosts im WAN nicht frei wählbar, sondern müssen registriert werden. Bei einigen TLD's wie zum Beispiel .uk unterliegen auch einige 3rd Level Domains det Registrierungspflicht. Die Regis- trierung erfolgt beim NIC (Network Information Center). Die Festlegung der TLD Bezeichnungen obliegt der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Num- bers): http://www.icann.org/tlds/ Die IP Nummern Pools werden regional verwaltet, also auch nicht willkürlich vergeben: AfriNIC für Afrika: http://www.afrinic.net APNIC für Asien u. -
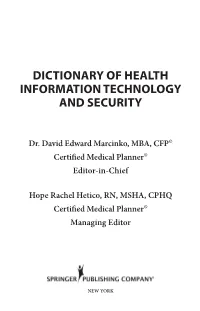
Dictionary of Health Information Technology and Security
DICTIONARY OF HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY AND SECURITY Dr. David Edward Marcinko, MBA , CFP© Certifi ed Medical Planner© Editor-in-Chief Hope Rachel Hetico, RN, MSHA, CPHQ Certifi ed Medical Planner© Managing Editor NEW YORK 33021009_FM1.indd021009_FM1.indd i 003/17/20073/17/2007 116:48:506:48:50 Copyright © 2007 Springer Publishing Company, LLC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmit- ted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Springer Publishing Company, LLC. Springer Publishing Company, LLC 11 West 42nd Street New York, NY 10036 www.springerpub.com Acquisitions Editor: Sheri W. Sussman Production Editor: Carol Cain Cover design: Mimi Flow Composition: Apex Publishing, LLC 07 08 09 10/ 5 4 3 2 1 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Dictionary of health information technology and security / David Edward Marcinko, editor-in-chief, Hope Rachel Hetico, managing editor. p. ; cm. Includes bibliographical references. ISBN-13: 978-0-8261-4995-4 (alk. paper) ISBN-10: 0-8261-4995-2 (alk. paper) 1. Medical informatics—Dictionaries. 2. Medicine—Information technology—Dictionaries. 3. Medical informatics—Security measures— Dictionaries. I. Marcinko, David E. (David Edward) II. Hetico, Hope R. [DNLM: 1. Informatics—Dictionary—English. 2. Medical Informatics— Dictionary—English. 3. Computer Communication Networks—Dictionary— English. 4. Computer Security—Dictionary—English. W 13 D557165 2007] R858.D53 2007 610.3—dc22 2007005879 Printed in the United States of America by RR Donnelley. 33021009_FM1.indd021009_FM1.indd iiii 003/17/20073/17/2007 116:48:516:48:51 Th e Dictionary of Health Information Technology and Security is dedicated to Edward Anthony Marcinko Sr., and Edward Anthony Marcinko Jr., of Fell’s Point, Maryland. -

C:\Andrzej\PDF\ABC Nagrywania P³yt CD\1 Strona.Cdr
IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREFCI Wielka encyklopedia komputerów KATALOG KSI¥¯EK Autor: Alan Freedman KATALOG ONLINE T³umaczenie: Micha³ Dadan, Pawe³ Gonera, Pawe³ Koronkiewicz, Rados³aw Meryk, Piotr Pilch ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ISBN: 83-7361-136-3 Tytu³ orygina³u: ComputerDesktop Encyclopedia Format: B5, stron: 1118 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Wspó³czesna informatyka to nie tylko komputery i oprogramowanie. To setki technologii, narzêdzi i urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych wykorzystywanie komputerów CENNIK I INFORMACJE w ró¿nych dziedzinach ¿ycia, jak: poligrafia, projektowanie, tworzenie aplikacji, sieci komputerowe, gry, kinowe efekty specjalne i wiele innych. Rozwój technologii ZAMÓW INFORMACJE komputerowych, trwaj¹cy stosunkowo krótko, wniós³ do naszego ¿ycia wiele nowych O NOWOFCIACH mo¿liwoYci. „Wielka encyklopedia komputerów” to kompletne kompendium wiedzy na temat ZAMÓW CENNIK wspó³czesnej informatyki. Jest lektur¹ obowi¹zkow¹ dla ka¿dego, kto chce rozumieæ dynamiczny rozwój elektroniki i technologii informatycznych. Opisuje wszystkie zagadnienia zwi¹zane ze wspó³czesn¹ informatyk¹; przedstawia zarówno jej historiê, CZYTELNIA jak i trendy rozwoju. Zawiera informacje o firmach, których produkty zrewolucjonizowa³y FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE wspó³czesny Ywiat, oraz opisy technologii, sprzêtu i oprogramowania. Ka¿dy, niezale¿nie od stopnia zaawansowania swojej wiedzy, znajdzie w niej wyczerpuj¹ce wyjaYnienia interesuj¹cych go terminów z ró¿nych bran¿ dzisiejszej informatyki. • Komunikacja pomiêdzy systemami informatycznymi i sieci komputerowe • Grafika komputerowa i technologie multimedialne • Internet, WWW, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne • Komputery osobiste — PC i Macintosh • Komputery typu mainframe i stacje robocze • Tworzenie oprogramowania i systemów komputerowych • Poligrafia i reklama • Komputerowe wspomaganie projektowania • Wirusy komputerowe Wydawnictwo Helion JeYli szukasz ]ród³a informacji o technologiach informatycznych, chcesz poznaæ ul. -

UNIX-Verzeichnisbaum
Inhalt Vorwort ........................................................................................................ 23 TEIL I: KONZEPTE 1Konzepte............................................................................... 31 1.1 Dateien ..................................................................................... 32 1.1.1 Dateitypen ................................................................. 32 1.1.2 Dateinamen ............................................................... 33 1.2 Datenstrom .............................................................................. 34 1.3 Verzeichnisse ........................................................................... 35 1.3.1 Umgang mit Verzeichnissen ................................... 35 1.3.2 Der UNIX-Verzeichnisbaum ................................... 36 1.3.3 Was ist wo? ............................................................... 36 1.3.4 Einbinden von Speichermedien ............................. 39 1.3.5 Ein Blick unter die Haube: i-nodes ....................... 42 1.4 Schichten und Shells .............................................................. 43 1.5 Das offene System .................................................................. 44 1.6 Mehrbenutzersystem .............................................................. 45 1.6.1 Eigentumsrechte von Dateien und Verzeichnissen .......................................................... 46 1.6.2 Der Administrator .................................................... 47 1.7 Konsequenz: Sicherheit und Wartbarkeit -

Mcgraw Hill: PC/MAC Online and Offline Mcgraw Hill: PC/MAC Online and Offline
Portal > Knowledgebase > McGrawHill eBookstore > McGraw Hill: PC/MAC online and offline McGraw Hill: PC/MAC online and offline Roshan - 2021-09-29 - 0 Comments - in McGrawHill eBookstore Click on the Login button on the top right corner of the page. Existing Users can enter their credentials to Log in. New Users can click on the "sign up" button to create new accounts and access the eBooks. Click on your subscribed eBook and click on the "Online Reading Options" Once you click on the online reader, the eBook opens in the reader with all the feautures that enable you to read your book at your convenience. The epub reader comes with the Table Of Contents, Search, Listings, Bookmarks, Zoom and Settings. Listings: Shows all your Bookmarks, Highlights and Notes, in one location. Settings: Gives you options to choose a Color Theme for the reader and also switch on/off your Last-Read Location Offline reader installations Once you login to the McGraw Hill eBook site using your account you will notice a button “Download iPublishCentral Reader” Figure: Download iPublishCentral Reader Click on the download button to go to installation page. Click on install button to setup iPublishCentral reader on your system. The iPublishCentral Reader bookshelf is displayed. If the user is logging in for the first time, then a message "No books have been downloaded to the bookshelf" is displayed. Figure: Bookshelf Click the Login button on the upper right corner of the screen. Figure: Login Screen for an Normal user To log in into iPublishCentral Reader, you should have an online account in McGraw Hill portal. -

Creating Permanent Test Collections of Web Pages for Information Extraction Research*
Creating Permanent Test Collections of Web Pages for Information Extraction Research* Bernhard Pollak and Wolfgang Gatterbauer Database and Artificial Intelligence Group Vienna University of Technology, Austria {pollak, gatter}@dbai.tuwien.ac.at Abstract. In the research area of automatic web information extraction, there is a need for permanent and annotated web page collections enabling objective performance evaluation of different algorithms. Currently, researchers are suffering from the absence of such representative and contemporary test collections, especially on web tables. At the same time, creating your own sharable web page collections is not trivial nowadays because of the dynamic and diverse nature of modern web technologies employed to create often short- lived online content. In this paper, we cover the problem of creating static representations of web pages in order to build sharable ground truth test sets. We explain the principal difficulties of the problem, discuss possible approaches and introduce our solution: WebPageDump, a Firefox extension capable of saving web pages exactly as they are rendered online. Finally, we benchmark our system with current alternatives using an innovative automatic method based on image snapshots. Keywords: saving web pages, web information extraction, test data, Firefox, web table ground truth, performance evaluation 1 Introduction In the visions of a future Semantic Web, agents will crawl the web for information related to a given task. With the current web lacking semantic annotation, researchers are working on automatic information extraction systems that allow transforming heterogonous and semi-structured information into structured databases that can be later queried for data analysis. For testing purposes researchers need representative and annotated ground truth test data sets in order to benchmark different extraction algorithms against each other. -

Elibrary User Guide
eLibrary User Guide Empowering Knowledge Contents 1 Your Bookshelf ...................................................................................... 3 1a) Creating shelves ....................................................................................3 2 Searching for books .............................................................................. 4 3 Online & Offline Reading .................................................................... 4 3a) Reading online ......................................................................................4 3b) Reading offline ......................................................................................5 4 Standard Features ................................................................................ 6 4a) Copy & paste ..........................................................................................6 4b) Deep links...............................................................................................7 4c) Citations ................................................................................................7 5 Advanced Features ................................................................................ 8 5a) Register as an individual user ...............................................................8 5b) Creating digital notes ............................................................................9 5c) Printing pages .....................................................................................10 5d) Highlighting text .................................................................................11 -

Wiktionary App Download Wiktionary App Download
wiktionary app download Wiktionary app download. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. What can I do to prevent this in the future? If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store. Cloudflare Ray ID: 67a46b6f88f6c3e8 • Your IP : 188.246.226.140 • Performance & security by Cloudflare. Kiwix at a glance. The Kiwix Reader runs on all platforms and operating systems – mobile (Android and iOS), desktop (macOS, GNU/Linux, and Windows) and even as browser extension (Chrome or Firefox). Simply chose the one you need, and go offline! Content Packages. Our content packages (aka zim files) are exact copies of the best free content available on the Web to use offline: Wikipedia, Wiktionary, Project Gutenberg, and many more coming every month. More than a 1,000 files to chose from, in 100+ languages! Custom Apps. Our Custom Apps combine a specific content package and a reader into one easy to install app. Wikimed, the medical encyclopedia, is the best known. Custom Apps work on iOS, Android and Windows devices. Kiwix-Serve. Kiwix-Serve is a ZIM compatible web server: it allows you to deliver content over the HTTP protocol within your local network. -

Technical Evaluation Report 58
International Review of Research in Open and Distance Learning Volume 7, Number 3 ISSN: 1492-3831 December – 2006 Technical Evaluation Report 58. RSS Windows Editors: First impressions Steve Swettenham Masters of Distance Education Program Athabasca University - Canada's Open University Background An RSS feed is a list of topics made available from a webpage via a standard XML file format known as RSS, an abbreviation of either Really Simple Syndication or Rich Site Summary (Wikipedia, 2006). The end-user subscribes to their favorite Internet content site via RSS-aware software. Once subscribed, announcements with appropriate links are “pushed” from the publishing site whenever new material is added to that site (see Figure 1). This allows notification of new content of possible interest, fed with anonymity to subscribers, and reduces email clutter. Figure 1 is an example of a simple organized subscription that was obtained by accessing a website only once, then each time afterwards the RSS feed automatically presents the updated information. The various subscribed RSS feeds can be organized to create personalized displays, much like a customized online newspaper, with stories, articles, podcasts, video, or graphics of interest tailored to each user. Given the plethora of daily Internet information, RSS is a real-time organizer that may save users time and frustration in covering the most with the least effort. Figure 1. Web browser with a simple RSS reader add-on displaying a RSS feed with three items. 2 Sweettenham ~ Technical Evaluation Report 58: RSS Windows Editors: First impressions Given this potential communication connectivity, I was interested in exploring how one adds RSS feeds to their own web site so that items can easily be “pushed” to interested subscribers, much as is available by subscribing to the RSS feed for this journal (www.irrodl.org).