Globales Lernen: Aspekte Einer Postwachstums-Ökonomie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

46 Post-Growth Economics
46 POST-GROWTH ECONOMICS Niko Paech Introduction Today’s sustainability concepts are mostly based on ecological modernisation. Modern societies follow this trend and tend to shift the necessity of changing their consumption habits to a point later in time, or even deny the necessity of change completely. This is based on the hope that technological progress can solve the sustainability problem without having to go through difficult changes in lifestyle and a moderation of consumption habits. However, many of those ‘Green’ innovations intensify material and energy overexploitation by making use of previously unspoilt landscapes and untouched resources. As long as decoupling by technological means turns out to be impossible, sustainable development can only be understood as a programme for economic reduction rather than conjuring Green Growth solutions. In this chapter I will explore an alternative to this popularised approach. That is a world that no longer clings to the growth imperative and makes the post-growth economy its goal. I start by defining what is meant by post-growth economics and how it has developed. This is followed by an exploration of the case for limits to growth and why decoupling runs into problems, including the rebound effect. I then outline some key aspects of a post-growth economy, before briefly identifying future directions and finishing with some concluding remarks. The development and meaning of post-growth economics Development of post-growth economics The terms post-growth economics (as an analytical framework) and post-growth economies (as a concrete draft for the future) arose in debates over sustainability held at Carl von Ossietzky University in Oldenburg during 2006. -

Publikationsliste Von Niko Paech
apl. Prof. Dr. Niko Paech Publikationsliste Monographien Die Wirkung potentieller Konkurrenz auf das Preissetzungsverhalten etablierter Firmen bei Ab- wesenheit strategischer Asymmetrien, Duncker & Humblot, Berlin, 1995 (Dissertation). Nachhaltiges Wirtschaften jenseits von Innovationsorientierung und Wachstum { Eine unter- nehmensbezogene Transformationstheorie, Metropolis-Verlag, Marburg, 1. Auflage 2005, 2. Auf- lage, 2012 (Habilitationsschrift). Befreiung vom Uberfluss.¨ Auf dem Weg in die Postwachstums¨okonomie, oekom verlag, Munchen,¨ 1. Auflage 2012, 8. Auflage, 2015. Liberation from Excess. The Road to a Post-Growth Economy, oekom verlag, Munich, 2012. Namudosi Publishing Co., Seoul, 2015. Was Sie da vorhaben, w¨are ja eine Revolution..., oekom verlag, Munchen,¨ 2016 (mit Erhard Eppler und Christiane Grefe). Se Lib´erer Du Superflu. Vers une ´economie de post-croissance, Rue de L'´echiquier, Paris, 2016. Energie, Entropie, Kreativit¨at { Was das Wachstum treibt und bremst, Springer Spektrum, Berlin, 2018 (mit R. Kummel¨ und D. Lindenberger). Okonomie¨ der Genugsamkeit.¨ Impulse fur¨ eine Gesellschaft ohne Wachstum, Herrenalber Fo- rum, Karlsruhe 2019 (mit C. Rauch und A. U. Engelmann). All you need is less. Eine Kultur des Genug aus ¨okonomischer und buddhistischer Sicht, oekom verlag, Munchen,¨ 2020 (mit M. Folkers). Herausgeberschaften Perspektiven einer kulturwissenschaftlichen Theorie der Unternehmung, Metropolis-Verlag, Marburg, 2004 (mit Forschungsgruppe Unternehmen und gesellschaftltiche Organisationen { FUGO). Nachhaltige Zukunftsm¨arkte. Orientierungen fur¨ unternehmerische Innovationsprozesse im 21. Jahrhundert, Metropolis-Verlag, Marburg, 2005 (mit K. Fichter und R. Pfriem). Innovationen fur¨ eine nachhaltige Entwicklung, Deutscher Universit¨ats-Verlag, Wiesbaden, 2006 (mit R. Pfriem, R. Antes, K. Fichter, M. Muller,¨ S. Seuring und B. Siebenhuner).¨ Wirtschaftswissenschaftliche Nachhaltigkeitsforschung, Buchreihe im Metropolis-Verlag, Mar- burg, von der seit 2007 acht B¨ande erschienen sind (Mitgliedschaft im Herausgebergremium und Lektorat). -

The Contested Concept of Growth Imperatives: Technology and the Fear of Stagnation
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Richters, Oliver; Siemoneit, Andreas Working Paper The contested concept of growth imperatives: Technology and the fear of stagnation Oldenburg Discussion Papers in Economics, No. V-414-18 Provided in Cooperation with: University of Oldenburg, Department of Economics Suggested Citation: Richters, Oliver; Siemoneit, Andreas (2018) : The contested concept of growth imperatives: Technology and the fear of stagnation, Oldenburg Discussion Papers in Economics, No. V-414-18, University of Oldenburg, Department of Economics, Oldenburg This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/184870 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an -

Master Thesis
Ch F-X ang PD e w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Germany Program: Sustainability Economics and Management Master of Arts Master Thesis Titel: Diffusion of Sustainability Innovations around Lynedoch EcoVillage by: Claudia Stüwe for: PD Dr. Niko Paech PD Dr. Klaus Fichter Oldenburg, Germany, 04.11.2009 Ch F-X ang PD e w Click to buy NOW! w m o w c .d k. ocu-trac Table of Contents Page Abstract ............................................................................................................... 4 Table of Figures ................................................................................................... 4 List of Abbreviations ........................................................................................... 5 Acknowledgements .............................................................................................. 5 Section 1 .............................................................................................................. 7 1. Introduction ..................................................................................................... 7 1.1 Ecosystem degradation, climate change and increasing inequalities ............ 7 1.2 Sustainability and ‘transferable life styles’ .................................................. 9 1.3 Giving sustainability a different direction: Lynedoch EcoVillage, South Africa ............................................................................................................. 10 2. Research Design ........................................................................................... -

Media Review: Three Books on a New Economics: a German Perspective Ulrike Brandhorst
Interdisciplinary Journal of Partnership Studies Volume 4 Article 11 Issue 1 Winter, Caring Democracy 3-2-2017 Media Review: Three Books on a New Economics: A German Perspective Ulrike Brandhorst Follow this and additional works at: http://pubs.lib.umn.edu/ijps Recommended Citation Brandhorst, Ulrike (2017) "Media Review: Three Books on a New Economics: A German Perspective," Interdisciplinary Journal of Partnership Studies: Vol. 4: Iss. 1, Article 11. Available at: http://pubs.lib.umn.edu/ijps/vol4/iss1/11 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License The Interdisciplinary Journal of Partnership Studies is published by the University of Minnesota Libraries Publishing. Authors retain ownership of their articles, which are made available under the terms of a Creative Commons Attribution Noncommercial license (CC BY-NC 4.0). Brandhorst: Media Review: Three Books on a New Economics MEDIA REVIEW Three Books on a New Economics: A German Perspective LIBERATION FROM EXCESS: THE ROAD TO A POST-GROWTH ECONOMY, Niko Paech (2012) CHANGE EVERYTHING: CREATING AN ECONOMY FOR THE COMMON GOOD, Christian Felber (2015) THE REAL WEALTH OF NATIONS: CREATING A CARING ECONOMICS, Riane Eisler (2008) Reviewed by Ulrike Brandhorst Abstract The first part of this paper presents the ideas of Niko Paech and Christian Felber, two popular exponents of alternative economic models in Germany and Austria. Both authors invoke psychological and behavioral factors, noting that our current economic system is leaving people dependent, unhappy, and dissatisfied, and that this system’s values are contradictory to our constitutional and fundamental values. The book presented in the second part of the paper helps understand this absurdity. -

Efficiency Consumption
An offer you can’t refuse – Enhancing personal productivity through ‘efficiency consumption’ Andreas Siemoneit ZOE Discussion Papers | No. 2 | January 2019 ZOE Discussion Papers No. 2 · January 2019 An offer you can’t refuse: Enhancing personal productivity through ‘efficiency consumption’ Andreas Siemoneit ZOE. Institut für zukunftsfähige Ökonomien. www.effizienzkritik.de Abstract: Worldwide, economic growth is a prominent political goal, despite its severe conflicts with ecological sustainability. Contributing to the debate on economic ‘growth imperatives’, this article explores the thesis that firms and consumers both frequently acquire goods that increase their efficiency (productivity). For firms, efficiency is accepted as a main investment motive, but for consumers it is usually framed as convenience, ease, or comfort. Via social diffusion processes consumption goods that can save time and costs are transformed from a welcome expansion of possibilities into a social imperative whose noncompliance over time also has economic drawbacks. Positive feedback mechanisms not only lead to an acceleration of private life but favor ever more efficient industry and trade structures on the supply side, contributing to a redistribution of incomes and revenues. Eventually a comprehensive consumption pattern leads to a new ‘normality’ and makes the renunciation of consumption goods like cars, computers or smartphones literally impossible. Both microeconomics and consumption sociology usually assume fundamental differences of motivations, goals and structural overall conditions for firms and consumers. Some reasons for this scholarly asymmetry are discussed and a more symmetrical consumption model is proposed. As a political dimension the increasing resource use of this quest for efficiency is addressed. Keywords: Efficiency; Diffusion of Innovations; Growth Imperative; Feedback loops; Theory of Consumption Licence: Creative-Commons CC-BY-NC-ND 4.0. -

Degrowth and Social Innovation an Analysis of Social Innovation Initiatives in Berne
Degrowth and Social Innovation An Analysis of Social Innovation Initiatives in Berne Master Thesis Andrea Winiger Mai 2018 Université de Genève Institut de démographie et socioéconomie Supervisors Prof. Jean-Michel Bonvin Institut de démographie et socioéconomie, Université de Genève Prof. Heike Mayer Institute of Geography, Economic Geography, University of Berne 1 Abstract Given the countless negative side effects of the growth strategies pursued by western economies in the past centuries the time seems ripe for a paradigm shift. The concept of degrowth seems to be a promising approach for replacing the current growth paradigm. This research analyses if innovation and in particular social innovation would be appropriate drivers for such a change towards degrowth. Furthermore, it examines what would be relevant factors for such innovations to be successful. More specifically, the study looks at what factors of success, challenges and framework conditions, four social innovation initiatives in Bern face. The necessary data has been collected through semi-structured interviews and a focus group. A qualitative content analysis has been conducted for analysing the data. The results show that not all types of innovations are equally suitable drivers of change towards degrowth. Non-material innovation, such as for example social innovation, are to be preferred compared to material innovations due to the growth effects of the latter. Moreover, several common factors of success for the social innovation initiatives in Berne were identified. Finally, possible solutions for one particular challenge of the analysed social innovation initiatives were developed during the focus group. 2 Acknowledgements This master thesis could not have been written without the highly-appreciated support of many people. -

Gesellschaftliches Wohlergehen Innerhalb Planetarer Grenzen Der Ansatz Einer Vorsorgeorientierten Postwachstumsposition
TEXTE 89/2018 Gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen Der Ansatz einer vorsorgeorientierten Postwachstumsposition Für Mensch & Umwelt TEXTE 89/2018 Ressortforschungsplan des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Forschungskennzahl 3715 311040 Gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen Der Ansatz einer vorsorgeorientierten Postwachstumsposition Zwischenbericht des Projektes „Ansätze zur Ressourcenschonung im Kontext von Postwachstumskonzepten“ von Ulrich Petschow, Dr. Steffen Lange, David Hofmann Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Berlin Dr. Eugen Pissarskoi Universität Tübingen, Internationales Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, ehemals IÖW Dr. Nils aus dem Moore, Thorben Korfhage, Annekathrin Schoofs RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Büro Berlin Mit Beiträgen von Prof. Dr. Hermann Ott ClientEarth, ehemals Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Im Auftrag des Umweltbundesamtes Impressum Herausgeber Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Tel: +49 340-2103-0 Fax: +49 340-2103-2285 [email protected] Internet: www.umweltbundesamt.de /umweltbundesamt.de /umweltbundesamt Durchführung der Studie: Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) Potsdamer Straße 105 10785 Berlin in Kooperation mit: RWI – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) Büro Berlin Invalidenstr. 112 10115 Berlin Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Döppersberg 19 42103 Wuppertal Bei dem vorliegenden Diskussionspapier handelt -

The Economy in the Aftermath of Growth 55
54 3.3. EXPert day > apl. Prof. Dr. Niko Paesch > THE ECONOMY IN THE AFTERMATH OF GROWTH 55 THE ECONOMY IN THE AFTERMATH OF GROWTH APL. PROF. DR. NIKO PaeSCH, ADJUNCT PROFESSOR CURRENTLY HOLDING THE CHAIR OF PRODUCTION AND ENVIRONMENT (PUM) AT THE UNIVERSITY OF OLDENBURG THE ONGOING CLIMATE, RESOURCE AND FINANCIAL CRISES UNDERSCORE THE FAILURE OF A PROSPERITY MODEL BASED ON GROWTH AND DEPENDANT ON CONSUMPTION. IT IS TIME TO TAKE STOCK: INSTEAD OF CONCENTRATING ON EXPANSIVE 'BUSINESS- AS-USUAL' POLICIES, IT MIGHT BE WORTH TAKING A LOOK AT A CONCEPT OF POST-GROWTH ECONOMICS THAT CAN ACTUALLY BE THE ALternatiVE SUSTainable in the long term – albeit in modest dimensions. In contrast to the model described above, the concept of post-growth economics rests on the following premises: Research on economic sustainability encom- > No ecological uncoupling of economic growth is in sight. In an expanding economy, 'boomerang passes two main schools of thought each with a effects' resulting from growing demand can wipe out advances in de-materialisation or ecologi- different relationship to the imperative of growth. sation. This can become particularly dramatic when (well-meaning) innovations in sustainability The hitherto dominant current supports the actually trigger additional energy and material flows. In this case successive waves of moderni- thesis that ongoing economic growth is not only sation are necessary in order to counter the unforeseen environmental repercussions of the necessary vis-à-vis expanding prosperity, but previous waves. The highly respected studies published by the Global Carbon Project reveal two it also believes that it can be sustainable. -

Rethinking the University
Interview Rethinking the University Discussion group (from left): Corinna Dahm-Brey, Matthias Echterhagen (both from the Press and Public Relations Office), Sabine Doering, Birger Kollmeier, Katharina Al-Shamery and Niko Paech. The University of Oldenburg celebrates its 40th Ms Al-Shamery, you came to Olden- Kollmeier: I can recall exactly what it exciting times in which the younger naturally had far more possibilities to anniversary this year. What makes this university burg as a physical chemistry lecturer was like when I started here. At 33 I was among us were handed responsibility actively organise research projects. But in 1999. What was it like when you first the youngest professor in the faculty very quickly. Things had been very diffe- for me there‘s another important point: special? What are the responsibilities of academics started here? when I came to Oldenburg in 1992. In rent for me in Bavaria. Here in Oldenburg what I really like is that at this university in general? How should education look in the future? Al-Shamery: I was immediately invol- Göttingen I had addressed all the stu- I suddenly had the chance to help mould you experience an interdisciplinarity And how can universities encourage students‘ thirst ved in discussions about projects that dents with „du“, while they used the the institute and its working conditions. that elsewhere you only hear about in were exciting and, above all, interdisci- formal „Sie“ with me. Then I came to I found myself among a strong and at pretty speeches. An interdisciplinarity for knowledge? An exchange of views between plinary. -
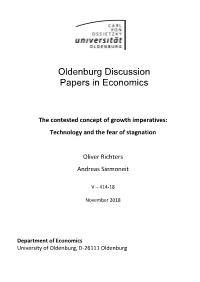
The Contested Concept of Growth Imperatives: Technology and the Fear of Stagnation
Oldenburg Discussion Papers in Economics The contested concept of growth imperatives: Technology and the fear of stagnation Oliver Richters Andreas Siemoneit V – 414-18 November 2018 Department of Economics University of Oldenburg, D-26111 Oldenburg Oldenburg Discussion Papers in Economics V-414-18, November 2018 The contested concept of growth imperatives: Technology and the fear of stagnation Oliver Richtersa, Andreas Siemoneitb a International Economics, Department of Economics, Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Ammerländer Heerstraße 114–8, 26129 Oldenburg (Oldb), Germany, [email protected]; b ZOE. Institute for future-fit economies, Thomas-Mann-Str. 36, 53111 Bonn, Germany. Abstract: Economic growth has become a prominent political goal worldwide, despite its severe conflicts with ecological sustainability. Are ‘growth policies’ only a question of political or individual will, or do ‘growth imperatives’ exist that make them ‘in- escapable’? We structure the debate along two dimensions: (a) degree of coerciveness between free will and coercion, and (b) types of agents affected. Carefully derived micro level definitions of ‘social coercion’ and ‘growth imperative’ are used to discuss several mechanisms which are suspected to make economic growth necessary for firms, households, and nation states. We identify technological innovations as a systematic necessity to net invest, trapping firms and households in a positive feedback loop to increase efficiency. Due to its resource consumption, the competitive advantage of a novel technology is often based on a violation of the meritocratic principle. The resulting dilemma between ‘technological unemployment’ and the social necessity of high employment can explain why states ‘must’ foster economic growth. Politically, we suggest market compliant institutions to limit resource consumption and redistribute economic rents. -
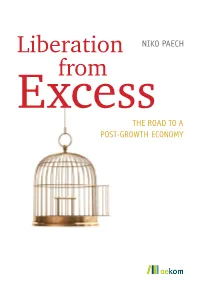
Liberation from the Subtle Distinction — Here “Good”, There “Bad” Growth — Is Held by Paech to Be Nothing More Than a Sham
“ Self-determination depends not on having NIKO PAECH Niko Paech much but on needing little.” PAECH NIKO Liberation After a stressful week at work, we all feel we sometimes deserve a treat too: perhaps the latest smartphone, an iPad, or a fl atscreen television. from Before we know it, we are stuck in the vicious circle of consumer desire and time poverty. And that is not all: the constant demand for “more” is causing raw materials to disappear and driving environmen- tal destruction forward. The world is still not ready to abandon the drug of “growth”. However, Excess the debate about the end of excessiveness is gathering momentum. THE ROAD TO A Sustainability researcher Niko Paech provides a timely polemic that un- masks “green” growth as a myth. Yet “green” growth and “sustainable” POST-GROWTH ECONOMY consumption are seen as the new and best ways forward. Despite this, Excess Liberation from the subtle distinction — here “good”, there “bad” growth — is held by Paech to be nothing more than a sham. In his counter model of a post-growth economy, he calls for restrictions upon industrial value added processes and for patterns of self-suffi ciency to be strengthened. This form of economic activity would not only be more frugal but also more stable and environmentally friendly. And it would also provide a release for the many people who already fi nd life in the rat race of material self-realisation very uncomfortable. 12,95 Euro 9 7 8 3 8 6 5 8 1 3 2 4 4 www.oekom.de Umschlag_Paech_Verzicht_engl.indd 1 06.09.12 18:00 This book was produced in a climate-neutral way.