Swr2-Musikstunde-20110209.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

12-04-2018 Traviata Eve.Indd
GIUSEPPE VERDI la traviata conductor Opera in three acts Yannick Nézet-Séguin Libretto by Francesco Maria Piave, production Michael Mayer based on the play La Dame aux Camélias by Alexandre Dumas fils set designer Christine Jones Tuesday, December 4, 2018 costume designer 8:00–11:00 PM Susan Hilferty lighting designer New Production Premiere Kevin Adams choreographer Lorin Latarro DEBUT The production of La Traviata was made possible by a generous gift from The Paiko Foundation Major additional funding for this production was received from Mercedes T. Bass, Mr. and Mrs. Paul M. Montrone, and Rolex general manager Peter Gelb jeanette lerman-neubauer music director Yannick Nézet-Séguin 2018–19 SEASON The 1,012th Metropolitan Opera performance of GIUSEPPE VERDI’S la traviata conductor Yannick Nézet-Séguin in order of vocal appearance violet ta valéry annina Diana Damrau Maria Zifchak flor a bervoix giuseppe Kirstin Chávez Marco Antonio Jordão the marquis d’obigny giorgio germont Jeongcheol Cha Quinn Kelsey baron douphol a messenger Dwayne Croft* Ross Benoliel dr. grenvil Kevin Short germont’s daughter Selin Sahbazoglu gastone solo dancers Scott Scully Garen Scribner This performance Martha Nichols is being broadcast live on Metropolitan alfredo germont Opera Radio on Juan Diego Flórez SiriusXM channel 75 and streamed at metopera.org. Tuesday, December 4, 2018, 8:00–11:00PM MARTY SOHL / MET OPERA Diana Damrau Chorus Master Donald Palumbo as Violetta and Musical Preparation John Keenan, Yelena Kurdina, Juan Diego Flórez Liora Maurer, and Jonathan -

Quaderni Musicali Marchigiani 14
Quaderni Musicali Marchigiani 14 a cura di Concetta Assenza Pubblicazione dell’A.Ri.M. – Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI 14/2016 a cura di Concetta Assenza ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI (A.Ri.M. – onlus) via P. Bonopera, 55 – 60019 Senigallia www.arimonlus.it [email protected] QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI Volume 14 Comitato di redazione Concetta Assenza, Graziano Ballerini, Lucia Fava, Riccardo Graciotti, Gabriele Moroni Realizzazione grafica: Filippo Pantaleoni ISSN 2421-5732 ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI (A.Ri.M. – onlus) QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI Volume 14 a cura di Concetta Assenza In copertina: Particolare dell’affresco di Lorenzo D’Alessandro,Madonna orante col Bambino e angeli musicanti, 1483. Sarnano (MC), Chiesa di Santa Maria di Piazza. La redazione del volume è stata chiusa il 30 giugno 2016 Copyright ©2016 by A.Ri.M. – onlus Diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, riservati per tutti i Paesi. «Quaderni Musicali Marchigiani» – nota Lo sviluppo dell’editoria digitale, il crescente numero delle riviste online, l’allargamento del pubblico collegato a internet, la potenziale visibilità globale e non da ultimo l’abbattimento dei costi hanno spinto anche i «Quaderni Musicali Marchigiani» a trasformarsi in rivista online. Le direttrici che guidano la Rivista rimangono sostanzialmente le stesse: particolare attenzione alle fonti musicali presenti in Regione o collegabili alle Marche, rifiuto del campanilismo e ricerca delle connessioni tra storia locale e dimensione nazionale ed extra-nazionale, apertura verso le nuove tendenze di ricerca, impostazione scientifica dei lavori. -

Lucia Di Lammermoor GAETANO DONIZETTI MARCH 3 – 11, 2012
O p e r a B o x Teacher’s Guide table of contents Welcome Letter . .1 Lesson Plan Unit Overview and Academic Standards . .2 Opera Box Content Checklist . .9 Reference/Tracking Guide . .10 Lesson Plans . .12 Synopsis and Musical Excerpts . .44 Flow Charts . .49 Gaetano Donizetti – a biography .............................56 Catalogue of Donizetti’s Operas . .58 Background Notes . .64 Salvadore Cammarano and the Romantic Libretto . .67 World Events in 1835 ....................................73 2011–2012 SEASON History of Opera ........................................76 History of Minnesota Opera, Repertoire . .87 così fan tutte WOLFGANG AMADEUS MOZART The Standard Repertory ...................................91 SEPTEMBER 25 –OCTOBER 2, 2011 Elements of Opera .......................................92 Glossary of Opera Terms ..................................96 silent night KEVIN PUTS Glossary of Musical Terms . .101 NOVEMBER 12 – 20, 2011 Bibliography, Discography, Videography . .105 werther Evaluation . .108 JULES MASSENET JANUARY 28 –FEBRUARY 5, 2012 Acknowledgements . .109 lucia di lammermoor GAETANO DONIZETTI MARCH 3 – 11, 2012 madame butterfly mnopera.org GIACOMO PUCCINI APRIL 14 – 22, 2012 FOR SEASON TICKETS, CALL 612.333.6669 620 North First Street, Minneapolis, MN 55401 Kevin Ramach, PRESIDENT AND GENERAL DIRECTOR Dale Johnson, ARTISTIC DIRECTOR Dear Educator, Thank you for using a Minnesota Opera Opera Box. This collection of material has been designed to help any educator to teach students about the beauty of opera. This collection of material includes audio and video recordings, scores, reference books and a Teacher’s Guide. The Teacher’s Guide includes Lesson Plans that have been designed around the materials found in the box and other easily obtained items. In addition, Lesson Plans have been aligned with State and National Standards. -

Messe in D Mass in D Major
Otto NICOLAI Messe in D Mass in D major Soli (SATB), Coro (SATB) 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 2 Corni, 2 Trombe, Timpani 2 Violini, Viola, Violoncello e Contrabbasso in Verbindung mit dem Archiv der/in cooperation with the Erzdiözese Salzburg herausgegeben von /edited by Eva Neumayr Urtext Klavierauszug /Vocal score Paul Horn C Carus 27.036/03 Inhalt Vorwort / Foreword 3 Kyrie (Soli SATB e Coro SATB) 5 Gloria (Soli e Coro) 12 Credo (Soli e Coro) 23 Sanctus (Coro) 39 Benedictus (Soli e Coro) 42 Agnus Dei (Soli e Coro) 47 Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor: Partitur (Carus 27.036), Klavierauszug (Carus 27.036/03), Chorpartitur (Carus 27.036/05), komplettes Orchestermaterial (Carus 27.036/19). The following performance material is available for this work: full score (Carus 27.036), vocal score (Carus 27.036/03), choral score (Carus 27.036/05), complete orchestral material (Carus 27.036/19). 2 Carus 27.036/03 Vorwort ändert wurde.“4 Die Messe wurde vom Wiener Hof ange- nommen und am 27.4.1845 in einem Sonntagshochamt Wenn Otto Nicolai (1810–1849) heute ausschließlich als unter der Leitung von Vize-Kapellmeister Ignaz Assmayr Komponist der Oper Die lustigen Weiber von Windsor be- aufgeführt. In der Allgemeinen Wiener Musikzeitung vom kannt ist, so spiegelt das den Umfang seines Werks nur un- 6. 5.1845 erschien eine Rezension, Partitur und Stimmen zureichend wider. Zu seinen zahlreichen Kompositionen wurden dem „Archiv der Hofmusikkapelle“5 übergeben, zählen unter anderem mehrere italienische Opern und ihre der Komponist erhielt ein Honorar von 100 fl. – sein Ziel, deutschen Bearbeitungen, drei Sinfonien, zahlreiche Lieder, als Musiker bei Hof angestellt zu werden, erreichte er je- Chorwerke sowie geistliche Kompositionen. -

Fiche AC Verdi.Qxd
Les fiches pédagogiques - Compositeur GIUSEPPE VERDI (1813 - 1901) hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Giuseppe Verdi nait le 10 octobre 1813 à Le Roncole (province de Milan). D’origine modeste, d’abord formé par l’organiste du village, Baistrocchi, il suit des études à Busseto avec le chef de fanfare Provesi. Refusé au conservatoire de Milan comme pianiste mais encouragé par le jury à la composition, il travaille en privé avec Vin- cenzo Lavigna (auteur d’opéras, répétiteur à la Scala, ami et parfois collaborateur de Rossini), grâce au mécénat d’Antonio Barezzi, dont il épousera la fille Marghe- rita. Tandis qu’il assume les fonctions de chef de musique municipale de Busseto, il est formé par Lavigna à l’étude de Haydn et de Mozart, et semble avoir achevé à la mort de son maître, un opéra, Rocester, dont les fragments furent probable- ment réutilisés ultérieurement. Sur la recommandation de la cantatrice G.Strep- poni, il obtient de l’impresario Merelli un contrat pour la Scala, et y débute avec Orbeto, Conte di San Bonifacio, qui est donné 14 fois et repris l’année suivante pour 17 représentations, chiffres très inférieurs à ceux des opéras de Donizetti ou de Nicolai (dont on joue 46 fois Il Templario) mais supérieurs à ceux de tous les au- tres auteurs. Ce succès lui vaut la commande d’Un Giorno di Regno, qui connaît un fiasco dès le premier soir (1840) ; on a souvent imputé cet échec à l’impossibilité dans laquelle aurait été Verdi de composer un opera buffa, étant alors affligé par le récent décès de sa jeune femme et de ses deux enfants ; or, il ne s’agit en rien d’un opera buffa, mais d’un livret semiseria. -

Dorothea Redepenning: Dostojewskij Auf Der Opernbühne
Dostoevsky Studies, New Series, Vol. XIV (2010), pp. 1342 DOROTHEA REDEPENNING Universität Heidelberg Dostojewskij auf der Opernbühne Dostojewskijs Werke eigenen sich streng genommen nicht als Libretto- Vorlagen. Dennoch hat er Komponisten seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu Opern, aber auch zu Oratorien inspiriert. Der Beitrag macht in einem einführenden Schritt die ästhetischen Fragen beim Zusammenwirken von Literatur und Musik bewusst. Sodann beleuchtet er die Opernkonzeption, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Russland heraus- bildete und die Voraussetzungen für die ersten Dostojewskij-Opern bereitstellte. Ein dritter Teil zeigt in einer umfassenden Übersicht die Präsenz Dostojewskijs im internationalen Opernschaffen; daran schließen sich zwei exemplarische Untersuchungen und ein Fazit. I. Literatur und Musik Musik und Literatur sind seit alters her Schwestern oder Freundinnen, die, wenn sie sich zusammentun, ihre Kreativität aus dem Spannungsfeld von Gemeinsamkeiten und Gegensätzen entfalten. Formale Gesetzmäßig- keiten eines Gedichts (Reimstruktur, Versmaß, Strophenbau) und die internen Prinzipien musikalischer Formbildung (Periodizität, harmonische und melodische Halb- und Ganzschlussbildungen), dazu die semantische und die emotionale Dimension in textlicher und musikalischer Auslegung – dieses Spannungsfeld findet im Lied stets neue, individuelle Lösungen. Eine poetische Form wie das Sonett zum Beispiel fordert Komponisten bis in die Gegenwart heraus.1 Seit den Anfängen der Oper (um 1600) ringen Literaten und Musiker mit dem Problem, dass ihre Künste unterschiedliche Zeitverhältnisse zu ihrer Entfaltung brauchen. Musik kommt, um sich „ausleben“ zu können, auch ohne Text aus. Für die 1 Vgl. dazu Sara Jeffe: Modi di cantar sonetti – Zur Geschichte der Sonettvertonungen bis ins 20. Jahrhundert, in Vorbereitung. 14 Dorothea Redepenning Literatur heißt das, dass sie Rücksicht nehmen muss auf die Weitschwei- figkeit der Musik – eine abendfüllende Oper braucht viel weniger Text als ein Drama. -
Grieg Gillham
Photograph by Alastair Bett Gillham Griegplays Thursday 2 3 & LAUNCESTON MASTER 12 April 7.30pm Federation Concert Hall Hobart Friday 13 April 7.30pm Albert Hall A treasure for Launceston Eivind Aadland conductor Jayson Gillham piano NICOLAI SCHUMANN all Tasmanians The Merry Wives of Windsor, Overture Symphony No 3, Rhenish Duration 8 mins Lebhaft [Lively] GRIEG Scherzo (Sehr mässig [Very moderately]) Nicht schnell [Not fast] Piano Concerto Feierlich [Ceremonially] Allegro molto moderato Lebhaft [Lively] A live symphony orchestra can transport us Adagio – Duration 32 mins to a world that’s enchanting and uplifting. Allegro moderato molto e marcato Duration 30 mins This concert will end at approximately 9.30 pm. We want all Tasmanians to be able to share that joy, so we’re helping to make that happen. INTERVAL Duration 20 mins Through the AccessTix program, Hydro Tasmania provides free tickets for Tasmanians who, because of disadvantage or disability, Sponsored by couldn’t otherwise attend a TSO concert. To see if you, or someone you know, is eligible, Tasmanian Symphony Orchestra concerts are broadcast and streamed throughout go to tso.com.au/accesstix Australia and around the world by ABC Classic FM. We would appreciate your cooperation in keeping coughing to a minimum. Please ensure that your mobile phone is switched off. 39 Otto Nicolai (1810-1849) The Merry Wives of Windsor, Overture the same name, it is regarded as the finest early Romantic German comic Otto Nicolai was a remarkable all-round opera, but has had the misfortune musician: not just a composer but a of being almost eclipsed by Verdi’s singer good enough to take the part wonderful opera on the same subject, of Jesus in Bach’s St Matthew Passion. -
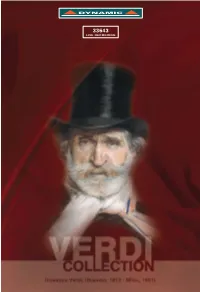
COPERTINE Layout 1
DYNAMIC 33643 LIVE RECORDING NABUCCO 1 NABUCCO i sono opere che rivestono un ruolo senza saperlo - ciò che Manzoni aveva fatto fondamentale nella storia di un auto- in letteratura con i Promessi Sposi: creare C re, un valore che spesso va molto al cioè un linguaggio - nel suo caso specifico di là della loro pura e semplice qualità musi- un linguaggio musicale - che potesse esse- cale. Nabucco è senza dubbio una di que- re capito e apprezzato da tutti, dall’umile ste opere, non solo perché assicurò a Verdi artigiano appena alfabetizzato all’uomo di il primo autentico grande successo di pub- cultura, dal semplice orecchiante al musici- blico, ma anche perché segnò una svolta sta professionista. decisiva nelle vicende dell’opera italiana del Le vicende che portarono alla creazione del primo Ottocento, dando inizio a quel filone Nabucco sono ampiamente note. Il libretto epico-popolare che tanta parte doveva di Temistocle Solera era stato in origine avere negli eventi del Risorgimento. Con offerto al compositore tedesco Otto Nicolai, Nabucco, Verdi trovò finalmente sé stesso, a quel tempo attivo in Italia e assai popolare dotandosi, per così dire, dei mezzi linguisti- grazie ai successi delle opere Enrico II ci ed espressivi destinati a farlo diventare, (Trieste, 1839) e Il Templario (Torino, 1840). nel giro di un decennio, il dominatore incon- Grazie all’intervento dell’impresario Merelli, trastato delle scene musicali italiane. Nel tuttavia, Nicolai accettò di scambiare il 1842, anno del Nabucco, Bellini era morto libretto del Nabucco (da lui giudicato un da sei anni, mentre Rossini aveva smesso di centone di “rabbia, invettive, spargimento di comporre opere dal 1829. -

12-26-2018 Traviata Eve.Indd
GIUSEPPE VERDI la traviata conductor Opera in three acts Yannick Nézet-Séguin Libretto by Francesco Maria Piave, production Michael Mayer based on the play La Dame aux Camélias by Alexandre Dumas fils set designer Christine Jones Wednesday, December 26, 2018 costume designer 7:30–10:30 PM Susan Hilferty lighting designer New Production Kevin Adams choreographer Lorin Latarro The production of La Traviata was made possible by a generous gift from The Paiko Foundation Major additional funding for this production was received from Mercedes T. Bass, Mr. and Mrs. Paul M. Montrone, and Rolex general manager Peter Gelb jeanette lerman-neubauer music director Yannick Nézet-Séguin 2018–19 SEASON The 1,018th Metropolitan Opera performance of GIUSEPPE VERDI’S la traviata conductor Yannick Nézet-Séguin in order of vocal appearance violet ta valéry annina Diana Damrau Maria Zifchak flor a bervoix giuseppe Kirstin Chávez Marco Antonio Jordão the marquis d’obigny giorgio germont Jeongcheol Cha Quinn Kelsey baron douphol a messenger Dwayne Croft* Ross Benoliel dr. grenvil Kevin Short germont’s daughter Selin Sahbazoglu gastone solo dancers Scott Scully Garen Scribner This performance Martha Nichols is being broadcast live on Metropolitan alfredo germont Opera Radio on Juan Diego Flórez SiriusXM channel 75 and streamed at metopera.org. Wednesday, December 26, 2018, 7:30–10:30PM MARTY SOHL / MET OPERA Diana Damrau Chorus Master as Violetta and Donald Palumbo Juan Diego Flórez Musical Preparation John Keenan, Yelena Kurdina, as Alfredo in Liora Maurer, and -

7Salzburg Summer 2004
The S ALZBURG FESTIVAL Three Operas; Vienna Philharmonic and Boston Symphony Orchestra Wednesday, August 24th through Thursday, September 1st Schloss Fuschl “One thing is certain: the musical he Salzburg Festival rre - standards at the Salzburg Festival mains the most prestigious are stratospheric… Great conductors and expensive of all summer and tip-top orchestras in the pit, festivals, renowned for its T high level of artistic achieve - including the Vienna Phil har - monic , and you are in heaven.” ment and its elite atmosphere of Opera News European style. We are gratified that our 2016 Tour will encompass a full Cecilia Bartoli: “Com munication week (seven nights) in this charm - remains her great strength. She com - ing town and a varied and balanced pels one to believe in her; her enthusi - program of six unusual perfor - asm is overwhelming.” mances . Our exciting offerings will Opera News include four major vocal perfor - mances (two staged operas; one Pyotr Beczala: “The Polish tenor’s Salzburg concert opera; Bernstein’s West Side high notes are a source of joy – radi - Story) and two orchestral con - ant, effortless, and well-supported.” certs . Every music aficionado is well aware that Salzburg’s San Francisco Chronicle August performances and leading hotels are already sold out months in advance. All of our tickets have been confirmed. “Gustavo Dudamel is defined by his untiring advocacy of access to music for all. As a symphonic and operatic conductor, his music Last summer’s new staging of Mozart’s Le Nozze di Figaro was making on four continents continues to inspire audiences of all ages.” received with unanimous acclaim and will return with an excep - L.A. -

La Ópera En México, 1841-1843
HISTORIA La ópera en México, 1841-1843 por José Octavio Sosa emodelado el Teatro de los Gallos o Provisional, como se le conocía, y al que después se llamó Teatro de la Ópera, se Rpresentó en julio de 1841 la Compañía de Ópera Italiana de Anaide Castellan de Giampietro (Lyon, 1821 - París, 1861) y del empresario Roca. El 9 de octubre de 1822 se había inaugurado ese modesto coliseo, llamado así porque en ese sitio había funcionado un palenque con peleas de gallos, con la obra teatral Aradín Barba Roja o Los piratas en el bosque de los sepulcros, de cuyo autor se desconoce el nombre. El teatro estaba ubicado en la calle Las Moras, actualmente República de Colombia. Un incendio lo destruyó, casi en su totalidad, en 1824. Su propietario, Diego Ramón Somera lo hizo reconstruir, añadiéndole techo de vigas y otras mejoras notables, reinaugurándolo con el nombre de Teatro Provisional, el 21 de agosto de 1825, con la comedia La niña en casa y la madre en las máscaras. Se anunciaron para la temporada de ópera abonos para 90 representaciones, dos o tres por semana, con los siguientes precios: palcos con seis asientos para la temporada, 540 pesos; balcón, 96 pesos; luneta, 86 pesos; galería en primeras filas, 30 pesos; segunda y siguientes, 22 pesos. La orquesta estaba formada por 36 elementos italianos y mexicanos, y el coro por 12 damas y 14 caballeros mexicanos e italianos, destacando en la orquesta el compositor, pianista y violinista irlandés William Vincent Wallace (1812-1865), que fue concertino y director sustituto, además de Vincenzo Bellini (1801-1835) José Ma. -

Giacomo Meyerbeer the Complete Libretti in Eleven Volumes (In the Original and in English Translations by Richard Arsenty With
Giacomo Meyerbeer The Complete Libretti in Eleven Volumes (in the Original and in English Translations by Richard Arsenty with Introductions by Robert Ignatius Letellier) Volume 3 The Meyerbeer Libretti Italian Operas 2 (Emma di Resburgo, Margherita d’Anjou) Edited by Richard Arsenty (translations) and Robert Letellier (introductions) Cambridge Scholars Publishing The Meyerbeer Libretti: Italian Operas 2 (Emma di Resburgo, Margherita d’Anjou), Edited by Richard Arsenty (translations) and Robert Letellier (introductions) This book first published 2004 as part of The Complete Libretti of Giacomo Meyerbeer in Five Volumes. This second edition first published 2008. Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2008 by Richard Arsenty (translations) and Robert Letellier (introductions) All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-84718-963-6, ISBN (13): 9781847189639 As the eleven-volume set: ISBN (10): 1-84718-971-7, ISBN (13): 9781847189714 Giacomo Meyerbeer. Lithograph by Pierre Roche Vigneron (c. 1825) TABLE OF CONTENTS Preface........................................................................................................ ix Introduction