Der Erzmagier (Jacob Philadelphia)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

History of the Jews
II ADVERTISEMENTS Should be in Every Jewish Home AN EPOCH-MAKING WORK COVERING A PERIOD OF ABOUT FOUR THOUSAND YEARS PROF. HE1NRICH GRAETZ'S HISTORY OF THE JEWS THE MOST AUTHORITATIVE AND COMPREHENSIVE HISTORY OF THE JEWS IN THE ENGLISH LANGUAGE HANDSOMELY AND DURABLY BOUND IN SIX VOLUMES Contains more than 4000 pages, a Copious Index of more than 8000 Subjects, and a Number of Good Sized Colored Maps. SOME ENTHUSIASTIC APPRECIATIONS DIFFICULT TASK PERFORMED WITH CONSUMMATE SKILL "Graetz's 'Geschichte der Juden1 has superseded all former works of its kind, and has been translated into English, Russian and Hebrew, and partly into Yiddish and French. That some of these translations have been edited three or four times—a very rare occurrence in Jewish literature—are in themselves proofs of the worth of the work. The material for Jewish history being so varied, the sources so scattered in the literatures of all nations, made the presentation of this history a very difficult undertaking, and it cannot be denied that Graetz performed his task with consummate skill."—The Jewish Encyclopedia. GREATEST AUTHORITY ON SUBJECT "Professor Graetz is the historiographer par excellence of the Jews. His work, at present the authority upon the subject of Jewish History, bids fair to hold its pre-eminent position for some time, perhaps decades."—Preface to Index Volume. MOST DESIRABLE TEXT-BOOK "If one desires to study the history of the Jewish people under the direction of a scholar and pleasant writer who is in sympathy with his subject, because he is himself a Jew, he should resort to the volumes of Graetz."—"Review ofRevitvit (New York). -

Appendices (1936-1937)
ANNIVERSARIES AND OTHER CELEBRATIONS UNITED STATES July 7, 1935. New York City: Seventy-fifth anniversary of birth of ABRAHAM CAHAN, editor of Jewish Daily Forward. July 7, 1935. Seattle, Wash.: Celebration of eightieth anniversary of birth of SAMUEL R. STERN, judge, veteran member of B'nai B'rith. July 9, 1935. Brooklyn, N. Y.: Sixty-fifth birthday anniversary of MITCHELL MAY, New York State Supreme Court Judge. July 12, 1935. Pittsburgh, Pa.: Celebration of seventy-fifth anniver- sary of birth of HENRY KAUFMANN, philanthropist. July 28, 1935. Portland, Ore.: Eightieth anniversary of birth of I. BROMBERG, communal worker. October 1, 1935. Cincinnati, Ohio: Celebration of seventy-fifth an- niversary of birth of N. HENRY BECKMAN, communal leader. October 18-19, 1935. Baltimore, Md.: Celebration of twentieth anniversary of ministry of MORRIS S. LAZARON, as rabbi of Baltimore Hebrew Congregation. October 24, 1935. Cincinnati, Ohio: Celebration of eighty-fifth an- niversary of birth of CHARLES SHOHL, communal leader. October 24, 1935. Chicago, 111.: Twentieth anniversary of service on the bench of SAMUEL ALSCHULER, Judge of the United States Circuit Court of Appeals, celebrated by the Chicago Bar Association. October 25, 1935. Brooklyn, N. Y.: Celebration of twentieth anniver- sary of the JEWISH COMMUNAL CENTER OF FLATBUSH. October 25, 1935. Jackson, Mich.: Celebration of seventy-fifth an- niversary of founding of TEMPLE BETH ISRAEL. October, 1935. Minneapolis, Minn.: Celebration of eightieth anniver- sary of birth of MRS. HENRY WEISKOPF, communal worker. November 12, 1935. New York City: Sixtieth anniversary of birth of NATHAN RATNOFF, medical director of Beth Israel Hospital and of Jewish Maternity Hospital. -

Haskala Und Hokuspokus: Die Biographie Jakob Philadelphias (Ca. 1734-1797) Und Ihre Implikationen Für Die Deutsch-Jüdische Geschichte Jütte, Daniel
www.ssoar.info Haskala und Hokuspokus: die Biographie Jakob Philadelphias (ca. 1734-1797) und ihre Implikationen für die deutsch-jüdische Geschichte Jütte, Daniel Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: Verlag Barbara Budrich Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Jütte, D. (2007). Haskala und Hokuspokus: die Biographie Jakob Philadelphias (ca. 1734-1797) und ihre Implikationen für die deutsch-jüdische Geschichte. BIOS - Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 20(1), 40-51. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-270410 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-SA Lizenz (Namensnennung- This document is made available under a CC BY-SA Licence Weitergabe unter gleichen Bedingungen) zur Verfügung gestellt. (Attribution-ShareAlike). For more Information see: Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de Haskala und Hokuspokus Die Biographie Jakob Philadelphias (ca. 1734-1797) und ihre Implikationen für die deutsch-jüdische Geschichte Daniel Jütte Nachdem Napoleon Auskunft über einen gewissen im fernen Königsberg wirkenden Immanuel Kant verlangt und daraufhin auf einigen Quartseiten eine Einführung in dessen vertrackte Philosophie erhalten hatte, soll er den Deutschen verächtlich in eine Reihe mit Cagliostro und Philadelphia gestellt haben. So will es zumindest Heinrich Heine in seiner Lutetia (1855) wissen (Heine 1981, 401). Die Pointe, also der Ver- gleich von Kant mit Cagliostro, dem neapolitanischen Scharlatan, hat an amüsanter Prägnanz seit Heines Zeiten nichts eingebüßt. Sie erschließt sich wohl nach wie vor den allermeisten Lesern. -
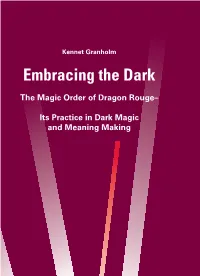
Embracing the Dark ÅA
Embracing The Dark ÅA The study of Western Esotericism is an the Dark Embracing Granholm: Kennet emerging academic fi eld with research mainly Kennet Granholm being carried out on historic currents ranging from the renaissance to early modern Europe, and on ”The New Age Movement”. The mode of spirituality called the Left Hand Path has, Embracing the Dark however, not yet attracted the attention of academia. The present study of the dark The Magic Order of Dragon Rouge– magic order DRAGON ROUGE constitutes an attempt to contribute thoroughly and Its Practice in Dark Magic creatively to this line of research. Objects of study are the organization, philosophy and Meaning Making and practices of the order, as well as the complex discursive conventions involved in the adherents’ construction of coherent world views. In an attempt to shed light on the particularities of this contemporary, late modern esoteric phenomenon, a historical perspective on Western Esotericism has here been combined with a discussion on the impact of recent societal change. Åbo Akademi University Press ISBN 951-765-251-8 2005 Kennet Granholm born 1977 M.A. Åbo Akademi University 2001 Researcher Department of Comparative Religion, Åbo Akademi University Cover: Tove Ahlbäck Åbo Akademi University Press Tavastg. 30 C, FIN-20700 ÅBO, Finland Tel. int. +358-2-215 3292 Fax int. +358-2-215 4490 E-mail: forlaget@abo.fi http://www.abo.fi /stiftelsen/forlag/ Distribution: Oy Tibo-Trading Ab P.O.Box 33, FIN-21601 PARGAS, Finland Tel. int. +358-2-454 9200 Fax int. +358-2-454 9220 E-mail: [email protected] http://www.tibo.net Kennet Granholm born 1977 M.A. -

Anniversaries and Other Celebrations
ANNIVERSARIES AND OTHER CELEBRATIONS UNITED STATES July 23, 1933. Celebration of Eight hundred and twenty-fifth anni- versary of death of RASHI, at Congregation Beth Sholom, Brooklyn, N. Y., by newly organized Descendants of Rashi. July 26, 1933. New York City: Eightieth anniversary of birth of PHILIP COWEN, former publisher of Jewish weekly and communal worker. August 4, 1933. New York City: Ninetieth anniversary of birth of MRS. SELMA BONDI WISE, widow of Isaac M. Wise, leader of Reform Judaism in the United States. August 25, 1933. New York City: Seventieth anniversary of birth of MOSES HYAMSON, rabbi and Professor of Codes at Jewish Theological Seminary of America. September 2-3, 1933. St. Louis, Mo.: Fiftieth anniversary of BETH HAMEDRASH HAGODOL CONGREGATION. September 13, 1933. Philadelphia, Pa.: Seventieth anniversary of birth of CYRUS ADLER, communal leader and scholar. September 23, 1933. New York City: Sixtieth anniversary of ministry of HENRY PEREIRA MENDES, as rabbi and rabbi emeritus of Shearith Israel Congregation. October 13, 1933. Cincinnati, Ohio: Ninetieth anniversary of B'NAI B'RITH. November 5, 1933. Maiden, Mass.: Twenty-fifth anniversary of HEBREW LADIES' CHARITY SOCIETY. November 7, 1933. Minneapolis, Minn.: Twenty-fifth anniversary of founding of TEMPLE ISRAEL. November 9, 1933. New York City: Ninetieth anniversary of NEW YORK LODGE, NO. 1 of B'NAI B'RITH. November 24-26, 1933. Philadelphia, Pa.: Seventy-fifth anniversary of founding of CONGREGATION ADATH JESHURUN. November 28, 1933. Boston, Mass.: Twenty-fifth anniversary of JEWISH CHILDRENS' AID SOCIETY. December 1-3, 1933. Amsterdam, N. Y.: Celebration of Sixtieth anniversary of founding of TEMPLE OF ISRAEL. -

THE AMERICAN YAWP READER a Documentary Companion to the American Yawp Volume II
THE AMERICAN YAWP READER A Documentary Companion to the American Yawp Volume II [http://www.americanyawp.com/reader.html] 1 Table of Contents Introduction .................................................................................................................... 7 16. Capital and Labor ....................................................................................................... 9 William Graham Sumner on Social Darwinism (ca.1880s) .............................................10 Henry George, Progress and Poverty, Selections (1879)......................................................12 Andrew Carnegie’s Gospel of Wealth (June 1889) ........................................................14 Grover Cleveland’s Veto of the Texas Seed Bill (February 16, 1887) ..............................16 The “Omaha Platform” of the People’s Party (1892) ....................................................18 Dispatch from a Mississippi Colored Farmers’ Alliance (1889) ......................................23 The Tournament of Today – A Set-To Between Labor and Monopoly ..........................27 Lawrence Textile Strike (1912) .....................................................................................28 17. The West ..................................................................................................................29 Chief Joseph on Indian Affairs (1877, 1879) .................................................................30 William T. Hornady on the Extermination of the American Bison (1889) ......................32 -

Annual Report
AMERICAN BAPTIST MISSIONARY UNION. ç Û ^ ^ n S I ' ^ >. ----------------------------— }" ' I s .. ü f.iq e ! ’ ; r*S I r fcVi 1*5^ F O R T IE T H \ i ; ;, R pv $J> y ANNUAL REPORT: WITH THE PROCEEDINGS OF THE ANNUAL MEETINGS, HELD AT PHILADELPHIA, MAY 16-19, 1854. BOSTON: MISSIONARY ROOMS, 33 SOMERSET STREET. 1 8 5 4 . INDEX. Page. F o r t i e t h A n n u a l M e e t i n g o f t h e B o a r i >,............................................................... 3 Reports o f Committees:— Publication, 6; Siam and China Missions, 8 ; Euro pean Missions, 10 ; Indian Missions,...................................................................... 11 Annual M eeting of t h e U n i o n , ........................................................................................ 14 Members present, ............................................................................................................. 14 Report o f the Board to the Union, ............................................................................... 17 Reports o f Committees:— Bassa Mission, 18; Burmese Missions, 19 ; Teloogoo and Assam Missions, 20; Agencies, 21; Obituaries,....................................... 22 Importance and means o f Equalizing the Receipts o f the Missionary Unhn, • • • 23 Report:— Finances,....................................................................................................... 20 Amendment o f the Constitution,................................................................................... 27 Election o f Officers and Managers, ............................................................................ -

JEWISH STATISTICS the Statistics of Jews in the World Rest Largely Upon Estimates
66 AMERICAN JEWISH YEAR BOOK JEWISH STATISTICS The statistics of Jews in the world rest largely upon estimates. In Russia, Austria-Hungary, Germany, and a few other countries, official figures are obtainable. In the main, however, the num- bers given are based upon estimates repeated and added to by one statistical authority after another. For the statistics given below various authorities have been consulted, among them the " Statesman's Year Book" for 1908, the English " Jewish Year Book" for 56C8, " The Jewish Ency- clopedia," Jiidische Statistik, and the Alliance Israelite Uni- verselle reports. Some of the statements rest upon the authority of competent individuals, as for South Africa and Curagoa. THE UNITED STATES ESTIMATES As the census of the United States has, in accordance with the spirit of American institutions, taken no heed of the religious convictions of American citizens, whether native-born or natural- ized, all statements concerning the number of Jews living in this country are based upon estimates. The Jewish population was estimated In 1818 by Mordecai M. Noah at 3,000 In 1824 by Solomon Etting at 6,000 In 1826 by Isaac C. Harby at 6,000 In 1840 by the American Almanac at 15,000 In 184S by M. A. Berk at 50,000 In 1880 by Wm. B. Hackenburg at 230,257 In 1888 by Isaac Markens at 400,000 In 1897 by David Sulzberger at 937,800 DISTRIBUTION The following table by States presents two sets of estimates. In the left-hand column is given the estimated Jewish population of each State for 1905 as it appears in the " Jewish Encyclopedia," Vol. -
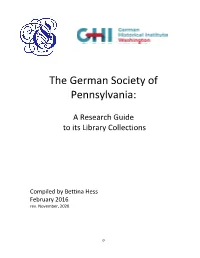
Research Guide to Its Library Collections
& The German Society of Pennsylvania: A Research Guide to its Library Collections Compiled by Bettina Hess February 2016 rev. November, 2020 0 Introduction p. 2 History and Brief Overview of the Collections p. 2 Books Main Collection p. 5 German American Collection p. 9 Carl Schurz Collection p. 30 Reference Collection p. 30 Pamphlets Main Collection p. 31 German American Collection p. 31 cataloged p. 31 uncataloged legal size boxes with call numbers p. 40 legal size boxes without call numbers p. 52 Carl Schurz Collection pamphlet box lists p. 54 Ephemera German American Collection Letter size boxes with call numbers p. 148 Letter size boxes without call numbers p. 163 Legal size boxes without call numbers p. 176 Manuscripts Mss. I Collections with finding aids p. 179 Collections with catalog entries p. 199 collections by size with inventories: Mss. IIa -- Letter size boxes p. 202 Mss. IIb -- Legal size boxes p. 207 Mss. III -- flat boxes (12 x 16 “) p. 210 Mss. IV -- flat boxes (14 x 18 “) p. 215 Mss. Oversize (20 x 24”) p. 219 Mss. Oversize Gallery (24 x 36”) p. 224 Minimally processed manuscript collections p. 228 Newspapers/Periodicals Newspapers on microfilm p. 292 German American imprints -- bound volumes p. 296 German imprints -- bound volumes p. 313 1 Introduction This research guide to the German Society of Pennsylvania’s Joseph Horner Memorial Library is an update to the original guide written by Kevin Ostoyich in 2006 (The German Society of Pennsylvania: A Guide to its Book and Manuscript Collections) and published by the German Historical Institute. -

Annual Report
amEKiC^ tv &A rrrsr F o f t a f c f c ? ^ * 5 «3 •' /w/s«./ä?v -so¿ '¿Fry, 1 AMERICAN BAPTIST MISSIONARY UNION, THIRTY-NINTH ANNUAL REPORT: WITH THE PROCEEDINGS OF THE ANNUAL MEETINGS, H E L D A T ALBANY, N. Y., MAY 17-20,1853. BOSTON: MISSIONARY BOOMS, 83 SOMERSET STREET. 1853. HALE M flfflT SCB; Page. T h ir t y -n in t h A n n u a l M e e t in g o p t h e B o a r d , .................................................. 3 Reports of Committees: — Obituaries, 6 ; Deputation to Asiatic Missions, 8 ; Siam and China Missions, 8 ; A g e n c ie s, 1 0 ; Publications, 1 1 ; F in a n ces, 1 2 ; Burman Missions, 15; Bassa Mission, 16; French and Greek Missions, 18; Indian Missions,.................................................................................. 19 A n n u a l M e e t in g o f t h e U n io n , .................................................................................... 22 Members present, ................................................................................................................................... 22 Report o f the Board to the Union, .............................................................................................. 26 Reinforcement or Relinquishment o f the Teloogoo Mission,.......................................... 27 Report:— A ssam an d T elo o g o o M issio n s,............................................................................... 29 Election o f Officers and Managers,............................................................................................ 30 Report:— -

Appendices I. Anniversaries and Celebrations
APPENDICES I. ANNIVERSARIES AND CELEBRATIONS UNITED STATES July 15, 1930. New York City: Celebration of seventieth anniversary of the birth of ABRAHAM CAHAN, labor leader, editor and author. August 9, 1930. New York City: Celebration of seventy-fifth anni- versary of the birth of MORRIS WINCHEWSKI, author. December 21, 1930. New York City: Celebration of seventieth anni- versary of the birth of HENRIETTA SZOLD, Zionist and communal leader. January 4, 1931. Detroit, Mich.: Celebration of eightieth anniversary of founding of TEMPLE BETH EL. January 14, 1931. New York City: Celebration of sixtieth anniversary of the birth of FELIX M. WARBURG, banker, philanthropist, communal and civic leader. February 6, 1931. Washington, D. C: Celebration of seventy-fifth anniversary of founding of WASHINGTON HEBREW CONGREGATION. April 25, 1931. New York City: Celebration of seventieth anniversary of the birth of EDWIN R. A. SELIGMAN, economist. April 26, 1931. New York City: Celebration of seventy-fifth anni- versary of the birth of HENRY MORGENTHAU, former ambassador to Turkey, communal worker. March 1, 1931. Brooklyn, N. Y.: Celebration of seventy-fifth anni- sary of founding of CONGREGATION BETH ISRAEL ANSHE EMETH. May 19, 1931. New York City: Celebration of seventy-fifth anniver- sary of the birth of Z. H. MASLIANSKY, Zionist leader. OTHER COUNTRIES July 16, 1930. Milan, Italy: Celebration of one hundredth anniversary of the birth of GRAZIADIO ISAIAH ASCOLI, philologist. August 14, 1930. Tel Aviv, Palestine: Celebration of seventieth anni- versary of the birth of I. H. RAVNITZKY, publisher, editor, author. September 5, 1930. Konigsberg, Germany: Celebration of eightieth anniversary of the birth of EUGEN GOLDSTEIN, physicist. -

Wiener Taschenspieler Im Ausgehenden 18. Jahrhundert Und in Der Biedermeierzeithans Pemmer
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich Jahr/Year: 1961-1963 Band/Volume: 35 Autor(en)/Author(s): Pemmer Hans Artikel/Article: Wiener Taschenspieler im ausgehenden 18. Jahrhundert und in der Biedermeierzeit 106-123 ©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html Wiener Taschenspieler im ausgehenden 18. Jahr hundert und in der Biedermeierzeit Von Hans P e m m e r Schon im Mittelalter strömten fahrende Leute zu den Jahrmärk ten, um dort ihre Künste zu zeigen. Unter ihnen befanden sich natür lich auch Taschenspieler, die dem Bedürfnis der Menge, scheinbar unerklärliche Vorkommnisse zu bestaunen, entgegenkamen. Aber erst um 1700 treten Taschenspieler urkundlich und in der Literatur in Er scheinung. So lesen wir, daß am 26. Oktober 1690 beim Roten Turm im Hause zum „Küssdenpfennig“ dem Taschenspieler Jeremias Zicar sein Kind stirbt 1. Eine literarische Erwähnung eines Taschenspielers aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts findet sich in des reiselustigen Minoriten Georg König von Solothurn Beschreibung seiner Reise nach Wien: „Nachmittag wurd im spihlhauss unter dem titul leben und todt Doctor Faustus vorgestellet; unter anderen ein koch hervorkame, der alles, wass zu einer taffel gehört, tisch, stühl, blatten mit speisen etc. aus dem sack gezogen" 2. Natürlich gehörten Taschenspieler zur untersten sozialen Schichte und ihnen widerfährt die Ehre einer amtlichen Erwähnung meist nur nach ihrem Tode, wenn sie in einem Spital ihr sorgenvolles Le ben beschließen, wie es etwa bei Susanne Krebschek, einer Taschenspielersgattin, die am 22. Februar 1738 im Krankenhaus an Schlagfluß stirbt3 oder bei dem Taschen- und Marionettenspieler Simon Reiter (Reuther), dessen Leben am 2.