Zur Homepage Der Dissertation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Second Uncorrected Proof ~~~~ Copyright
Into the Groove ~~~~ SECOND UNCORRECTED PROOF ~~~~ COPYRIGHT-PROTECTED MATERIAL Do Not Duplicate, Distribute, or Post Online Hurley.indd i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11/17/2014 5:57:47 PM Studies in German Literature, Linguistics, and Culture ~~~~ SECOND UNCORRECTED PROOF ~~~~ COPYRIGHT-PROTECTED MATERIAL Do Not Duplicate, Distribute, or Post Online Hurley.indd ii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11/17/2014 5:58:39 PM Into the Groove Popular Music and Contemporary German Fiction Andrew Wright Hurley Rochester, New York ~~~~ SECOND UNCORRECTED PROOF ~~~~ COPYRIGHT-PROTECTED MATERIAL Do Not Duplicate, Distribute, or Post Online Hurley.indd iii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11/17/2014 5:58:39 PM This project has been assisted by the Australian Government through the Australian Research Council. The views expressed herein are those of the author and are not necessarily those of the Australian Research Council. Copyright © 2015 Andrew Wright Hurley All Rights Reserved. Except as permitted under current legislation, no part of this work may be photocopied, stored in a retrieval system, published, performed in public, adapted, broadcast, transmitted, recorded, or reproduced in any form or by any means, without the prior permission of the copyright owner. First published 2015 by Camden House Camden House is an imprint of Boydell & Brewer Inc. 668 Mt. Hope Avenue, Rochester, NY 14620, USA www.camden-house.com and of Boydell & Brewer Limited PO Box 9, Woodbridge, Suffolk IP12 3DF, UK www.boydellandbrewer.com ISBN-13: 978-1-57113-918-4 ISBN-10: 1-57113-918-4 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data CIP data applied for. This publication is printed on acid-free paper. Printed in the United States of America. -
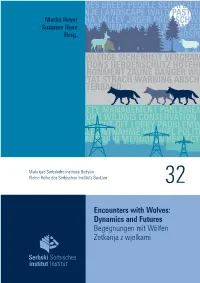
Encounters with Wolves
Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen 32 Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami 32 · 2020 Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami © 2020 Serbski institut Budyšin Sorbisches Institut Bautzen Dwórnišćowa 6 · Bahnhofstraße 6 D-02625 Budyšin · Bautzen Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž T +49 3591 4972-0 dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na F +49 3591 4972-14 zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych www.serbski-institut.de wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborska a Sakskeho krajneho sejma. [email protected] Gefördert durch die Stiftung für das sorbische Redakcija Redaktion Volk, die jährlich auf der Grundlage der von den Marlis Heyer, Susanne Hose Abgeordneten des Deutschen Bundestages, des Landtages Brandenburg und des Sächsischen Wuhotowanje Gestaltung Landtages beschlossenen Haushalte Zuwen- Ralf Reimann, Büro für Gestaltung, dungen aus Steuermitteln erhält. Bautzen Ćišć Druck Grafik S. 33 unter Verwendung eines 32 Union Druckerei Dresden GmbH Scherenschnitts von Elisabeth Müller, Collmen Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin ISBN 978-3-9816961-7-2 Grafik S. 87 nach GEO-Karte 5/2018 Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Page Content 5 Marlis Heyer and Susanne Hose Vorwort · Preface 23 Emilia -

Raoul Hausmann and Berlin Dada Studies in the Fine Arts: the Avant-Garde, No
NUNC COCNOSCO EX PARTE THOMAS J BATA LIBRARY TRENT UNIVERSITY Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation https://archive.org/details/raoulhausmannberOOOObens Raoul Hausmann and Berlin Dada Studies in the Fine Arts: The Avant-Garde, No. 55 Stephen C. Foster, Series Editor Associate Professor of Art History University of Iowa Other Titles in This Series No. 47 Artwords: Discourse on the 60s and 70s Jeanne Siegel No. 48 Dadaj Dimensions Stephen C. Foster, ed. No. 49 Arthur Dove: Nature as Symbol Sherrye Cohn No. 50 The New Generation and Artistic Modernism in the Ukraine Myroslava M. Mudrak No. 51 Gypsies and Other Bohemians: The Myth of the Artist in Nineteenth- Century France Marilyn R. Brown No. 52 Emil Nolde and German Expressionism: A Prophet in His Own Land William S. Bradley No. 53 The Skyscraper in American Art, 1890-1931 Merrill Schleier No. 54 Andy Warhol’s Art and Films Patrick S. Smith Raoul Hausmann and Berlin Dada by Timothy O. Benson T TA /f T Research U'lVlT Press Ann Arbor, Michigan \ u » V-*** \ C\ Xv»;s 7 ; Copyright © 1987, 1986 Timothy O. Benson All rights reserved Produced and distributed by UMI Research Press an imprint of University Microfilms, Inc. Ann Arbor, Michigan 48106 Library of Congress Cataloging in Publication Data Benson, Timothy O., 1950- Raoul Hausmann and Berlin Dada. (Studies in the fine arts. The Avant-garde ; no. 55) Revision of author’s thesis (Ph D.)— University of Iowa, 1985. Bibliography: p. Includes index. I. Hausmann, Raoul, 1886-1971—Aesthetics. 2. Hausmann, Raoul, 1886-1971—Political and social views. -

Deutsche Nationalbibliografie 2018 T 08
Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2018 T 08 Stand: 08. August 2018 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2018 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-201711171880 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie sche Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Wer- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ke (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD (PM)“ zugrunde. -

ŸƑ螱Ʃ·ļšè¯º Éÿ³æ
å¸ƒèŽ±æ© Â·ä¼Šè¯º 音樂專輯 串行 (专辑 & æ—¶é— ´è¡¨) Another Green World https://zh.listvote.com/lists/music/albums/another-green-world-771427/songs https://zh.listvote.com/lists/music/albums/ambient-1%3A-music-for-airports- Ambient 1: Music for Airports 127100/songs Thursday Afternoon https://zh.listvote.com/lists/music/albums/thursday-afternoon-7799409/songs Wrong Way Up https://zh.listvote.com/lists/music/albums/wrong-way-up-128940/songs Before and After Science https://zh.listvote.com/lists/music/albums/before-and-after-science-676884/songs Ambient 4: On Land https://zh.listvote.com/lists/music/albums/ambient-4%3A-on-land-958618/songs Discreet Music https://zh.listvote.com/lists/music/albums/discreet-music-2058212/songs Music for Films https://zh.listvote.com/lists/music/albums/music-for-films-39267/songs https://zh.listvote.com/lists/music/albums/apollo%3A-atmospheres-and- Apollo: Atmospheres and Soundtracks soundtracks-3282479/songs Cluster & Eno https://zh.listvote.com/lists/music/albums/cluster-%26-eno-2980401/songs After The Heat https://zh.listvote.com/lists/music/albums/after-the-heat-4690656/songs Another Day on Earth https://zh.listvote.com/lists/music/albums/another-day-on-earth-279977/songs https://zh.listvote.com/lists/music/albums/fourth-world%2C-vol.-1%3A-possible- Fourth World, Vol. 1: Possible Musics musics-8135341/songs Nerve Net https://zh.listvote.com/lists/music/albums/nerve-net-3492507/songs Music for Films III https://zh.listvote.com/lists/music/albums/music-for-films-iii-6941772/songs January 07003: Bell -

Theatre on Trial: Staging Postwar Justice in the United States and Germany
Theatre on Trial: Staging Postwar Justice in the United States and Germany Minou Arjomand SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THE GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES COLUMBIA UNIVERSITY 2013 © 2013 Minou Arjomand All rights reserved ABSTRACT Theatre on Trial: Staging Postwar Justice in the United States and Germany Minou Arjomand This dissertation studies the interchange between political theatre and postwar political trials. I argue that to an extraordinary extent, theatre history in this period is inextricable from trial history. Through close archival study of mid-century theatre productions including Bertolt Brecht’s 1954 production of The Caucasian Chalk Circle and the fifteen simultaneous premiere productions of Peter Weiss’s The Investigation in 1965, I show how directors and playwrights looked to legal trials in order to develop and articulate theories of epic and documentary theatre, and how this new theatre in turn sought to effect justice in ways that trials alone could not. Table of Contents Introduction 1 Chapter 1 From Aeschylus to Kafka: Hannah Arendt’s Judgments 17 Chapter 2 Bertolt Brecht: Staging the Law 63 Chapter 3 Erwin Piscator: Cases and Documents 114 Chapter 4 Peter Weiss: Investigations, East and West 156 Afterword 192 Bibliography 196 i Acknowledgements My deepest thanks go to W.B. Worthen, who sponsored this dissertation, and the members of my dissertation committee for their suggestions and support: Judith Butler, Lydia Goehr, Andreas Huyssen, and Bruce Robbins. ii 1 Introduction In the early spring of 1969, Hjalmar Schacht traveled from Munich to see a play at Vienna’s Burgtheater. -

Works Cited in Alex Ross's the Rest Is Noise
Works Cited in Alex Ross’s The Rest Is Noise Collections: Berlin Document Center, microfilm copies at National Archives II, College Park, MD. Leonard Bernstein Collection, Music Division, Library of Congress. Aaron Copland Collection, Music Division, Library of Congress. Records of the Federal Music Project, RG 69, National Archives II, College Park, MD. Morton Feldman Papers, Music Library, University at Buffalo, State University of New York. George Gershwin Collection, Music Division, Library of Congress. Serge Koussevitzky Archive, Music Division, Library of Congress. Alma Mahler-Werfel Collection, University of Pennsylvania. Records of the Office of Military Government, United States, RG 260, National Archives II, College Park, MD. Princeton Radio Research Project, Paul Lazarsfeld Papers, Columbia University. Britten-Pears Library, Aldeburgh, England. Arnold Schönberg Center, Vienna. Third Reich Collection, Rare Book and Special Collections, Library of Congress. Bernd Alois Zimmermann Collection, Archives of the Akademie der Künste, Berlin. Interviews: John Adams, Thomas Adès, Björk, Russell Campitelli, Alexander Dunkel, Osvaldo Golijov, György Ligeti, Donald Mitchell, Carlos Moseley, Kent Nagano, David Raksin, Steve Reich, Esa-Pekka Salonen, Alfred Schnittke, Ronald Schoenberg, Christian Strauss, Michael Tilson Thomas, Milton Weiss. Published sources: Adorno, Theodor W. Aesthetic Theory, ed. Gretel Adorno and Rolf Tiedemann, trans. C. Lenhardt (Routledge, 1984). ______. Alban Berg: Master of the Smallest Link, trans. Juliane Brand and Christopher Hailey (Cambridge University Press, 1991). ______. Essays on Music, ed. Richard Leppert, trans. Susan H. Gillespie (University of California Press, 2002). ______. “Kritik des Musikanten,” in Gesammelte Schriften (Suhrkamp, 1973), vol. 14, pp. 67–107. ______. Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, trans. E.F.N. -

„CONNECTION-SHIP“ Wie Begegnungen Im Kunststudio
„CONNECTION-SHIP“ Wie Begegnungen im Kunststudio Menschen verbinden und soziale Veränderungen hervorrufen How encounters in the art studio connect people and induce social change Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie Eingereicht an der Universität für angewandte Kunst Wien bei: Betreuer: Univ. – Prof. Virgil Widrich Fach: Art & Science Externer Beurteiler: Univ. – Doz. Dr. Arno Böhler Universität Wien, Institut für Philosophie Externe Beurteilerin: Univ. - Prof. Dr. Ruth Sonderegger Akademie der Bildenden Künste Wien, Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften Vorgelegt von Sergio Patricio Valenzuela Valdés, MA Wien, im August 2020 Ich erkläre hiermit, dass ich die Dissertation entsprechend den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis selbständig verfasst und keine anderen als die angegeben Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, sowie dass diese Dissertation bisher weder im In- noch im Ausland in irgendeiner Form zur Beurteilung vorgelegt wurde. August 2020, Wien ___ ___ 3 Ausgangspunkt der Studie/ Diese Studie basiert auf der Beobachtung isolierter Wissenschaftler*innen in Laboren, die in Teams zusammenarbeiten. Die Forschung macht einen Sprung in/fokussiert dabei auf das Thema, was es ausmacht / das Besondere daran ist, dass diese Wissenschaftler*innen – „aneinander klebend“ – zusammenarbeiten können. Existiert etwas Ähnliches in der Kunst? Um in dieses Feld einzutreten, wurde der „Körper“ als Linse der Beobachtung von Wahrnehmung und Bewusstsein im Lernprozess während der Beziehungserfahrung -

Zwischenräume Erzählungen, Essays, Randbemerkungen
Herbert W. Jardner Zwischenräume Erzählungen, Essays, Randbemerkungen Sonderausgabe Vingilot Press Berlin, im Januar 2019 1 Und zum Glück ist es der Sage erlaubt, mancherlei zu erzählen, was man der Geschichte vielleicht nicht glauben würde. Auguste Lechner 2 Inhalt Auftakt: Welche Realität, Papa? 5 Das Glück des Gehens 6 Eins 6 Zwei 10 Drei 13 Im Nahraum Brandenburg 22 Ein Yogin im Hinterwald 29 Fisterra Blues 35 Eins 35 Zwei 41 Drei 47 Lichträger in dunkler Zeit. Mythologie für Astrologen 52 Camille Claudel: Ein Leben im Zeichen Schütze 52 Chiron als Mitherrscher im Schützen 53 Lichtträger in dunkler Zeit 55 Chirons Dilema in der Biographie Jugendlicher 60 Anmerkungen 68 Der Baum von Gernika 73 Kamm und Flöte. Ein ethnopoetischer Diskurs 80 Eins 80 Zwei 81 Drei 83 Zwischen den Stühlen. Ein modernes Initiationsmärchen 85 Bücher, Portale, Initiationen 90 Niemalsland: Das doppelte London 91 Schwellenwesen und Grenzgänger 95 Richard betwixt and between 100 Re-Integration in Ober-London 108 Anmerkungen 114 Ausklang: Zwischen einst und jetzt 120 3 Quellen Einige der in diesem Band gesammelten Schriften habe ich im Verlauf der letzten Jahrzehnte in meinem Wissenschaftsforum Vingilot – Beiträge zur Anthropologie online veröffentlicht. Bei anderen handelt es sich um Kapitel aus noch unveröffentlichten Reiseerzählungen. Prolog: Welche Realität, Papa? Vingilot, 2009. Das Glück des Gehens, in: Pilgern in Brandenburg. Unterwegs ins Dritte Alter, Vingilot 2016 [https://hwjblogs.wordpress.com/2016/05/15/moving-my-way/]. Im Nahraum Brandenburg, unveröffentlicht, 2017. Ein Yogin im Hinterwald, in: Die Söhne Timors, unveröffentlichtes Forschungsmanuskript, 1996-2006. Fisterra Blues, in: Himmelspfad und Sternenfeld, unveröffentlichte Reiseerzählung, 2018. Lichträger in dunkler Zeit, Mythologische Reflexionen für Astrologen, Vingilot, 2015 [https://gruenesonnen.wordpress.com/2015/03/29/lichttrager-in-dunkler-zeit/]. -

The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 31: Hitler and the Germans
The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 31: Hitler and the Germans Detlev Clemens Brendan Purcell, Editors University of Missouri Press the collected works of ERIC VOEGELIN VOLUME 31 HITLER AND THE GERMANS This page intentionally left blank projected volumes in the collected works 1. On the Form of the American Mind 2. Race and State 3. The History of the Race Idea: From Ray to Carus 4. The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian State 5. Political Religions; The New Science of Politics; and Science, Politics, and Gnosticism 6. Anamnesis 7. Published Essays, 1922– 8. Published Essays 9. Published Essays 10. Published Essays 11. Published Essays 12. Published Essays, 1966–1985 13. Selected Book Reviews 14. Order and History, Volume I, Israel and Revelation 15. Order and History, Volume II, The World of the Polis 16. Order and History, Volume III, Plato and Aristotle 17. Order and History, Volume IV, The Ecumenic Age 18. Order and History, Volume V, In Search of Order 19. History of Political Ideas, Volume I, Hellenism, Rome, and Early Christianity 20. History of Political Ideas, Volume II, The Middle Ages to Aquinas 21. History of Political Ideas, Volume III, The Later Middle Ages 22. History of Political Ideas, Volume IV, Renaissance and Reformation 23. History of Political Ideas, Volume V, Religion and the Rise of Modernity 24. History of Political Ideas, Volume VI, Revolution and the New Science 25. History of Political Ideas, Volume VII, The New Order and Last Orientation 26. History of Political Ideas, Volume VIII, Crisis and the Apocalypse of Man 27. -
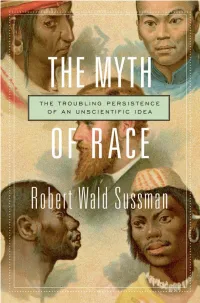
The Myth of Race
THE MYTH OF RACE THE MYTH OF RACE The Troubling Per sis tence of an Unscientific Idea Robert Wald Sussman Cambridge, Massachusetts London, En gland 2014 Copyright © 2014 by the President and Fellows of Harvard College All rights reserved Printed in the United States of America First Printing Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Sussman, Robert W., 1941– The myth of race : the troubling per sis tence of an unscientifi c idea / Robert Wald Sussman. pages cm Includes bibliographical references and index. ISBN 978- 0- 674- 41731- 1 (hardcover : alk. paper) 1. Race. 2. Racism. I. Title. HT1521.S83 2014 305.8—dc23 2014011078 I dedicate this book to my wife, Linda; my two daughters, Katya and Diana; and my students Contents List of Abbreviations viii Introduction 1 1 Early Racism in Western Europe 11 2 The Birth of Eugenics 43 3 The Merging of Polygenics and Eugenics 64 4 Eugenics and the Nazis 107 5 The Antidote: Boas and the Anthropological Concept of Culture 146 6 Physical Anthropology in the Early Twentieth Century 165 7 The Downfall of Eugenics 200 8 The Beginnings of Modern Scientifi c Racism 210 9 The Pioneer Fund, 1970s– 1990s 235 10 The Pioneer Fund in the Twenty- First Century 249 11 Modern Racism and Anti- Immigration Policies 273 Conclusion 302 Appendix A: The Eugenics Movement, 1890s–1940s 309 Appendix B: The Pioneer Fund 311 References 315 Ac know ledg ments 351 Index 353 Abbreviations AA American Anthropologist AAA American Anthropological Association AAAS American Association for the Advancement of Science AAPA American Association of Physical Anthropologists ABA American Breeders Association AES American Eugenics Society AICF American Immigration Control Foundation AR American Re nais sance CIW Carnegie Institution of Washington, D.C. -

Grüne Sonnen: Poetik Und Politik Der Fantasy Am Medium Videospiel 2020
Repositorium für die Medienwissenschaft Daniel Illger Grüne Sonnen: Poetik und Politik der Fantasy am Medium Videospiel 2020 https://doi.org/10.25969/mediarep/14023 Veröffentlichungsversion / published version Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Illger, Daniel: Grüne Sonnen: Poetik und Politik der Fantasy am Medium Videospiel. Berlin: De Gruyter 2020 (Cinepoetics 9). DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/14023. Erstmalig hier erschienen / Initial publication here: https://doi.org/10.1515/9783110695380 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0/ Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0/ License. For Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz more information see: finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Daniel Illger Grüne Sonnen: Poetik und Politik der Fantasy am Medium Videospiel Cinepoetics Poetologien audiovisueller Bilder Herausgegeben von Hermann Kappelhoff und Michael Wedel Band 9 Daniel Illger Grüne Sonnen: Poetik und Politik der Fantasy am Medium Videospiel ISBN 978-3-11-069364-5 e-ISBN (PDF) 978-3-11-069538-0 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-069542-7 ISSN 2509-4351 DOI https://doi.org/10.1515/9783110695380 Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International Lizenz. Weitere Informationen finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2020935605 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.