Samson (VII)1 Langversion (Mai 2019, Ergänzung August 2019)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

De Nieuwe Taalgids. Jaargang 33
De Nieuwe Taalgids. Jaargang 33 bron De Nieuwe Taalgids. Jaargang 33. J.B. Wolters, Groningen / Batavia 1939 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_taa008193901_01/colofon.htm © 2010 dbnl 1 Homoniemen, homoniemenvrees, homoniemenvermijding. De ingewikkelde problemen die met homonymie samenhangen, zijn voornamelijk aan de orde gesteld door Franse dialektgeografen1): Gilliéron en zijn school hebben baanbrekend werk verricht. Het verschijnsel was natuurlijk lang bekend, maar werd veelal door taalregelaars te dilettantisch en te simplistisch beschouwd: door tweeërlei spelling meende men het ‘euvel’ afdoende te kunnen verhelpen. In de loop van deze eeuw ontstond een brede stroom van litteratuur over dit vraagstuk, met een soms weer te ver gaande reactie tegen de overdrijving van taalgeografische zijde. In het biezonder hebben de Weense geleerde Elise Richter (Ueber Homonymie, 1926)2) en de Fin Emil Öhmann (Ueber homonymie und homonyme im deutschen, 1934)3) een grondige en onbevangen uiteenzetting gegeven. In ons land kwam de homonymie slechts sporadisch ter sprake4), voordat het onlangs verschenen proefschrift van Dr. A.P. Kieft5) in breder verband deze verschijnselen behandelde. Het is niet te verwonderen dat deze eerste studie voortkwam uit de Leidse school van dialektgeografie. De definitie van homoniemen levert al dadelijk moeielijkheden. In de ruimste zin zijn homoniemen: gelijke klanken of klankgroepen, waarmede verschillende betekeniscomplexen verbonden kunnen worden. Was de term homoniem (d.i. gelijke naam) niet ingeburgerd, dan zouden wij, met Jespersen, aan homofoon (d.i. gelijke klank) de voorkeur geven. In de praktijk wordt de betekenis ingeperkt. Het Nederlandse koe en het Franse coup 1) Vgl. A. Dauzat: la géographie linguistique, blz. 65: ‘Les collisions d'homonymes ont été une des découvertes les plus frappantes de la géographie linguistique.’ 2) Festschrift für Paul Kretschmer, blz. -

The History of the Franks Free
FREE THE HISTORY OF THE FRANKS PDF Bishop of Tours Saint Gregory,Lewis Thorpe | 720 pages | 01 Apr 1983 | Penguin Books Ltd | 9780140442953 | English | London, United Kingdom Gregory of Tours - Wikipedia Gregory of Tours 30 November c. He was born Georgius Florentius and later added the name Gregorius in honour of his maternal great- grandfather. His most notable work was his Decem Libri Historiarum Ten Books of Historiesbetter known as the Historia Francorum History of the Franksa title that later chroniclers gave to it, but he is The History of the Franks known for his accounts of the miracles of saints, especially four books of the miracles of Martin of Tours. Martin's tomb was a major pilgrimage destination in the 6th century, and St. Gregory's writings had the practical effect of promoting this highly organized devotion. Gregory was The History of the Franks in Clermontin the Auvergne region of central Gaul. Gregory had several noted bishops and saints as close relatives his family effectively monopolised the Bishoprics of Tours, Lyons, and Langres at the time of his birthand, according to Gregory, he was connected to thirteen of the eighteen bishops of Tours preceding him by ties of kinship. Gregory's paternal grandmother, Leocadia, descended from Vettius Epagatus, the illustrious martyr of Lyons. His father evidently died while Gregory was young and his widowed mother moved to Burgundy where she had property. Gregory went to live with his paternal uncle St. Gallus, Bishop of Clermontunder whom, and his successor St. Avitus, Gregory had his education. Gregory also received the clerical tonsure from Gallus. -

Freedom, Warriors' Bond, Legal Book. the Lex Salica Between Barbarian
1 Jean-Pierre Poly Freedom, warriors’ bond, legal book. The Lex Salica between Barbarian custom and Roman law Liberté, lien des guerriers, li re de droit. La lex salica entre coutume barbare et loi romaine !bstract" #alic Law, t$e most %amous o% t$e so-called barbarian lege, was bot$ barbarian and roman. &t was made during t$e 't$ century %or t$e Frankis$ military de(endants )dediticii* and t$eir %amilies settled in t$e Extrema Galliae, t$e Far +aul. &ts main goal was to eradicate t$e %eud system, unacce(table in t$e Roman army. &t did not succeed in t$e long run but it ga e t$e Franks t$e co$esion w$ic$ allowed t$em to con,uer +aul, t$e te-t turning ultimately into an element o% national identity down to t$e Frenc$ re olution. Résumé " La loi #ali,ue, la (lus cél.bre des lois dites barbares, était / la %ois barbare et romaine. Elle fut %aite au &1e si.cle (our les déditices Francs et leurs %amilles établis dans les Extrema Galliae, 2 les régions ultimes de la +aule 3. #on (rincipal ob4ectif était d’éradiquer le syst.me indicatoire, inacce(table dans l’armée romaine. Elle n’y réussit 5nalement (as mais elle donna aux Francs la co$ésion ,ui leur (ermit la conquête de la +aule, le te-te de enant un élément d’identité nationale 4us,u’à la Ré olution française. 8eywords" army 9 barbarians 9 custom 9 democracy 9 0uro(e’s legal $istory 9 %eud 9 Franks 9 national identities – Salic Law. -

TFA Observances
Notes on Holy Tides: Fîron: The -Fîron (to celebrate) in TFA is recognized as a celebration taking place in the household. It is a time for wirdskap (worship meal), where the divine is invited into the home to take part in the holy meal. The meal may be comprised of specific offerings. Under the dark new moon, celebrations are closer to the hearth - the divine come nearest to the world of man even into the home. Naht: The -Naht (night) in TFA is the tide held on the moon before the full. Celebrations held within the home and nearest the hearth move onto the land of the Hêm. Worshipers may offer at the home-tree or some other natural feature of the land. The divine ride above along their celestial course. Fol: The -Fol (full) in TFA is the most liminal tide, straddling the divide between the waxing and waning moon. The method and area of worship will be a combination of indoor and outdoor activities within and without. This tide is when the worlds of men and gods are bought together in many ways. Drinking, recalling to mind, making merry and being boisterous is the natural tone for sacred affairs. Tîd (or Thing): The -Tîd (or -Thing) in TFA is a full tide lasting from the after-full moon until the following new moon. Whereas the pre-Fol month is waxing and spirits are rising until the pinnacle of the Fol, the second half is the waning where the divine are sought out in places beyond the Hêm and into the Civitas. -
Vlaanderen in De Middeleeuwen
VLAANDEREN IN DE MIDDELEEUWEN David Nicholas Inhoud Voorwoord 5 Dankwoord 7 HOOFDSTUK 1 – Het zand op de kustlijn 9 Vlaanderen onder Romeins gezag 9 Germaans Vlaanderen, van de vierde tot de achtste eeuw 16 De vorming van het graafschap Vlaanderen 600-981 22 HOOFDSTUK 2 – De economische ontwikkeling van het vroege Vlaanderen 31 Woud, veld en dorp in het vroegmiddeleeuwse Vlaanderen 31 Handel en steden 39 HOOFDSTUK 3 – De graven en het graafschap 918-1071 49 Arnulf de Grote (918-965) 49 Arnulf II (965-988) 54 Boudewijn IV (988-1035) 56 Boudewijn V (1035-1067) 61 HOOFDSTUK 4 – Het hoogtepunt van Vlaamse macht 1071-1206 69 Robrecht I ‘De Fries’ (1071-1093) 69 Robrecht II van Jeruzalem (1093-1111) 71 Boudewijn VII (1111-1119) 72 De crisis van 1127-1128 75 Vlaanderen onder de graven van de Elzas (1128-1191: Diederik van de Elzas (1128-1157/67) 84 Filips van de Elzas (1157/64-1191) 85 Boudewijn VIII (1191-1194) 88 Boudewijn IX (1194-1206) 89 De regering van Vlaanderen in de twaalfde eeuw: de overgang naar de administratieve staat 91 Vlaamse cultuur voor 1206 103 HOOFDSTUK 5 – De sociale en economische metamorfose van Vlaanderen in de elfde en twaalfde eeuw 111 De agrarische economie 111 Handel en nijverheid 124 HOOFDSTUK 6 – Economische groei en culturele bloei in de dertiende eeuw 139 Economie en samenleving op het platteland in het Vlaanderen van de dertiende eeuw 139 De steden 143 Vlaams cultuurleven in de dertiende eeuw 154 HOOFDSTUK 7 – Buitenlandse handel, diplomatie en afhankelijkheid: de catastrofe van middeleeuws Vlaanderen, 1206-1274 -
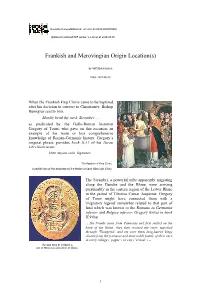
Frankish and Merovingian Origin Location(S)
Deutsche Nationalbibliothek urn:nbn:de:0233-2019070510 Update for archived PDF version v.1.00 as of 2019-07-05 Frankish and Merovingian Origin Location(s) by Rolf Badenhausen Date: 2021-08-23 When the Frankish king Clovis came to be baptized after his decision to convert to Christianity, Bishop Remigius said to him, Meekly bend thy neck, Sicamber ... , as predicated by the Gallo-Roman historian Gregory of Tours, who gave on this occasion an example of his more or less comprehensive knowledge of Roman-Germanic history. Gregory’s original phrase provides book II,31 of his Decem Libri Historiarum : Mitis depone colla, Sigamber... The Baptism of King Clovis. A partial view of the altarpiece by the Master of Saint Gilles (abt 1500). The Sicambri, a powerful tribe apparently migrating along the Danube and the Rhine, were arriving presumably in the eastern region of the Lower Rhine in the period of Tiberius Caesar Augustus. Gregory of Tours might have connected them with a 'migratory legend' somewhat related to that part of land which was known to the Romans as Germania inferior and Belgica inferior . Gregory writes in book II,9 that ... the Franks came from Pannonia and first settled on the bank of the Rhine; they then crossed the river, marched through 'Thongeria', and set over them long-haired kings chosen from the foremost and most noble family of their race in every village ‹ 'pagus' › or city ‹ 'civitas' › ... The Seal Ring of Childeric I, son of Meroveus and father of Clovis. 1 Migration of early Franks or 'Salian Franks'. Pannonia or Baunonia ? As quoted above, Gregory of Tours actually maintains that the Franks migrated from 'Pannonia' into their well known later domain, which then, since 4 th century, was formed mainly on the left bank of the Rhine. -

Thidreks Saga Research: Merovingian Origin Location
urn:nbn:de:0233-2019070510 Merovingian Origin Location(s) by Rolf Badenhausen Date: 2017-02-10 When King Clovis came to be baptized after his conversion to Christianity, Bishop Remigius said to him, 'Meekly bend thy neck, Sicamber ...', as remarked by Gregory of Tours who certainly gave on this occasion an example of his more or less comprehensive knowledge of Roman-Germanic history. Gregory’s original phrase provides book II (ch. 31) of his Libri Historiarum: Mitis depone colla, Sigamber... The Baptism of King Clovis. A partial view of the altarpiece by the Master of Saint Gilles (abt 1500). The Sicambri, a powerful tribe migrating formerly along the Danube and the Rhine, were dwelling along the eastern banks on the Lower Rhine in the time of Caesar. In Migration Period, however, these people also were dispersed to such an extent that Gregory of Tours might have remembered merely a 'migratory legend' somewhat related to that part of land which was called Salia some hundred years later: 'Franks originally came from Pannonia and first colonized the banks of the Rhine. Then, they crossed the river, marched through Thongeria, and set up in each country district and each city long-haired kings chosen from the foremost and most noble family of their race ...'. The Seal Ring of Childeric I, son of Meroveus and father of Clovis. 1 A Germanic chief called Meroveus, forwarded as grandfather of Clovis, is believed to have been recorded in 417 for rendering heroic service to the Romans. At that time, possibly as merited high-ranked mercenary, he appears rewarded with the leadership of Salia (nowadays pertaining to Dutch and Belgian territory) with that Gaulish region Toxandria we are calling now North and South Brabant. -

In Partial Fulfillment
THE ÀRNULFINGS BEFORE 687 A Study of the House oÎ Pepin in the Seventh Century A Thes is Presented to The Faculty of Graduate SÈudies and Research univers ity of Manitoba In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts by Richard A. Gerberd j"ng October, I977 THE ARI{ULFIIIÊS BFFfJRE 687: A Study of the House of Peoin in the Seventh Centur.y BY RICHARD A GERBERDTNG A disserti¡tion sÍrbnritted to the F¿cutty of Grutuafc Stt¡tlics o[ the University of Muuitobr in partill fulfillmcnt ol' the rc{¡uircments of thr,' dr,'gr ce of TASTER r)I ARTS @ r1977 Pernrission h;¡s becr¡ gl't¡ût!'d to tl¡c LIBRARY O[¡ TllE Uf'¡lvUR- SITY O I. M N ITO IJA to lcl¡d or scll copir;s of this dissert¡rtion, ttl ^ the. NATIoNA L LIERARY Of (:ANAI)A to n¡icn¡l'ilm this d¡ssert:¡tion and to lentl or soll copir,'s of the filnt,:¡nd UN¡vliRSlTY MICROFILMS to publish ïn übstrlct of tlris dissertat¡on. The author rcserves other ¡rublication rights, an¡I neíthor t&rc d¡sserþtion rror extcnsivo cxtritcts fionì it uuy bc printerf or other- wise reprotluceil without tl¡u author's wriltuì lrcnnlsshltì. -l- CONTETITS Page I. INTROÐUCTION. t TÏ. HISTORIANS, SOURCES, .ANÐ METHODS 3 Modern Scholars 3 The Sources I1 The Narrative S ource s . 32 Genea logiae 33 Vitae. 40 Lêges . 45 Formula e 5t Chartae et Ðiplomatae. 52 Onoma s tic s 60 Grave s 64 TII. THE POLITICAL EI¡VTRONI\,IENT 67 IV. -

The Invasion of Europe by the Barbarians
The Invasion of Europe by the Barbarians A Series of Lectures. By J. B. Bury 1928 Credits Support the Scribe’s Gild and help us make the Lore of the North accessible to everyone. To visit the Scribe’s Gild and find out how go to: http://www.northvegr.org/scribe/index.html This text brought to you in e-Book format by: Visit Northvegr on the web at: http://www.northvegr.org/ This text transcribed by Loptsson [email protected] Get Northvegr Texts on CD-ROM © 2003 Northvegr and A. Odhinssen. This book can be distributed freely as long as no monetary gain is made and the credits are left intact. PREFATORY NOTE In 1902 the late Professor J. B. Bury was appointed to succeed Lord Acton as the holder of the Regius Chair of Modern History in the University of Cambridge. He interpreted the term "modern" with the same largeness and liberality as had his friend and master, Professor E. A. Freeman, at Oxford; even if he did not go so far as to say, with a German authority, the "Modern History begins with the Call of Abraham". In other words, he did not feel himself bound to restrict either his reading or his lecturing to the four Post-Renaissance centuries which are regarded as "modern" in the narrow sense of the term. On the contrary, he considered it proper that he should continue to pursue those researches into the history of the later Roman Empire for which his high technicle equipment---in particular his remarkable knowledge of Slavonic and other East-European languages---specially fitted him. -

Rheinische Vierteljahrsblatter
RHEINISCHE •• VIERTELJAHRSBLATTER JAHRGANG71 2007 HERA USGEBER: M. GROTEN TH. KLEIN· M. NIKOLAY-PANTER SCHRIFTLEITUNG: M. NIKOLAY-PANTER VERÖFFENTLICHUNG DER ABTEILUNG FÜR RHEINISCHE LANDESGESCHICHTE DES INSTITUTS FÜR GESCHICHTSWISSENSCHAFT DER UNIVERSITÄT BONN DR. RUDOLF HABELT GMBH· BONN CJ"\\ At\l~ DIE FRANKEN UND ROM (3.-5. JAHRHUNDERT)"" Versuch einer Übersicht Von Eugen Ewig (t) 1. Von den Protofranken zur gens Franeorum In der fränkischen Frühgeschichte spiegelt sich die Krise wieder, in die das Imperium geriet, als die große Zeit der Pax Romana zu Ende ging. Um der akuten Gefahr zu begegnen, die um die Mitte des 3. Jahrhunderts vom neu- persischen Reich der Sassaniden ausging, zog Kaiser Valerian 253 Truppen- Abkürzungen der im Folgenden häufiger zitierten Werke: Zusammenstellung der Zeugnisse mit Kommentar: de Boone: W. J. de Boone, De Franken van hun eerste optreden tot de dood van Childerik, Amsterdam 1954. Mit weiterer Literatur: Runde: I. Run de, Die Franken und Alemannen vor 500. Ein chronologischer Überblick, in: Die Franken und Alemannen bis zur Schlacht von Zülpich, hrsg. v. D. Geuenich (Er- gänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 19), Berlin/ New York 1998, S. 656--690. Synthesen: Zöllner: E. Zöllner, Geschichte der Franken bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, München 1970. Beisel: F. Beisel, Studien zu den fränkisch-römischen Beziehungen. Von ihren Anfängen bis zum Ausgang des 6. Jahrhunderts, Idstein 1987. v. Petrikovits: H. v. Petrikovits, Altertum (Rheinische Geschichte 1/1, hrsg. v. F. Petri und G. D ro e g e), Düsseldorf 1978. Anton: H. H. Anton, Franken, in: Reallexikon der germanischen Altertumskunde [RGAI 2IX(1995), S. 414-435. Sammelbände zum Chlodwigjubiläum: Wegbereiter: Die Franken. -

En Protohistorie Vi: Romeinse Tijd En Merovingische Periode, Deel A: Historische Bronnen En Chronologische Schema’S
DE 14C-CHRONOLOGIE VAN DE NEDERLANDSE PRE- EN PROTOHISTORIE VI: ROMEINSE TIJD EN MEROVINGISCHE PERIODE, DEEL A: HISTORISCHE BRONNEN EN CHRONOLOGISCHE SCHEMA’S J.N. LANTING Jachtlaan 60, 9751 BW Haren, the Netherlands J. VAN DER PLICHT University of Groningen, Centre for Isotope Research, Groningen, the Nederlands ABSTRACT: Lack of time, but especially limitations regarding the size of papers in this volume forced us to divide our last contribution on chronology into two parts. This part, A, contains a survey of the historical sources and summaries of the major chronological schemes. Part B will appear in Palaeohistoria 53/54 (2011/12) and will contain a summary of the archaeology of the Netherlands during the Roman and Merovingian periods, and a list of radiocarbon dates. After some introductory remarks in chapter 1, this paper deals with the historical sources in chapter 2. Special atten- tion is given to the recent publication by Scharf (2005) who convincingly demonstrates the Notitia Dignitatum Occidentis to be a present to emperor Iohannes, produced in AD 423, and not a partly out-of-date state almanack. Consequently, the Roman military and civil administration of Britannia was still intact in that year. On archaeological grounds this had already been shown by Böhme (1986b). That the province Germania II still existed in AD 418 is demonstrated by the letter of emperors Honorius and Theodosius II concerning the creation of the diocese Septem provinciae and yearly con- ventions of representatives of all 17 provinces in Arles (Weidemann, 1980). The Notitia Dignitatum Occidentis mentions civil administrators of Germania prima and Germania secunda, but no military commander in Germania secunda. -

1. the Road from the Ends of the Earth
Belerion Cassiterides? Hercynian Forest (‘Tin Islands’) Sequana (Seine) Sanctuary of Hercules (Deneuvre) Ister Finistère (Danube) Alesia 1 . The Road from theEndsof from . TheRoad theEarth Oceanus GAULS Arar Solis columna Occidentalis (Saône) (‘Pillar of the Sun’) (Western Ocean) Lugdunum Bay (Lyon) Alps Battle of of Ticinus Biscay 4 Matrona (Hannibal) Garumna Pass (Rhone) 3 Rhodanus (Garonne) Nemausos 2 ETRUSCANS (Nîmes) Adriatic Sea Druentia Narbo 1 (Durance)LIGURIANS (Narbonne) Massalia Agatha (Marseille) (Agde) Fisterra Pyrenees Andorra Col de Rome CELTIBERIANS Panissars Arse (Sagunto) IBERIANS Mediterranean Sea New Carthage (Cartagena) Sacred Promontory Gades 1. Plain of the Crau Carthage (Sagres) Portus (Cadiz) 2. Roquemaure (Rhone crossing) Hannibalis 3. Serre-la-Croix oppidum (Alvor) Pillars of Hercules 4. Brigantium (Briançon) Mediolanum 200 kms system suggests a general direction ofsystem suggestsageneraldirection migration ratherthananexacttrajectory. Milan,the beyond furtherin twelve InItaly, cases(onaverage, 750metres). ve casesandwithin intwenty-fi centre than one –passesdirectlyaGaulishtribal line –sometimesmore through thoseof are The namesinboxes Asolar tribeswhomigrated toItaly. Loon-Plage Cassel Menapii Bonn Eburones Mons Namur Aduatuci Nervii La Chaussée- Chipilly- Tirancourt Méricourt Dumnonium Viromandui? 4 Ambiani Promontorium 1 Vieux-Laon Donnersberg (Bibrax) Treveri . Tribal centres andthemigration centres toItaly . Tribal Caput Caleti Luxembourg Pîtres Bailleul Remi Veliocasses Bellovaci Speyer Reims Nemetes