Die Hamburger Juden Im NS-Staat 1933 Bis 1938/39
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PURL: G S Lili II a R Y OP EVENTS
No. XXVII. April 21st 1947. UNITED NATIONS WAR CRIMES (VM/TSSICN. (Research Office). W A R CRIMES O V 3 DIGEST. ¿"NOTBî The above title replaces that of Press News Sunmary used in the early numbers of this eries. For internal circulation to the Commission.^ CONTENTS. SUMMARY OP EVENTS. Page. EUROPE. 1. PURL: https://www.legal-tools.org/doc/0556af/ G S lili II A R Y OP EVENTS. 5UH0PE. A U S T R I A. Investigations into suspected cases of war ori^«?. Lina radio reported (1 0 ,4«47) that under the jurisdiction of the five People's Courts in Upper Austria and Salzburg - the region of the Linz Chief Public Rrosecutor' s Office - 5,157 preliminary investigations were being nado into cases of suspected war crine3 and underground nenborshi^ of the Nazi party. About 500 trials wore begun la3t year; 342 being ccncludod, two with death sent ences and ll6 with acquittals. Arrests. 7icner Zeitung reported (1,4*47) that the Innsbruck police had arrested the former SS Ob ers turn führer Richard. KORNHERR. CZECHOSLOVAKIA. The Tiso Trial, (see Ho, XXVI, p.2 of this Digest) The Daily Telegraph reported free Prague (16,4.47) that Josef TISO, former President of Slovakia during the German occupation, had been sentenced by the People's Court in Bratislava to death by hanging, Ferdinand DURCANSKY, his former Foreign Kinister, received a similar sentence. During his trial TISO admitted giving military aid to the Germans but denied signing a declaration of \ war on Britain and the United States, Sentence on a Gestapo Official, An Agency message reported frcm Berlin (7 .2 ,4 7 ) that Karel DUCHGN, described, as the most cruel Gestapo man in Olcmouc, had been sentenced to death by the Olccnouc People's Court, He took part in the killing of 21 people in a May 1945 rising and persecuted Slovak partisans. -

The Auction Will Take Place at 9 A.M. (+8 G.M.T.) Sunday 18Th October 2020 at 2/135 Russell St, Morley, Western Australia
The Auction will take place at 9 a.m. (+8 G.M.T.) Sunday 18th October 2020 at 2/135 Russell St, Morley, Western Australia. Viewing of lots will take place on Saturday 17th October 9am to 4pm & Sunday 18th October 7:00am to 8:45am, with the auction taking place at 9am and finishing around 5:00pm. Photos of each lot can be viewed via our ‘Auction’ tab of our website www.jbmilitaryantiques.com.au Onsite registration can take place before & during the auction. Bids will only be accepted from registered bidders. All telephone and absentee bids need to be received 3 days prior to the auction. Online registration is via www.invaluable.com. All prices are listed in Australian Dollars. The buyer’s premium onsite, telephone & absentee bidding is 18%, with internet bidding at 23%. All lots are guaranteed authentic and come with a 90-day inspection/return period. All lots are deemed ‘inspected’ for any faults or defects based on the full description and photographs provided both electronically and via the pre-sale viewing, with lots sold without warranty in this regard. We are proud to announce the full catalogue, with photographs now available for viewing and pre-auction bidding on invaluable.com (can be viewed through our website auction section), as well as offering traditional floor, absentee & phone bidding. Bidders agree to all the ‘Conditions of Sale’ contained at the back of this catalogue when registering to bid. Post Auction Items can be collected during the auction from the registration desk, with full payment and collection within 7 days of the end of the auction. -

Introduction
Introduction BY ROBERT WELTSCH Downloaded from https://academic.oup.com/leobaeck/article/8/1/IX/938684 by guest on 27 September 2021 No greater discrepancy can be imagined than that between the three men with whom we begin the present volume of the Year Book. It is almost a reflection of what, since Sir Charles Snow's famous lecture, has become the current formula of "The Two Cultures". Ismar Elbogen devoted his whole life to Jewish scholarship, he was a true representative of the humanities. Fritz Haber on the other hand was a great scientist, though his biographer, doctor and friend, is eager to point out that at his time the two cultures were not yet so far apart, and that Haber was devoted to poets like Goethe and himself made verses. But what about our third man? For his sake, we may be tempted to add to the array a "Third Culture", the world of Mammon, seen not from the aspect of greed, but, in this special case, to be linked in a unique way with active work for the good of fellow-men — in philanthropy of a magnitude which has very few parallels in the history of all nations. There is little that we could add, in the way of introduction, to the story of Baron Hirsch as told by Mr. Adler-Rudel. Among the Jewish public it is not always remembered that the man was a German Jew, a descendant of a Bavarian family of court bankers who acquired the castle of Gereuth. Owing to the early transfer of his residence to Brussels and later to Paris, and perhaps also due to his collaboration with the Alliance Israelite Universelle, Hirsch is in the mind of the uninformed public often associated with French Jewry. -
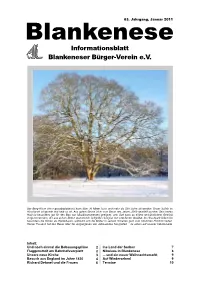
Bbv-2011-01.Pdf
63. Jahrgang, Januar 2011 Blankenese Informationsblatt Blankeneser Bürger-Verein e.V. Der Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) kann über 30 Meter hoch und mehr als 500 Jahre alt werden. Unser Solitär im Hirschpark ist gerade mal halb so alt. Aus gutem Grund ist er zum Baum des Jahres 2009 gewählt worden: Sein hartes Holz ist besonders gut für den Bau von Musikinstrumenten geeignet, sein Saft kann zu einem weinähnlichem Getränk vergoren werden, der aus seinen Blüten stammende hellgelbe Honig ist von exzellenter Qualität. Im Hirschpark lieben ihn besonders die Kinder als Kletterbaum, während sich die Mütter in seinem Schatten gern zum fröhlichen Picknick treffen. Heiner Fosseck hat den Baum über die vergangenen vier Jahreszeiten fotografiert – zu sehen auf unserer Internetseite. Inhalt: Und noch einmal die Bebauungspläne 2 Ins Land der Sorben 7 Flaggenstreit am Bahnhofsvorplatz 2 Nikolaus in Blankenese 8 Unsere neue Kirche 3 ... und ein neuer Weihnachtsmarkt 9 Besuch aus England im Jahre 1830 4 Auf Wiedersehen! 9 Richard Dehmel und die Frauen 6 Termine 10 schriftliche Bestätigung dafür bekommen wer- Bebauungspläne für den, dass sie in der Zeit vom 3. Januar 2011 bis zum 4. Februar 2011 im Technischen Rathaus das Hanggebiet Altona, Jessenstraße 3 - 4, Flur V, OG auch tatsächlich ausgehängt werden. Damit errei- Von Prof. Dr. Jürgen Weber, chen sie quasi Gesetzeskraft. 1. Vorsitzender des BBV Der BBV hat sich seit Jahren darum bemüht, den B-Plänen endlich Gültigkeit zu verschaffen eit Jahren politisch beschlossen und immer (wir berichteten darüber). Bis zuletzt gab es S wieder angemahnt, „sollen“ die B-Pläne für keine Zusage, dass auch der B-Plan für den unser Hanggebiet nun endlich ausgelegt wer- Baurs Park damit zur Aushängung gelangt. -

Managing Political Risk in Global Business: Beiersdorf 1914-1990
Managing Political Risk in Global Business: Beiersdorf 1914-1990 Geoffrey Jones Christina Lubinski Working Paper 12-003 July 22, 2011 Copyright © 2011 by Geoffrey Jones and Christina Lubinski Working papers are in draft form. This working paper is distributed for purposes of comment and discussion only. It may not be reproduced without permission of the copyright holder. Copies of working papers are available from the author. Managing Political Risk in Global Business: Beiersdorf 1914-1990 Geoffrey Jones Christina Lubinski 1 Abstract This working paper examines corporate strategies of political risk management during the twentieth century. It focuses especially on Beiersdorf, a German-based pharmaceutical and skin care company. During World War 1 the expropriation of its brands and trademarks revealed its vulnerability to political risk. Following the advent of the Nazi regime in 1933, the largely Jewish owned and managed company, faced a uniquely challenging combination of home and host country political risk. The paper reviews the firm's responses to these adverse circumstances, challenging the prevailing literature which interprets so-called "cloaking" activities as one element of businesses’ cooperation with the Nazis. The paper departs from previous literature in assessing the outcomes of the company’s strategies after 1945. It examines the challenges and costs faced by the company in recovering the ownership of its brands. While the management of distance became much easier over the course of the twentieth century because of communications -

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va
GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part I) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as RG 242, Microfilm Publication T175. To order microfilm, write to the Publications Sales Branch (NEPS), National Archives and Records Service (GSA), Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. Library of Congress Catalog Card No. 58-9982 AMERICA! HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE fOR THE STUDY OP WAR DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECOBDS MICROFILMED AT ALEXAM)RIA, VA. No* 32» Records of the Reich Leader of the SS aad Chief of the German Police (HeiehsMhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) 1) THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (AHA) COMMITTEE FOR THE STUDY OF WAE DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA* This is part of a series of Guides prepared -

M Y C E L I a Exchange Project for Women Artists M Y C E L I a Exchange Project for Women Artists
M Y C E L I A Exchange Project for Women Artists M Y C E L I A Exchange Project for Women Artists A project initiated by artists from GEDOK Munich with artists from Riga in cooperation with PLATFORM Munich 22nd April ➝ 10th May 2020 Concept and curated by Anabel Roque Rodríguez The Artists Silke Bachmann (D) + Ieva Balode (LV) p. 08 – 13 Karin Fröhlich (D) + Gundega Evelone (LV) p. 14 – 19 Patricia Lincke (D) + Laura Feldberga (LV) p. 20 – 25 Penelope Richardson (D) + Sandra Strēle (LV) p. 26 – 31 Sabine Schlunk (D) + Guna Millersone (LV) p. 32 – 37 “Artistic success depends on a healthy Based on thoughts about biological network. But what does this network ecosystems, artists from Munich and look like in a society that puts Riga explore them in micro- competition over solidarity? cooperations. The fungus mycelium What does artistic success require? serves as a model for thought and What does a healthy artistic describes thread-like cells of a fungus. ecosystem need? The exhibition They grow invisibly in the culture Mycelia is a joint reflection on medium and combine underground success, ecosystem, networking and over square kilometres to form a huge detoxification. biological mass. In this network, mycelia also provide a healthy ecosystem for outside organisms.” Anabel Roque Rodríguez 4 5 “We need The first ideas for an international exchange project of female artists from Germany and Latvia were born collective MYCELIA: The fungus mycelium serves as a in 2017 during the stay of the Latvian curator Diana Popova (Riga) at the Villa Waldberta in Munich. -

Hungarian Studies Review, Vol
Hungarian Studies Review, Vol. XXIII, No. 1 (Spring, 1996) Edmund Veesenmayer on Horthy and Hungary: An American Intelligence Report N.F. Dreisziger "As Minister to Hungary, Veesenmayer had something more than the normal duties of a Minister." (The Veesenmayer Interrogation Report, p. 21) "... it was a good thing if [Veesenmayer] did not always know everything that was going on (i.e. the Gestapo was doing) [in Hungary]." (SS leader Heinrich Himmler, cited ibid., p. 22) The role Edmund Veesenmayer played in twentieth century Hungarian history is almost without parallel. He was, to all intents and purposes, a Gauleiter, a kind of a modern satrap, in the country for the last year of the war. Hungary would have her share of quislings during the post-war communist era, but they would not be complete foreigners: the Matyas Rakosis, the Erno Geros, the Ferenc Mtinnichs, the Janos Kadars, and the Farkases (Mihaly and Vladimir) had connections to Hungary, however tenuous in some cases.1 Veesenmayer had no familial, ethnic or cultural ties to Hungary, he was simply an agent of a foreign power appointed to make sure that power's interests and wishes prevailed in the country. The closest parallel one finds to him in the post-war period is Marshal Klementy E. Voroshilov, the member of the Soviet leadership who was ap- pointed as head of the Allied Control Commission in Hungary at the end of the war. Though Voroshilov's position most resembled Veesenmayer's, it is doubtful whether the Soviet General was as often involved in meddling in Hungarian affairs as was the energetic German commissioner and his SS cohorts. -

Nationalsozialistische Schulverwaltung in Hamburg. Vier Führungspersonen
H H H F HF Hamburger Historische Forschungen | Band 1 Hamburger Historische Forschungen | Band 12 Uwe Schmidt Nationalsozialistische Schul- verwaltung in Hamburg Nach dem Machtwechsel in Hamburg Neben Karl Witt waren dies die Prote- wurde am 8. März 1933 die Schulver- gés des Gauleiters und Reichsstatthal- Vier Führungspersonen waltung dem Deutschnationalen und ters Karl Kaufmann Wilhelm Schulz, späteren Nationalsozialisten Karl Witt Albert Henze und Ernst Schrewe. Ihre unterstellt. Umgestellt auf das natio- Nähe zum Machtzentrum um Kauf- nalsozialistische Führungsprinzip wur- mann führte zu sehr unterschiedlichen de sie in zunehmendem Maße für die formalen wie informellen Verankerun- Durchsetzung nationalsozialistischer gen in den Mechanismen des poly- Erziehungsvorstellungen instrumen- kratischen nationalsozialistischen talisiert. Diese wurden vor allem über Systems. Der politische Druck, der von die Personen durchgesetzt, welche die der Spitze der Schulverwaltung auf die Behörde leiteten oder aber durch in- Schulen ausgeübt wurde, verstärkte formell ausgeübte Macht dominierten. sich seit Kriegsbeginn und erreichte sei- Verdeutlicht wird daher die Position nen Höhepunkt in der Machtfülle und der vier schulbezogenen Funktionsträ- rücksichtslosen Machtausübung des ger im Macht- und Herrschaftssystem nationalsozialistischen Senatsdirektors des Hamburger Nationalsozialismus. und Gauschulungsleiters Albert Henze. Nationalsozialistische Schulverwaltung in Hamburg ISBN 978-3-937816-49-4 ISSN 1865-3294 2 Hamburg University Press Nationalsozialistische -

Session of the Zionist General Council
SESSION OF THE ZIONIST GENERAL COUNCIL THIRD SESSION AFTER THE 26TH ZIONIST CONGRESS JERUSALEM JANUARY 8-15, 1967 Addresses,; Debates, Resolutions Published by the ORGANIZATION DEPARTMENT OF THE ZIONIST EXECUTIVE JERUSALEM AMERICAN JEWISH COMMITTEE n Library י»B I 3 u s t SESSION OF THE ZIONIST GENERAL COUNCIL THIRD SESSION AFTER THE 26TH ZIONIST CONGRESS JERUSALEM JANUARY 8-15, 1966 Addresses, Debates, Resolutions Published by the ORGANIZATION DEPARTMENT OF THE ZIONIST EXECUTIVE JERUSALEM iii THE THIRD SESSION of the Zionist General Council after the Twenty-sixth Zionist Congress was held in Jerusalem on 8-15 January, 1967. The inaugural meeting was held in the Binyanei Ha'umah in the presence of the President of the State and Mrs. Shazar, the Prime Minister, the Speaker of the Knesset, Cabinet Ministers, the Chief Justice, Judges of the Supreme Court, the State Comptroller, visitors from abroad, public dignitaries and a large and representative gathering which filled the entire hall. The meeting was opened by Mr. Jacob Tsur, Chair- man of the Zionist General Council, who paid homage to Israel's Nobel Prize Laureate, the writer S.Y, Agnon, and read the message Mr. Agnon had sent to the gathering. Mr. Tsur also congratulated the poetess and writer, Nellie Zaks. The speaker then went on to discuss the gravity of the time for both the State of Israel and the Zionist Move- ment, and called upon citizens in this country and Zionists throughout the world to stand shoulder to shoulder to over- come the crisis. Professor Andre Chouraqui, Deputy Mayor of the City of Jerusalem, welcomed the delegates on behalf of the City. -

Diplomacy & Statecraft JM Keynes and the Personal Politics of Reparations
This article was downloaded by: [Professor Stephen Schuker] On: 23 November 2014, At: 19:47 Publisher: Routledge Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Diplomacy & Statecraft Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/fdps20 J.M. Keynes and the Personal Politics of Reparations: Part 1 Stephen A. Schuker Published online: 30 Aug 2014. To cite this article: Stephen A. Schuker (2014) J.M. Keynes and the Personal Politics of Reparations: Part 1, Diplomacy & Statecraft, 25:3, 453-471, DOI: 10.1080/09592296.2014.936197 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/09592296.2014.936197 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content. -

THE CONVOY at 2:05 Pm on March 2, 1948 the Operator at The
THE CONVOY At 2:05 pm on March 2, 1948 the operator at the Hadassah exchange in Jerusalem heard an Arab voice warn that the hospital would be blown up within 90 minutes. The explosion did not happen but it was a clear giveaway of Arab intentions. Two days, later, Hadassah President Rose Halprin and Denise Tourover called on the State Department and the British embassy in Washington to secure Scopus, then followed up with strong protests to UN Secretary-General Trygve Lie and the International Red Cross. Shortly afterward, commander of Palestine Arab forces Abdul Kader Husseini spoke, on the record, to news correspondents: “Since Jews have been attacking us and blowing up our houses containing women and children from bases in Hadassah Hospital and Hebrew University, I have given orders to occupy or even demolish them.” Showing he meant business, he placed a cannon on the roof of the Rockefeller Museum of Archaeology opposite Mount Scopus and began using armor-piercing ammunition and electrically- detonated mines against Scopus traffic. Surgeon Edward Joseph told Yassky that he could no longer take the responsibility of transferring cases to Scopus. Yassky replied sharply: “The time has not yet come to evacuate Mount Scopus…There is no security anywhere.” But reality won out. Yassky carried on negotiations quietly for the use of the Anglican Mission Hospice a few blocks away from the Hasolel Street clinic that Hadassah ran in downtown Jerusalem. On March 15, ten beds were set up for maternity cases and the site became known as Hadassah “A.” A century earlier, Jews in Jerusalem were running away from the mission hospitals; now they were running back into them.