1 Einleitung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Japanese Art Contents
2 0 0 9 / 2 0 1 0 Japanese Art Japanese Contents Japanese Art at Brill Hotei Publishing, established in Leiden in 1998, became an imprint of Brill in 2006. As part of Brill’s Asian Studies program, Hotei specializes in books related to Japanese art, and publishes exhibition catalogues and lavishly-illustrated books on established and lesser-known Japanese print artists and painters, as well as a variety of other facets of Japanese art and culture. Hotei Publishing works with an international team of museum curators, art historians and specialist authors. Recent projects that illustrate Hotei’s close cooperation with museums are Reading Surimono, The Interplay of Text and Image in Japanese Prints, published in association with the Museum Rietberg in Zurich, and the catalog of the magnificent surimono holdings in the See page 9 See page 5 See page 8 Rijksmuseum, Amsterdam, which will appear shortly. Japanese art will also have a prominent place in Brill’s new academic book series Japanese Visual Culture. The inaugural volume of the series will be Chōgen, The Holy One, And The Restoration Of Japanese Buddhist art by the eminent scholar John Rosenfield. With a strong editorial board, led by John T. Carpenter (SOAS, University of London/Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures) we aim to publish groundbreaking research on Japanese art and visual culture in an attractive format. We hope you will enjoy browsing our catalog and will visit brill.nl for more detailed and updated information on Hotei Publishing’s titles. Our own webpage at brill.nl/hotei features background information and news. -

Ukiyo-E: Pictures of the Floating World
Ukiyo-e: pictures of the Floating World The V&A's collection of ukiyo- e is one of the largest and finest in the world, with over 25,000 prints, paintings, drawings and books. Ukiyo-e means 'Pictures of the Floating World'. Images of everyday Japan, mass- produced for popular consumption in the Edo period (1615-1868), they represent one of the highpoints of Japanese cultural achievement. Popular themes include famous beauties and well-known actors, renowned landscapes, heroic tales and folk stories. Oniwakamaru subduing the Giant Carp (detail), Totoya Hokkei, In the Edo period (1615- about 1830-1832. Museum no. E.3826:1&2-1916 1868), fans provided a popular format for print designers' ingenuity and imagination. The designs produced for fans are usually themed around summer, festivals, and the lighter side of life. Ukiyo-e prints from the collection are available for study in the V&A Prints and Drawings study room. What are ukiyo-e? The art of ukiyo-e is most frequently associated with colour woodblock prints, popular in Japan from their development in 1765 until the closing decades of the Meiji period Source URL: http://www.vam.ac.uk/content/articles/u/ukiyo-e-pictures-of-the-floating-world/ Saylor URL: http://www.saylor.org/courses/arth305/#3.4.2 © Victoria and Albert Museum Saylor.org Used by permission. Page 1 of 8 (1868-1912). The earliest prints were simple black and white prints taken from a single block. Sometimes these prints were coloured by hand, but this process was expensive. In the 1740s, additional woodblocks were used to print the colours pink and green, but it wasn't until 1765 that the technique of using multiple colour woodblocks was perfected. -

Fine Japanese and Korean Art New York I September 12, 2018 Fine Japanese and Korean Art Wednesday 12 September 2018, at 1Pm New York
Fine Japanese and Korean Art New York I September 12, 2018 Fine Japanese and Korean Art Wednesday 12 September 2018, at 1pm New York BONHAMS BIDS INQUIRIES CLIENT SERVICES 580 Madison Avenue +1 (212) 644 9001 Japanese Art Department Monday – Friday 9am-5pm New York, New York 10022 +1 (212) 644 9009 fax Jeffrey Olson, Director +1 (212) 644 9001 www.bonhams.com [email protected] +1 (212) 461 6516 +1 (212) 644 9009 fax [email protected] PREVIEW To bid via the internet please visit ILLUSTRATIONS Thursday September 6 www.bonhams.com/24862 Takako O’Grady, Front cover: Lot 1082 10am to 5pm Administrator Back cover: Lot 1005 Friday September 7 Please note that bids should be +1 (212) 461 6523 summited no later than 24hrs [email protected] 10am to 5pm REGISTRATION prior to the sale. New bidders Saturday September 8 IMPORTANT NOTICE 10am to 5pm must also provide proof of identity when submitting bids. Please note that all customers, Sunday September 9 irrespective of any previous activity 10am to 5pm Failure to do this may result in your bid not being processed. with Bonhams, are required to Monday September 10 complete the Bidder Registration 10am to 5pm Form in advance of the sale. The form LIVE ONLINE BIDDING IS Tuesday September 11 can be found at the back of every AVAILABLE FOR THIS SALE 10am to 3pm catalogue and on our website at Please email bids.us@bonhams. www.bonhams.com and should SALE NUMBER: 24862 com with “Live bidding” in the be returned by email or post to the subject line 48hrs before the specialist department or to the bids auction to register for this service. -

Cover Page the Handle
Cover Page The handle https://hdl.handle.net/1887/3195081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Takemura, S. Title: Style and function of female images in prints by Keisai Eisen (1790–1848): Ideals of beauty and gender in the Late Edo Period consumer society Issue Date: 2021-07-15 Chapter One Eisen: An Overview of His Career, His Oeuvre, and His ʻMarket’ Several modern ukiyo-e scholars have conducted important analysis and investigations into Eisen and his works. Hayashi Yoshikazu has scrutinized Eisen’s erotic artworks (shunga 春画) in collaboration with Katsushika Hokusai and Hokusai’s daughter Oei 阿栄 (also known as Katsushika Ōi 葛飾応為, act. 1801‒1854) in Oei to Eisen: Enpon kenkyū 阿栄と英泉:艶本研究.11 Ōsawa Makoto undertook a detailed, comprehensive study of Eisen’s artistic life in the post-war era, in his Keisai Eisen 渓斎英泉 of 1976, but little investigation has subsequently been conducted on the artist’s individual works.12 Akai Tatsurō 赤井達郎 has shed light on the close collaboration between the popular writer- publisher Shunsui and Eisen with an eye toward the possible influence that Shunsui might have had on the design of Eisen’s female images. Since Akai does not demonstrate any visual examples of Eisen’s biJin-ga, I would like to explore if and how Eisen’s biJin-ga have actual influence of Shunsui’s ideas and writings about women. The first substantial one-man show on Eisen and his works took place in 1997 at the Ōta kinen bijutsukan 太田記念美術館 (Ōta Memorial Museum of Art).13 The most recent museum exhibition to thoroughly focus on Eisen’s art was organized in 2012 by the Chiba City Museum of Art. -
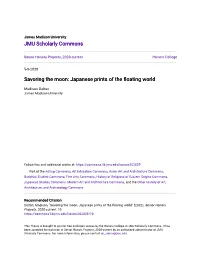
Japanese Prints of the Floating World
James Madison University JMU Scholarly Commons Senior Honors Projects, 2020-current Honors College 5-8-2020 Savoring the moon: Japanese prints of the floating world Madison Dalton James Madison University Follow this and additional works at: https://commons.lib.jmu.edu/honors202029 Part of the Acting Commons, Art Education Commons, Asian Art and Architecture Commons, Buddhist Studies Commons, Fine Arts Commons, History of Religions of Eastern Origins Commons, Japanese Studies Commons, Modern Art and Architecture Commons, and the Other History of Art, Architecture, and Archaeology Commons Recommended Citation Dalton, Madison, "Savoring the moon: Japanese prints of the floating world" (2020). Senior Honors Projects, 2020-current. 10. https://commons.lib.jmu.edu/honors202029/10 This Thesis is brought to you for free and open access by the Honors College at JMU Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Senior Honors Projects, 2020-current by an authorized administrator of JMU Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. Savoring the Moon: Japanese Prints of the Floating World _______________________ An Honors College Project Presented to the Faculty of the Undergraduate College of Visual and Performing Arts James Madison University _______________________ by Madison Britnell Dalton Accepted by the faculty of the Madison Art Collection, James Madison University, in partial fulfillment of the requirements for the Honors College. FACULTY COMMITTEE: HONORS COLLEGE APPROVAL: Project Advisor: Virginia Soenksen, Bradley R. Newcomer, Ph.D., Director, Madison Art Collection and Lisanby Dean, Honors College Museum Reader: Hu, Yongguang Associate Professor, Department of History Reader: Tanaka, Kimiko Associate Professor, Department of Sociology Reader: , , PUBLIC PRESENTATION This work is accepted for presentation, in part or in full, at Honors Symposium on April 3, 2020. -

B U L L E T I N
THE SMART MUSEUM OF ART BULLETIN 1990-1991 1991-1992 THE DAVID AND ALFRED SMART MUSEUM OF ART THE UNIVERSITY OF CHICAGO THE SMART MUSEUM OF ART B U L L E T I N 1990-1991 1991-1992 THE DAVID AND ALFRED SMART MUSEUM OF ART THE UNIVERSITY OF CHICAGO CONTENTS Volume 3, 1990-1991, 1991-1992. STUDIES IN THE PERMANENT COLLECTION Copyright © 1992 by The David and Alfred Smart Museum of Art, The University of Chicago, Sectionalism at Work: Construction and Decoration Systems in Ancient Chinese 5550 South Greenwood Avenue, Ritual Vessels 2 Chicago, Illinois, 60637. All rights reserved. ISSN: 1041-6005 Robert J. Poor Three Rare Poetic Images from Japan 18 Louise E. Virgin Photography Credits: Pages 3-14, figs. 1, 2, 3, 4, 5, Jerry Kobyleky Museum Photography; figs, la, 2a, 3a, 5a-f, courtesy of Jon Poor / Poor Design, ©1992 Robert Poor. Pages 19-23, figs. 1-3, Jerry Brush and Ink Paintings by Modern Chinese Women Artists in the Kobyleky Museum Photography. Pages 35-46, 51, Jerry Kobyleky Smart Museum Collection 26 Museum Photography. Page 53, Lloyd De Grane. Page 55, Mark Harrie A. Vanderstappen Steinmetz. Page 56, Rachel Lerner. Page 57, John Booz, ©1991. Pages 58, 60, Matthew Gilson, ©1992. Page 61, Lloyd De Grane. Editor: Stephanie D'Alessandro ACTIVITIES AND SUPPORT Design: Joan Sommers Printing: The University of Chicago Printing Department Collections 34 Acquisitions Loans from the Collection Exhibitions and Programs 30 Exhibitions Events Education Publications Sources of Support 63 Grants Contributions Donors to the Collection Lenders to the Collection This issue of the Bulletin, with three articles on and Japanese works of art given in honor of East Asian works of art in the collection of the Professor Vanderstappen by various donors. -

Rising Sun at Te Papa: the Heriot Collection of Japanese Art David Bell* and Mark Stocker**
Tuhinga 29: 50–76 Copyright © Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa (2018) Rising sun at Te Papa: the Heriot collection of Japanese art David Bell* and Mark Stocker** * University of Otago College of Education, PO Box 56, Dunedin, New Zealand ([email protected]) ** Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, PO Box 467, Wellington, New Zealand ([email protected]) ABSTRACT: In 2016, the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa (Te Papa) acquired more than 60 Japanese artworks from the private collection of Ian and Mary Heriot. The works make a significant addition to the graphic art collections of the national museum. Their variety and quality offer a representative overview of the art of the Japanese woodblock print, and potentially illustrate the impact of Japanese arts on those of New Zealand in appropriately conceived curatorial projects. Additionally, they inform fresh perspectives on New Zealand collecting interests during the last 40 years. After a discussion of the history and motivations behind the collection, this article introduces a representative selection of these works, arranged according to the conventional subject categories popular with nineteenth- and early twentieth-century Japanese audiences. Bijin-ga pictures of beautiful women, genre scenes and kabuki-e popular theatre prints reflect the hedonistic re-creations of ukiyo ‘floating world’ sensibilities in the crowded streets of Edo. Kachöga ‘bird and flower pictures’ and fukeiga landscapes convey Japanese sensitivities to the natural world. Exquisitely printed surimono limited editions demonstrate literati tastes for refined poetic elegance, and shin-hanga ‘new prints’ reflect changes in sensibility through Japan’s great period of modernisation. -
Japanese Prints Surimono and Paintings
Japanese Prints Surimono and Paintings LELLA & GIANNI MORRA Catalogue 11 Lella & Gianni Morra Giudecca 699 30133 Venezia Italy Tel. & Fax: +39 041 528 8006 Mobile: +39 333 471 9907 (by appointment only) E-mail: [email protected] www.morra-japaneseart.com Acknowledgements: Many thanks to our friends: Giglia Bragagnini for the translation from Japanese, John Fiorillo for information on painting no. 67, Mattia Biadene for the catalogue layout and Ampi-chan for her patience. Japanese Prints, Surimono and Paintings LELLA & GIANNI MORRA Fine Japanese Prints and Illustrated Books 1. Suzuki Harunobu (1725?-1770) Two lovers. From a series of erotic prints, ca. 1768. Signed on the screen in the foreground Harunobu ga. Format chuban, 19,4x25,3 cm. 2. Kitao Masanobu (1761-1816) Two lovers and a the sleeping hausband. From a series of erotic prints, ca. 1785. Unsigned as all prints in the series. Format chuban, 18x25,6 cm. 3. Kitao Masanobu (1761-1816) Two lovers near a kotatsu. From the same series as last, ca. 1785. Unsigned. Format chuban, 19,2x25,1 cm. 4. Katsukawa Shuncho (active ca. 1780-1800) Two lovers. From the series of erotic prints Shikido shusse kagami (Mirror of the Excellent Love Path) ca. 1790-5. Unsigned as all prints in the series. Format chuban, 18,5x24,7 cm. 5. Katsukawa Shuncho (active ca. 1780-1800) Two lovers. From an untitled series of erotic prints published in 1797. Unsigned as all prints in the series. Format oban, 25,3x37,5 cm. Another impression is illustrated in Kobayashi and Shirakura, p. 203. 6. Kitagawa Utamaro (1753?-1806) A courtesan and her lover seated on a bench in a summer evening. -

Israel Goldman Japanese Prints and Paintings
Israel Goldman Japanese Prints and Paintings Thirtieth Anniversary Catalogue 17 2011 Israel Goldman Japanese Prints and Paintings Thirtieth Anniversary Catalogue 17 2011 1 Hosoda Eishi (1756-1829) A Beauty Dreaming of the Tales of Ise. Ca. 1800. Hanging scroll. Ink and colour on silk. 79.7 x 30 cm. Signed: Chobunsai Eishi hitsu. Sealed: Eishi. Box lid inscription by Muneshige Narazaki. Nikuhitsu ukiyo-e taikan (Kobayashi Tadashi, editor) Vol. 6. no. 30. Provenance: Azabu Museum of Arts and Crafts, Tokyo. An Important Collection of Japanese Ukiyo-e Paintings, Christies, New York, 1998, lot 67. Eishi is known to have repeated his painting compositions and there are two other recorded versions of this subject, one in the British Museum and the other in the Chiossone Museum, Genoa (see Tim Clark, Ukiyo-e Paintings in the British Museum, 1992, plate 75). 2 Katsukawa Shunsho (1726-1792) Nakamura Juzo II. 1774. Hosoban. 32 x 15.1 cm. The Theatrical Prints of the Katsukawa Masters, Riccar Art Museum, Tokyo, 1992, no. 22 (this impression). Fine impression. Very good colour and condition. 3 Katsukawa Shunsho (1726-1792) Yamashita Kinsaku I as Asaka no Tsubone in a Storm at Night. From the play Keisei momiji no uchikake. 1772. Hosoban. 31.3 x 14.6 cm. Japanese Prints of the Ledoux Collection, Harunobu and Shunsho, 1945, no. 48. Fine impression. Very good colour and condition. As Ledoux (op. cit.) notes, “when Shunsho is fine, he is fine indeed and there will be few lovers of his work who will fail to accord this subject high rank … It is masterly in composition and masterly in dramatic power and every line of it helps to build the total effect.” 4 Suzuki Harunobu (1725?-1770) A Traveller Drags a Maid Servant Underneath a Mosquito Net. -

Volume X Number 2 CONTENTS Fall 2002 2
Volume X Number 2 CONTENTS Fall 2002 From the Editors' Desk 編纂者から 2 Articles 論文 Early Modern Japanese Art History--An Overview of the State of the Field Patricia Graham 2 Early Modern Literature Haruo Shirane and Lawrence E. Marceau 22 Foreign Affairs And Frontiers in Early Modern Japan: A Historiographical Essay of the Field Brett L. Walker 44 Book Reviews. 書評 Timon Screech, Sex and the Floating World: Erotic Images in Japan 1700-1820 David Pollack 62 Cynthia Viallé & Leonard Blussé, eds., The Deshima Dagregisters, Volume XI, 1641-1650 Beatrice M. Bodart-Bailey 71 EMJ Annual Meeting Discussion EMJ大会討論 Literati and Society in Early Modern Japan: An EMJ Panel Discussion 75 Bibliographies 参考文献 Early Modern Japanese Art History: A Bibliography of Publications, Primarily in English Patricia J Graham 78 Bibliography of Literature in Early Modern Japan Haruo Shirane with Lawrence Marceau 105 Foreign Affairs and Frontiers in Early Modern Japan: A Bibliography Brett L. Walker 124 Editors Philip C. Brown Ohio State University Lawrence Marceau University of Delaware Editorial Board Sumie Jones Indiana University Ronald Toby Tokyo University For subscription information, please see end page. The editors welcome preliminary inquiries about manuscripts for publication in Early Modern Japan. Please send queries to Philip Brown, Early Modern Japan, Department of History, 230 West 17th Avenue, Colmbus, OH 43210 USA or, via e-mail to [email protected]. All scholarly articles are sent to referees for review. Books for review and inquiries regarding book reviews should be sent to Law- rence Marceau, Review Editor, Early Modern Japan, Foreign Languages & Lit- eratures, Smith Hall 326, University of Deleware, Newark, DE 19716-2550. -

Japanese Prints, Illustrated Books and Paintings
Japanese Prints, Illustrated Books and Paintings LELLA & GIANNI MORRA Japanese Prints, Illustrated Books and Paintings LELLA & GIANNI MORRA Fine Japanese Prints and Works of Art Giudecca 699 30133 Venezia Italy Tel. and fax: +39 04152 88006 (by appointment only) E-mail: [email protected] www.morra-japaneseart.com 1.2.3 Unsigned (18th century) Samurai warriors. Ink and colour on paper. Unsigned. 18th century. 9x25 cm. each fan. Three fine miniature fan paintings decorated with scenes of battle probably between theTaira and the Minamoto: the arrival of the enemy’s ships, warriors leaping from one boat to another and warriors fighting in the water. 4. Nishikawa Sukenobu (1671-1750) A courtesan and her client. From the album Furyu Yamato-e-zukushi: Nishikawa Fude no Yama, ca. 1720. Unsigned as all plates from this album. Format: oban, 37,7x25,2 cm. Another impression in the Matsui Collection is illustrated in Koishikawa, no.16. 5. Isoda Koryusai 1735-1790 Looking at the mirror. The best design from the important shunga set Shikido torikumi juniban (Twelve Holds of Love), ca. 1775-77. Format: oban, 25,7x38 cm. Other impressions are illustrated in Lane 1996, vol.3, plate 4, Uhlenbeck & Winkel, no.28a, Klompmakers, no. E4. 6. Isoda Koryusai 1735-1790 Two lovers behind a low screen. From the same series as last, ca. 1775-77. Format: oban, 26x38 cm. Other impressions are illustrated in Lane 1996, vol.3, plate 3, Klompmakers, no. E3. 7. Torii Kiyonaga (1752-1815) Two lovers. From the series Sode no maki (The sleeve scroll), published in 1785. -

El Género Musha-E En La Biblioteca De La Facultad De Bellas Artes De La Universidad Complutense De Madrid Y Juan Carlos Cebrián
Trabajo Fin de Grado El género musha-e en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Juan Carlos Cebrián Autor/es Alba María Finol Sola Director/es Elena Barlés Baguena Facultad de Filosofía y Letras 2015/2016 1 RESUMEN Una de las tipologías del arte japonés más coleccionadas en España son los grabados (ukiyo-e), mientras que una de las figuras niponas más conocidas en Occidente es el samurái; de la combinación de estos dos elementos resulta el género de estampas de temática samurái (musha-e), piezas que además escondían un mensaje crítico con la situación política del momento y eludían la censura trasladando a sus protagonistas a situaciones paralelas de épocas anteriores. En la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid se encuentran dos álbumes de este género que llegaron a la misma gracias a la donación de la excepcional figura de Juan Carlos Cebrián Cervera, quien desde Estados Unidos, ayudó a poner en marcha y nutrir de fondos a varias bibliotecas españolas. Los autores de los álbumes son Tsukioka Yoshitoshi y Utagawa Yoshiiku, dos de los mejores artistas de la época que cultivaron el género. 2 INDICE: PORTADA ......................................................................................................................... Pág.1 RESUMEN ......................................................................................................................... Pág. 2 INDICE ..............................................................................................................................