Die Konstruktion Gesellschaftlicher Identität Im Caprivi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
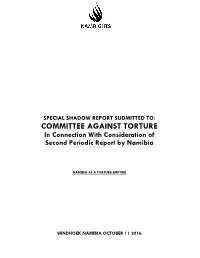
COMMITTEE AGAINST TORTURE in Connection with Consideration of Second Periodic Report by Namibia
SPECIAL SHADOW REPORT SUDMITTED TO: COMMITTEE AGAINST TORTURE In Connection With Consideration of Second Periodic Report by Namibia NAMIBIA AS A TORTURE EMPTIRE WINDHOEK NAMIBIA OCTOBER 11 2016 ABOUT NAMRIGHTS INC Formerly known as National Society for Human Rights (“NSHR”), NamRights Inc (hereinafter “NamRights”) is a private, independent, non-partisan and non-profit making human rights monitoring and advocacy organization. Founded on December 1 1989 by concerned citizens, the Organization envisages a world free of human rights violations. Its mission is to stop human rights violations in Namibia and the rest of the world. NamRights bases its legal existence on the provisions of Article 21(1) (e) of the Namibian Constitution as well as Article 71 of the UN Charter, read with Economic and Social Council Resolutions 1296 (XLIV) and E/1996/31. The Organization is lawfully registered in terms of Section 21(a) of the Companies Act 1973 (Act 61 of 1973), as amended, as an association incorporated not for gain. Both African Commission on Human and Peoples' Rights of African Union (in 1993) and UN Economic and Social Council (in 1997) recognize NamRights as a bona fide human rights organization truly concerned with matters in their respective competence. The organization can be reached via this address: NamRights Liberty Center 116 John Meinert Street Windhoek-West P. O. Box 23592 Windhoek Namibia Tel: +264 61 236 183/+264 61 253 447/+264 61 238 711 Fax: +264 88 640 669/+264 61 234 286 Mobile: +264 811 406 888 E-mail1: [email protected] E-mail2: [email protected] Web: www.nshr.org.na 2 I. -

Major Trollope and the Eastern Caprivi Zipfel One Night As He Lay
Conference Paper for ABORNE 2009. Please do not cite vilify or pillage without at least talking to me. Beyond the Last Frontier: Major Trollope and the Eastern Caprivi Zipfel One night as he lay sleeping on the veranda of his residence in Katima Mulilo Major L.F.W. Trollope, the Native Commissioner and Resident Magistrate for the Eastern Caprivi Zipfel, was attacked by a nineteen year old wielding an axe. Major Trollope survived the attack and the assailant was soon arrested, but in the subsequent trial the “plum posting” that Trollope had created on the furthermost frontier of South African rule came crashing down. The trial brought to the fore that Trollope lived beyond the control of the South African administration to which he was formally subject, and that instead he had become enmeshed in the administrations of Northern Rhodesia and the Bechuanaland Protectorate. Originally appointed to Katima Mulilo to enforce South African rule in the Eastern Caprivi Zipfel, Trollope increasingly established his own fiefdom on the outer fringes of South African rule, and became evermore integrated in the administrations of countries beyond the borders of South Africa. By the time of his demise, Trollope ruled the Eastern Caprivi Zipfel in a manner that had more in keeping with the academically schooled coterie of District Commissioners of Northern Rhodesia and the Bechuanaland Protectorate, than that it bore relation to the apartheid securocrats of the South African Bantu Affairs Department to which he was nominally subject. Beyond the frontier Even amongst the arbitrarily drawn borders of Africa, the borders of the Namibian Caprivi strip are a striking anomaly jutting 500 kilometres into the African continent. -

S V Mushwena and Others
CASE NO.: SA 6/2004 IN THE SUPREME COURT OF NAMIBIA In the matter between THE STATE APPELLANT versus MOSES LIMBO MUSHWENA 1ST RESPONDENT (ACC 12) FRED MAEMELO ZIEZO 2ND RESPONDENT (ACC 25) ANDREAS MULUPA 3RD RESPONDENT (ACC 26) RICHARD LIBANO MISUHA 4TH RESPONDENT (ACC 48) OSCAR MUYUKA KUSHALUKA PUTEHO 5TH RESPONDENT (ACC 49) RICHARD JOHN SAMATI 6TH RESPONDENT (ACC 53) JOHN SIKUNDEKO SAMBOMA 7TH RESPONDENT (ACC 54) OSBERT MWENYI LIKANYI 8TH RESPONDENT (ACC 57) THADEUS SIYOKA NDALA 9TH RESPONDENT (ACC 70) MARTIN SIYANO TUBAUNDULE 10 TH RESPONDENT (ACC 71) OSCAR NYAMBE PUTEHO 11 TH RESPONDENT (ACC 72) CHARLES MAFENYAHO MUSHAKWA 12 TH RESPONDENT (ACC 73) CHARLES KALIPA SAMBOMA 13 TH RESPONDENT (ACC 119) CORAM: Strydom, ACJ, O'Linn, AJA, Mtambanengwe, AJA, Gibson, AJA et Chomba, AJA. HEARD ON: 10-12/05/2004 DELIVERED ON: ____________________________________________________________________________ APPEAL JUDGMENT ____________________________________________________________________________ 2 MTAMBANENGWE A.J.A.: The state appeals against Hoff J's judgment in favour of the thirteen respondents that the court did not have jurisdiction to try them. The application leading to the court a quo's ruling began as an application on notice of motion supported by various affidavits deposed by the respondents. The notice of motion sought an order declaring inter alia that the respondents apprehension and abduction from Zambia and Botswana respectively, and their subsequent transportation to Namibia and their arrest and detention pursuant thereto was in breach of international law, unlawful and that they had not been properly and lawfully arraigned before the court for trial on the charge preferred against them. The court a quo directed that the notice of motion and the supporting affidavits be regarded as respondents pleas in terms of section 106 (1) of the Criminal Procedure Act 57 of 1977, namely that the court a quo had not jurisdiction to try the 13 respondents. -

The Rule of Law in Namibia Sam K Amoo and Isabella Skeffers
The rule of law in Namibia Sam K Amoo and Isabella Skeffers Introduction The Republic of Namibia, as the country is now known, was declared a German Protectorate in 1884 and a Crown Colony in 1890, and thereafter became known as South West Africa. The territory remained a German colony from 1884 until 1915, when it was occupied by South African forces. From 1920 onwards the territory became a Protectorate, or a Mandated Territory of South Africa in terms of the Peace Treaty of Versailles. Namibia achieved its independence in 1990 after a long and protracted struggle, on both diplomatic and military fronts, for the achievement of self-determination and sovereignty. The South African Administration was characterised by patent abuse of the human rights of the indigenous people of Namibia. Apartheid, as a political system, is inconsistent with the rule of law; consequently, any political or a legal system based on apartheid will be devoid of the rule of law. This was the basic characteristic of the South African Administration in Namibia. It was devoid of the rule of law and legitimised by the decisions of a judiciary that justified the racist policies and violations of the rule of law on legislative supremacy and analytical positivism. With the achievement of sovereignty and self-determination, however, Namibia adopted a Constitution which is the supreme law of the nation, and ushered in the principle of constitutional supremacy and a system of governance based on the principles of constitutionalism, the rule of law, and respect for the human rights of the individual. Constitution The Namibian Constitution came into force on the eve of the country’s independence as the supreme law of the land and, therefore, the ultimate source of law in Namibia. -

Namibia Page 1 of 9
Namibia Page 1 of 9 Namibia Country Reports on Human Rights Practices - 2006 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor March 6, 2007 Namibia is a multiparty, multiracial democracy with a population of 2,030,000. On March 21, Hifikepunye Pohamba became the country's second democratically elected president; Pohamba was elected in November 2004 and replaced Sam Nujoma, the country's first president and leader of the ruling South West Africa People's Organization (SWAPO). International and domestic observers agreed the 2004 general elections, in which SWAPO won three-quarters of the national assembly seats, were generally free and reflected the will of the electorate despite some irregularities. The civilian authorities generally maintained effective control of the security forces. The government generally respected the human rights of its citizens; however, there were problems in several areas. Human rights problems included: unlawful killings, torture, beatings, and abuse of criminal suspects and detainees by security forces; overcrowded prisons; prolonged pretrial detention and long delays in trials; government attempts to curb media and nongovernmental (NGO) criticism; violence against women and children, including rape and child abuse; discrimination against women, ethnic minorities, and indigenous peoples; and child labor. RESPECT FOR HUMAN RIGHTS Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From: a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life The government or its agents did not commit any politically motivated killings; however, security forces killed persons during the year. The government took action against some perpetrators. On January 21, police shot and killed Collen Goliath after he was caught trying to break into the offices of the Ministry of Labor. -

Constitutional Democracy in Namibia
Constitutional democracy in Namibia A critical analysis after two decades Edited by Anton Bösl, Nico Horn & André du Pisani A This publication would not have been possible without the generous financial support of the Konrad Adenauer Foundation. Please note that the views expressed herein are not necessarily those of the Konrad Adenauer Foundation and of the editors. Konrad Adenauer Foundation P.O. Box 1145 Windhoek [email protected] www.kas.de/namibia © Konrad-Adenauer Stiftung and the Authors 2010 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. Cover design: Red Sky and Anton Bösl Content editors: Anton Bösl, Nico Horn & André du Pisani Language editor: Sandie Fitchat Printing: John Meinert Printing (Pty) Ltd Publisher Macmillan Education Namibia PO Box 22830 Windhoek Namibia Tel. (+264 61) 225568 ISBN 978-99916-2-439-6 B Table of contents Foreword .......................................................................................................................iii Peter H Katjavivi Introduction .................................................................................................................... v Anton Bösl, Nico Horn and André du Pisani List of contributors ......................................................................................................xiii -

Constitutional Democracy in Namibia
Constitutional jurisprudence in Namibia since Independence George Coleman and Esi Schimming-Chase Introduction Administrative bodies and administrative officials who are capable of making decisions affecting the citizens should always bear in mind that, by the adoption of the Constitution of Namibia, we have been propelled from a culture of authority to a culture of justification.1 The above is a profound departure from the following:2 Whether or not any legislative measure is calculated to promote or to harm these interests of the inhabitants, would be a matter of policy in the discretion of Parliament, into which our Courts would decline to enquire. These two statements by judges 37 years apart not only reflect the evolution of the legal culture in Namibia since Independence, they also manifest the jurisprudential polarity between a natural law approach and legal positivism.3 According to some South African academics, positivism, as a legal theory, is to blame for the terrible track record of the judiciary in respect of the protection of civil liberties in apartheid South Africa4 (and, by extension, Namibia prior to Independence). This is chillingly demonstrated in R v Sachs, where the following was stated:5 Courts of law do scrutinise such statutes with the greatest care but where the statute under consideration in clear terms confers on the Executive autocratic powers over individuals, courts of law have no option but to give effect to the will of the Legislature as expressed in the statute. Where, however, the statute is reasonably capable of more than one meaning a court of law will give it the meaning which least interferes with the liberty of the individual. -

POL100042004ENGLISH.Pdf
AMNESTY INTERNATIONAL This report covers the period January to December 2003 CHI"'''' PACIFIC OCEAN >If.."" ( ,-� \ ) 1,",01'" ... , / �" I PACIFIC OCEAN """"'" , " INDIAN OCEAN \, r ,0 ,> I 1.\� .,- First published in 2004 by Amnesty International Publications International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WCl X ODW United Kingdom www.amnesty.org e Copyright Amnesty International Publlcalions 2004 ISBN: 0·86210·354·1 AI Index: POl 101004/2004 Original language: English Printed by: The Alden Press Osney Mead, Oxford United Ki ngdom Cover design by Synergy Maps by Andr�s Bereznay, wwwhistoryonmaps.com All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise without the prior permission of the publishers. AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2004 ERRATA Rwanda Page 71, column 2, paragraph S. hne7 should read: end of the year, the ICTRhad delivered 17judgments Brazil Page 103. column 2, paragraph 4, line S should read· ... Adenllson 8arbosa da Silva and Joseilton Jose dos Santos •.. Thailand Page 192. column 2, paragraph 2, line 3 should read bodies were found in a fiver on the Thai-Myanmar border Jordan Page 288. column 2, paragraph 2, line I should read e Journalist Muhannad Mubaidin served a six... CONTENTS CONTENTS Preface/ l A message from the Secretary Generall3 Building an international human rights agenda/5 PART 1 Africa regional overview/28·30 A-Z country entries/31 -

NAMIBIA Namibia Is a Multiparty Democracy with a Population Of
NAMIBIA Namibia is a multiparty democracy with a population of approximately 2.2 million. The presidential and parliamentary elections held in November 2009 resulted in the reelection of President Hifikepunye Pohamba and the retention by the ruling South West Africa People's Organization (SWAPO) of its parliamentary majority. Despite some irregularities, international observers characterized the election as generally free and fair. In March the High Court dismissed a challenge to the election outcome filed by nine opposition parties; however, in September the Supreme Court overturned the decision and sent the case back to the High Court, where the case remained pending at year's end. Security forces reported to civilian authorities. Human rights problems included police use of excessive force; prison overcrowding and poor conditions in detention centers; arbitrary arrest, prolonged pretrial detention, and long delays in trials; criticism of nongovernmental organizations (NGOs); harassment and political intimidation of opposition members; and official corruption. Societal abuses included violence against women and children, including rape and child abuse; discrimination against women, ethnic minorities, and indigenous people; child trafficking; discrimination and violence based on sexual orientation and gender identity; and child labor. RESPECT FOR HUMAN RIGHTS Section 1 Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom From: a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life There were no reports that the government or its agents committed arbitrary or unlawful killings. There were no developments in the 2008 case in which a police officer shot and killed a demonstrator who stabbed a police constable during a political rally. On April 22, seven of the nine police officers accused of killing a suspect during interrogation in 2006 were found guilty of culpable homicide, assault with intent to do grievous bodily harm, and obstructing the course of justice. -

Journal of Namibian Studies
Journal of Namibian Studies History, Politics, Culture 28 / 2020 Otjivanda Presse.Bochum ISSN 1863-5954 (print) ISSN 2197-5523 (online) Journal of Namibian Studies History Politics Culture Editor Andreas Eckl [email protected] Language Editor Eoin Ryan [email protected] Editorial Advisory Board Bruno Arich-Gerz, Department for German Language and Literature Studies, University Wuppertal, Germany Medardus Brehl, Institute for Diaspora and Genocide Studies, Ruhr- University Bochum, Germany Tilman Dedering, History Department, University of South Africa, Pretoria, South Africa Ute Dieckmann, Institute of Ethnology, University of Cologne, Germany Gregor Dobler, Institute of Cultural and Social Anthropology, University Freiburg, Germany John Friedman, Socio-Cultural Anthropology and Development, University College Roosevelt, Middelburg, The Netherlands Wendi Haugh, Anthropology and African Studies, St. Lawrence University, Canton, NY, USA Matthias Häußler, Department of Sociology, University Siegen, Germany Dag Henrichsen, Basler Afrika Bibliographien, Basel, Switzerland Meredith McKittrick, School of Foreign Service, Georgetown University, Washington, D.C., USA Henning Melber, The Nordic Africa Institute, Uppsala, Sweden Andre du Pisani, Department of Political Studies, University of Namibia, Windhoek, Namibia Chris Saunders, Department of Historical Studies, University of Cape Town, Cape Town, South Africa Napandulwe Shiweda, Multidisciplinary Research Center, University of Namibia, Windhoek, Namibia Jake Short, Department -

Godwin Kornes
2013 ARBEITSPAPIER – WORKING PAPER 141 Godwin Kornes Negotiating 'silent reconciliation' The long struggle for transitional justice in Namibia ARBEITSPAPIERE DES INSTITUTS FÜR ETHNOLOGIE UND AFRIKASTUDIEN WORKING PAPERS OF THE DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY AND AFRICAN STUDIES AP IFEAS 141/2013 Herausgegeben von / The Working Papers are edited by: Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität, Forum 6, D-55099 Mainz, Germany. Tel. +49-6131-3923720; Email: [email protected]; http://www.ifeas.uni-mainz.de http://www.ifeas.uni-mainz.de/92.php Geschäftsführende Herausgeberin / Managing Editor: Eva Spies ([email protected]) Copyright remains with the author. Zitierhinweis / Please cite as: Godwin Kornes (2013) Negotiating 'silent reconciliation': The long struggle for transitional justice in Namibia. Arbeitspapiere des Instituts für Ethnologie und Afrikastudien der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Working Papers of the Department of Anthropology and African Studies of the Johannes Gutenberg University Mainz) 141. <URL: http://www.ifeas.uni-mainz.de/Dateien/AP141.pdf>. Godwin Kornes: Negotiating 'silent reconciliation': The long struggle for transitional justice in Namibia Abstract / Zusammenfassung After more than a century of colonial rule, Namibia became an independent nation-state in 1990, since then ruled by the erstwhile armed liberation movement, SWAPO. During its 23 year-long guerrilla war against South African occupation, SWAPO was rocked by a series of internal crises and violent purges, which – just as the wide range of human rights abuses committed by the apartheid regime – have never been officially investigated. Instead, SWAPO issued blanket amnesty for both sides of the conflict and a Policy of National Reconciliation, which is based on a commitment to closure for the sake of nation-building. -

Namibia 2016 Human Rights Report
NAMIBIA 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY Namibia is a constitutional multiparty democracy. In local and regional elections held in November 2015, the ruling Swapo party won 112 of 121 regional council seats and gained control of 54 of 57 local authorities. Elections held in November 2014 resulted in the election of Prime Minister Hage Geingob to the presidency and retention by Swapo of its large parliamentary majority. International observers characterized the elections in 2014 and 2015 as generally free and fair. Civilian authorities generally maintained effective control over the security forces. The most significant human rights problems in the country included the slow pace of judicial proceedings and resulting lengthy pretrial detention, sometimes under poor conditions; violence and discrimination against women and children, including rape; and child labor. Other governmental human rights problems included corruption by officials, discrimination against ethnic minorities and indigenous people, lack of public access to government information, and attempts to curb media freedom. The government took steps to prosecute or punish officials who committed abuses, whether in the security services or elsewhere in the government, but impunity existed. Section 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from: a. Arbitrary Deprivation of Life and other Unlawful or Politically Motivated Killings There were no reports the government or its agents committed or were responsible for arbitrary or unlawful killings. b. Disappearance There were no reports of politically motivated disappearances. c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment NAMIBIA 2 The constitution and law prohibit such practices, but the law does not define “torture” or separately classify it as a crime.