Peter Hättenschwiler
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Recent Literature on Lepidoptera
1965 Joumal of the Lepidopterists' Society 245 RECENT LITERATURE ON LEPIDOPTERA Under this heading are ineluded abstracts of papers and books of interest to lepidopterists. The world's literature is searched systematically, and it is intended that every work on Lepidoptera published after 1946 will be noticed here. Papers of only local interest and papers from this Joumal are listed without abstract. Read ers, not in North America, interested in assisting with the abstracting, are invited to write Dr. P. F . Bellinger (Department of Biological Sciences, San Fernando Valley State College, Northridge, California, U.S.A.). Abstractor's initials are as follows: [P.B.] - P. F. BELLINGER [W.H.] - W. HACKMAN [N.O.] - N. S. OBRAZTSOV [I.C.] - I. F. B. COMMON [T.I.] - TARO IWASE [C.R.] - C. L. REMINGTON [W.c.] - W. C. COOK [T.L.] - T. W. LA NGER [J.T.] - J. W. TILDEN [A.D.] - A. DIAKO NOFF [J.M.] - J. MOUCHA [P.V.] - P. E. L. VIETTE [J.D.] - JULIAN DO NAHUE [E.M.] - E. G. MUNROE B. SYSTEMATICS AND NOMENCLATURE Niculescu, Eugen, "Papilionidae" [in Rumanian]. Fauna Republicii Populare Ro mine, vol. XI, fasc. 5, 103 pp., 8 pIs., 32 figs. Academy of Sciences, Bucuresti. 1961. [price 6,40 Lei]. In the introductory part the author describes the taxonomy of all genera of Roumanian Papilionidae with remarks on the exotic species also. In the taxonomic part (pp.41-103 ) all spp. which occur in Rou mania are described. In this country occur: Papilw machaon, Iphiclides podalirius, Zerynthia polyxena, Z. cerisyi, Pamassius mnemosyne, & P. apollo. [J. -

Schutz Des Naturhaushaltes Vor Den Auswirkungen Der Anwendung Von Pflanzenschutzmitteln Aus Der Luft in Wäldern Und Im Weinbau
TEXTE 21/2017 Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Forschungskennzahl 3714 67 406 0 UBA-FB 002461 Schutz des Naturhaushaltes vor den Auswirkungen der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft in Wäldern und im Weinbau von Dr. Ingo Brunk, Thomas Sobczyk, Dr. Jörg Lorenz Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Tharandt Im Auftrag des Umweltbundesamtes Impressum Herausgeber: Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Tel: +49 340-2103-0 Fax: +49 340-2103-2285 [email protected] Internet: www.umweltbundesamt.de /umweltbundesamt.de /umweltbundesamt Durchführung der Studie: Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Professur für Forstzoologie, Prof. Dr. Mechthild Roth Pienner Straße 7 (Cotta-Bau), 01737 Tharandt Abschlussdatum: Januar 2017 Redaktion: Fachgebiet IV 1.3 Pflanzenschutz Dr. Mareike Güth, Dr. Daniela Felsmann Publikationen als pdf: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen ISSN 1862-4359 Dessau-Roßlau, März 2017 Das diesem Bericht zu Grunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unter der Forschungskennzahl 3714 67 406 0 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren. UBA Texte Entwicklung geeigneter Risikominimierungsansätze für die Luftausbringung von PSM Kurzbeschreibung Die Bekämpfung -

Recerca I Territori V12 B (002)(1).Pdf
Butterfly and moths in l’Empordà and their response to global change Recerca i territori Volume 12 NUMBER 12 / SEPTEMBER 2020 Edition Graphic design Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis Mostra Comunicació Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Museu de la Mediterrània Printing Gràfiques Agustí Coordinadors of the volume Constantí Stefanescu, Tristan Lafranchis ISSN: 2013-5939 Dipòsit legal: GI 896-2020 “Recerca i Territori” Collection Coordinator Printed on recycled paper Cyclus print Xavier Quintana With the support of: Summary Foreword ......................................................................................................................................................................................................... 7 Xavier Quintana Butterflies of the Montgrí-Baix Ter region ................................................................................................................. 11 Tristan Lafranchis Moths of the Montgrí-Baix Ter region ............................................................................................................................31 Tristan Lafranchis The dispersion of Lepidoptera in the Montgrí-Baix Ter region ...........................................................51 Tristan Lafranchis Three decades of butterfly monitoring at El Cortalet ...................................................................................69 (Aiguamolls de l’Empordà Natural Park) Constantí Stefanescu Effects of abandonment and restoration in Mediterranean meadows .......................................87 -

Zur Systematischen Stellung Von Dysmasia Lusitaniella Amsel, 1955 (Lep., Tineoidea)
Zur systematischen Stellung von Dysmasia lusitaniella Amsel, 1955 (Lep., Tineoidea) Autor(en): Sauter, W. Objekttyp: Article Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society Band (Jahr): 59 (1986) Heft 3-4 PDF erstellt am: 29.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-402217 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE 59. 239-242. 1986 Zur systematischen Stellung von Dysmasia lusitaniella Amsel, 1955 (Lep.,Tineoidea) W. Sauter Entomolog. Institut der ETH Zürich. CH-8092 Zürich The systematic position of Dysmasia lusitaniella Amsel. -

Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista De Lepidopterología, Vol
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Corley, M. F. V.; Rosete, J.; Gonçalves, A. R.; Nunes, J.; Pires, P.; Marabuto, E. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2015 (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 44, núm. 176, diciembre, 2016, pp. 615-643 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45549852010 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 44 (176) diciembre 2016: 615-643 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2015 (Insecta: Lepidoptera) M. F. V. Corley, J. Rosete, A. R. Gonçalves, J. Nunes, P. Pires & E. Marabuto Abstract 39 species are added to the Portuguese Lepidoptera fauna and one species deleted, mainly as a result of fieldwork undertaken by the authors and others in 2015. In addition, second and third records for the country, new province records and new food-plant data for a number of species are included. A summary of recent papers affecting the Portuguese fauna is included. KEY WORDS: Insecta, Lepidoptera, distribution, Portugal. Novos e interessantes registos portugueses de Lepidoptera em 2015 (Insecta: Lepidoptera) Resumo Como resultado do trabalho de campo desenvolvido pelos autores e outros, principalmente no ano de 2015, são adicionadas 39 espécies de Lepidoptera à fauna de Portugal e uma é retirada. -

Redalyc.A New Species of the Genus Dahlica Enderlein, 1912 from The
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Arnscheid, W. R. A new species of the genus Dahlica Enderlein, 1912 from the Pyrenees of Aragon (Province of Huesca) in Spain (Lepidoptera: Psychidae, Dahlicini) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 44, núm. 173, marzo, 2016, pp. 39-43 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45545991004 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 44 (173) marzo 2016: 39-43 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 A new species of the genus Dahlica Enderlein, 1912 from the Pyrenees of Aragon (Province of Huesca) in Spain (Lepidoptera: Psychidae, Dahlicini) W. R. Arnscheid Abstract A new Psychid, Dahlica michaela Arnscheid, sp. n. is described from the Spanish Pyrenees (Aragon, Huesca). The differences to other related species within the tribe Dahlicini is given. KEY WORDS: Lepidoptera, Psychidae, Dahlicini, Dahlica, new species, morphology, distribution, biology, Benasque, Huesca, Spain. Una nueva especie del género Dahlica Enderlein, 1912 de los Pirineos de Aragón (provincia de Huesca) en España (Lepidoptera: Psychidae, Dahlicini) Resumen Se describe un nuevo psíchido, Dahlica michaela Arnscheid, sp. n., de los Pirineos españoles (Aragón, Huesca). Se dan las diferencias con otras especies relacionadas dentro de la tribu Dahlicini. PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Psychidae, Dahlicini, Dahlica, nueva especie, morfología, distribución, biología, Benasque, Huesca. -

Redalyc.Miscellaneous Additions to the Lepidoptera of Portugal (Insecta
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Corley, M. F. V.; Maravalhas, E.; Passos de Carvalho, J. Miscellaneous additions to the Lepidoptera of Portugal (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 34, núm. 136, 2006, pp. 407-427 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45513611 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 407-427 Miscellaneous addition 14/12/06 21:11 Página 407 SHILAP Revta. lepid., 34 (136), 2006: 407-427 SRLPEF ISSN:0300-5267 Miscellaneous additions to the Lepidoptera of Portugal (Insecta: Lepidoptera) M. F. V. Corley, E. Maravalhas & J. Passos de Carvalho (†) Abstrac 143 species of Lepidoptera collected by the authors and others in various localities in Portugal are listed as additions to the Portuguese fauna. 26 of the species are new records for the Iberian Peninsula. Two species are deleted from the Portuguese list. KEY WORDS: Insecta, Lepidoptera, distribution, Portugal. Adições à fauna de Lepidoptera de Portugal (Insecta: Lepidoptera) Resumo São referidas 143 espécies de Lepidoptera, coligidas de várias localidades de Portugal pelos autores e outros, que se considera serem novos registos para a fauna portuguesa. 26 destas espécies são também novas para a Península Ibérica. Dois registos são suprimidos. PALAVRAS CHAVE: Insecta, Lepidoptera, distribuição geográfica, Portugal. Adiciones a la fauna de Lepidoptera de Portugal (Insecta: Lepidoptera) Resumen Se citan 143 especies de Lepidoptera, cogidas en varios puntos de Portugal por los autores y otros, que se consideran nuevas para la fauna portuguesa. -

Review Helminth Therapy: Advances in the Use Of
©2018 Institute of Parasitology, SAS, Košice DOI 10.1515/helm-2017-0048 HELMINTHOLOGIA, 55, 1: 1 – 11, 2018 Review Helminth therapy: Advances in the use of parasitic worms against Infl ammatory Bowel Diseases and its challenges M. MARUSZEWSKA-CHERUIYOT*, K. DONSKOW-ŁYSONIEWSKA, M. DOLIGALSKA Department of Parasitology, Faculty of Biology University of Warsaw, Miecznikowa 1, 02-096 Warsaw, Poland, E-mail: [email protected] Article info Summary Received April 4, 2017 Development of modern medicine and better living conditions in the 20th century helped in reducing Accepted August 31, 2017 a number of cases of infectious diseases. During the same time, expansion of autoimmunological disorders was noticed. Among other are Infl ammatory Bowel Diseases (IBD) including ulcerative colitis and Crohn’s disease which are chronic and relapsing infl ammation of the gastrointestinal tract. Absence of effective treatment in standard therapies effects the search for alternative opportunities. As per hygienic hypothesis increasing number of cases of autoimmune diseases is as a result of re- duced exposure to pathogens, especially parasites. Thus, one of the promising remedial acts against IBD and other allergic and autoimmune disorders is “helminth therapy”. Cure with helminths seems to be the most effective therapy of IBD currently proposed. Helminth therapy focuses on advanta- geous results that have been obtained from the clinical trials, but its mechanisms are still unclear. Explanation of this phenomenon would help to develop new drugs against IBD based on helminth immunomodulatory molecules. Keywords: helminth therapy; Heligmosomoides polygyrus; Infl ammatory Bowel Diseases; ulcera- tive colitis Introduction into helminth therapy (HT) and helminth-derived product therapy (HDPT) concern the use of live helminths as treatment, as well as Helminths have co-evolved with their hosts over millions of years to the characterization of the key molecules responsible for immuno- arrive at a form of mutualism where both the host and the para site modulation. -

Lepidoptera)(2)
The EntomologioalEntomological SocietySooiety of Japan − ニ ー ー ュ : 昆 蟲 ( シ リ ズ), 12(1) 17 29,2009 日本産 ミ ノ ガ 科 の ミ ノ の 形 態 (2) 杉 本 美 華 1) 1) 京都大学大学院理 学研 究科動物系 統学研究室 − 〒606 8502 京都 市左京区北白川 追分町 Acomparative study of larval cases of Japanese Psychidae (Lepidoptera)(2) Mika SuGIMoTo1 ) 1 ) of Systemat {c Zoology Department of Laboratory , ZQology, Graduate School of Science, Kyoto University, − Kitashirakawa−Oiwakecho Sakyo−ku Kyoto 606 8502 Japan , , , − Jpn . J. Ent .(N .S .),12 (1): 17 29,2009 − − Abstrac ¢ . The larvae of Psychidae are so called bagworms because they conceal them se正ves each in a case with anterior and posterior openings . Such a case is spun with silk by a covered with of twigs stems mosses and so on . larva,and itssurf 彑ce is pieces leaves, ,grass , , The Iarval cases vary in size , form and outer covering , so that these features can be used fbr identification at the genus Qr species leve萋. In this study , I describe the shape and covering materials of cases 皿 the larval forllJapanesepsychidspec {es,i cluding 2 undescribed ones , of lOgenera. They are larger and specialiZed species and their larvae mostly feed on leaves of various economically and rare species designated in red data plants, including importantpests books of some prefectures. A key to 30 Japanese psychid species is given based on characters of larval case , : endangered species food habit of economic key to Japanese Key words , ,pests plants, species ,1arger−sized species , structure and material of larval case . 緒 言 ミ ノ ガ 科 (Psychidae)は鱗翅 目二 門類 の 原始的 -

Die Psychidenfauna Der Republik Zypern (Lepidoptera: Psychidae)
65 (1): 113 – 124 2015 © Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 2015 Die Psychidenfauna der Republik Zypern (Lepidoptera: Psychidae) Mit 6 Figuren und 1 Karte Michael Weidlich 1 1 Lindenallee 11, 15898 Neißemünde, OT Ratzdorf, Deutschland. – [email protected] Published on 2015–06–30 Zusammenfassung In der vorliegenden Arbeit wird der Kenntnistand zur Psychidenfauna der Republik Zypern mitgeteilt. Aktuell liegen Nachweise von insgesamt 6 Arten dieser Familie vor. Eine neue Art, Eumasia cyprianella spec. nov. wird hierin beschrieben. Der Verfasser weilte in den Jahren 1998, 1999, 2012 und 2014 auf der Insel. Erste Ergebnisse der Aufsammlungen wurden bereits 2002 mit der Erstbeschreibung von Pseudobankesia aphroditae Weidlich & Henderickx, 2002 veröffentlicht. Auf morphologische und genetische (MtDNA) Details sowie auf die Verbreitung von Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810) wird näher eingegangen und das Taxon P. villosella quadratica De Frejna, 1983 wird diskutiert. Weitere Angaben zur Biologie und Ökologie der Psychiden der Republik Zypern vervollständigen die Arbeit. Key words Republic of Cyprus, faunistic review, Eumasia cyprianella spec. nov., Psychidae, Lepidoptera, biology, morphology, history Summary In the present paper the knowledge of the bagworm moth of the Republic of Cyprus is discussed. Currently 6 species of this family are known from Cyprus. Also a new species Eumasia cyprianella spec. nov. is described herein. The author visited the island in the years 1998, 1999, 2012 and 2014. First results of the collecting trips were published in 2002, including the first description of Pseudobankesia aphroditae Weidlich & Henderickx, 2002. Morphological and cytochemical (mtDNA) characteristics are addressed and the distribution of Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1910) is discussed. The taxon P. -
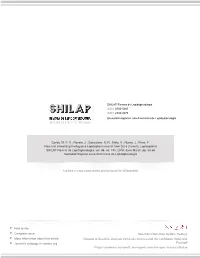
How to Cite Complete Issue More Information About This Article
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 ISSN: 2340-4078 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Corley, M. F. V.; Rosete, J.; Gonçalves, A. R.; Mata, V.; Nunes, J.; Pires, P. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2016 (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 46, no. 181, 2018, June-March, pp. 33-56 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45560385004 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 46 (181) marzo 2018: 33-56 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2016 (Insecta: Lepidoptera) M. F. V. Corley, J. Rosete, A. R. Gonçalves, V. Mata, J. Nunes & P. Pires Abstract 32 species are added to the Portuguese Lepidoptera fauna, mainly as a result of fieldwork undertaken by the authors and others in 2016. In addition, second and third records for the country, new province records and new food-plant data for a number of species are included. A summary of recent papers affecting the Portuguese fauna is included. KEY WORDS: Insecta, Lepidoptera, distribution, Portugal. Novos e interessantes registos portugueses de Lepidoptera em 2016 (Insecta: Lepidoptera) Resumo Como resultado do trabalho de campo desenvolvido pelos autores e outros, principalmente no ano de 2016, são adicionadas 32 espécies de Lepidoptera à fauna de Portugal. Adicionalmente, são apresentados segundos e terceiros registos de espécies previamente conhecidas, bem como novas plantas alimentícias para algumas espécies. -
Thomas Sobczyk: Transfer of Pygmaeotinea Crisostomella Amsel, 1957
Nota Lepi. 38(2) 2015: 127–131 | DOI 10.3897/nl.38.5090 Transfer of Pygmaeotinea crisostomella Amsel, 1957 from Tineidae to Psychidae and its taxonomic status (Lepidoptera) Thomas Sobczyk1 1 Diesterwegstraße 28, D–02977 Hoyerswerda, Germany, email: [email protected] http://zoobank.org/9E0B96CC-B486-4B01-849D-D560DF146DFE Received 14 April 2015; accepted 13 July 2015; published: 7 August 2015 Subject Editor: Jadranka Rota. Abstract. Pygmaeotinea Amsel, 1957, syn. n. is transferred from Tineidae to Psychidae and regarded as congeneric with Eumasia Chrétien, 1904. The type species of Pygmaeotinea is combined with Eumasia as Eumasia crisostomella Amsel, 1957, comb. n. Adult male and female of this species are redescribed and illus- trated for the first time. Eumasia crisostomella Amsel, 1957 is only known from the type locality in Portugal at Singeverga and one of three Eumasia species from Iberian Peninsula. Zusammenfassung. Pygmaeotinea Amsel, 1957, syn. n. wird von den Tineidae zu den Psychidae transferriert und ist congenerisch mit Eumasia Chrétien, 1904. Die Typusart von Pygmaeotinea wird mit Eumasia als Eumasia crisostomella Amsel, 1957, comb. n. kombiniert. Adulte Männchen und Weibchen dieser Art werden erstmals abgebildet und die Beschreibung durch weitere Merkmale ergänzt. Eumasia crisostomella Amsel, 1957 ist nur von der Typenlokalität bekannt und eine von drei Eumasia-Arten der Iberischen Halbinsel. Introduction The monotypic Pygmaeotinea Amsel, 1957 was described within Tineidae. Its type-species, P. crisostomella Amsel, 1957 is only known from the type specimens and no further specimens have been reported thus far. Amsel (1957) noted that the relationship of Pygmaeotinea crisostomella to other Tineidae is unknown. Karsholt and Razowski (1996) placed the genera Eumasia and Pygmaeotinea together with Apterona Millière, 1857 within Apteronini (Psychidae, Oiketicinae).