Gesetzentwurf 18-5376
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 239. Sitzung des Deutschen Bundestages am Dienstag, 7. September 2021 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 - AufbhG 2021) in der Ausschussfassung hier: Artikel 12 (Änderung des Infektionsschutzgesetzes) Artikel 13 (Einschränkung von Grundrechten) Drs. 19/32039 und 19/32275 Abgegebene Stimmen insgesamt: 625 Nicht abgegebene Stimmen: 84 Ja-Stimmen: 344 Nein-Stimmen: 280 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 07.09.2021 Beginn: 14:35 Ende: 15:05 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. -

Jan Van Aken Stephan Albani Katrin Albsteiger Peter Altmaier Luise Amtsberg Kerstin Andreae Niels Annen Ingrid Arndt-Brauer Rain
Hans-Joachim Zimmer Hofäckerstraße 36 71364 Winnenden 07195/138575 07195/138574 E-Mail [email protected] H.-J. Zimmer, Hofäckerstraße 36, 71364 Winnenden Einschreiben mit Rückschein Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7 10557 Berlin 31. Mai 2017 In der Rechtssache Hans-Joachim Zimmer - Kläger - Hofäckerstraße 36 71364 Winnenden gegen Bundesrepublik Deutschland - Beklagte - Deutscher Bundestag Gemeinschaftlich vertreten durch die Abgeordneten Jan van Aken Stephan Albani Katrin Albsteiger Peter Altmaier Luise Amtsberg Kerstin Andreae Niels Annen Ingrid Arndt-Brauer Rainer Arnold Artur Auernhammer Heike Baehrens Annalena Baerbock Ulrike Bahr Bettina Bähr-Losse Dorothee Bär 2 Heinz-Joachim Barchmann Thomas Bareiß Katarina Barley Doris Barnett Klaus Barthel Norbert Barthle Matthias Bartke Sören Bartol Dietmar Bartsch Bärbel Bas Günter Baumann Marieluise Beck Volker Beck Uwe Beckmeyer Maik Beermann Herbert Behrens Manfred Behrens Veronika Bellmann Sybille Benning André Berghegger Christoph Bergner Ute Bertram Peter Beyer Steffen Bilger Karin Binder Lothar Binding Clemens Binninger Matthias Birkwald Peter Bleser Burkhard Blienert Heidrun Bluhm Maria Böhmer Wolfgang Bosbach Norbert Brackmann Klaus Brähmig Michael Brand Reinhard Brandl Helmut Brandt Franziska Brantner Willi Brase Ralf Brauksiepe Helge Braun 3 Heike Brehmer Ralph Brinkhaus Agnieszka Brugger Karl-Heinz Brunner Christine Buchholz Eva Bulling-Schröter Edelgard Bulmahn Marco Bülow Martin Burkert Cajus Julius Caesar Lars Castellucci Roland Claus Gitta Connemann Jürgen Coße Petra Crone -

16. Bundesversammlung Der Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12
16. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12. Februar 2017 Gemeinsame Sitzung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates anlässlich der Eidesleistung des Bundespräsidenten Berlin, 22. März 2017 Inhalt 4 16. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland 6 Rede des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert 16 Konstituierung der 16. Bundesversammlung 28 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 34 Rede von Dr. Frank-Walter Steinmeier 40 Gemeinsame Sitzung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates anlässlich der Eidesleistung des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier 42 Programm 44 Begrüßung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert 48 Ansprache der Präsidentin des Bundesrates, Malu Dreyer 54 Ansprache des Bundespräsidenten a. D., Joachim Gauck 62 Eidesleistung des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier 64 Ansprache des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier 16. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12. Februar 2017 Nehmen Sie bitte Platz. Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Exzellenzen! Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie alle, die Mitglieder und Gäste, herzlich zur 16. Bundesversammlung im Reichstagsgebäude in Berlin, dem Sitz des Deutschen Bundestages. Ich freue mich über die Anwesenheit unseres früheren Bundesprä- sidenten Christian Wulff und des langjährigen österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Seien Sie uns herzlich willkommen! Beifall Meine Damen und Herren, der 12. Februar ist in der Demokratiegeschichte unseres Landes kein auffälliger, aber eben auch kein beliebiger Tag. Heute vor genau 150 Jahren, am 12. Februar 1867, wurde ein Reichstag gewählt, nach einem in Deutschland nördlich der Mainlinie damals in jeder Hinsicht revolu- tionären, nämlich dem allgemeinen, gleichen Rede des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert 6 und direkten Wahlrecht. Der Urnengang zum konstituierenden Reichstag des Norddeut- schen Bundes stützte sich auf Vorarbeiten der bekannte. -

Plenarprotokoll 19/229
Plenarprotokoll 19/229 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 229. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. Mai 2021 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Stefan Keuter (AfD) . 29247 C nung . 29225 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 C Absetzung der Tagesordnungspunkte 8, 9, 10, Stefan Keuter (AfD) . 29247 D 16 b, 16 e, 21 b, 33, 36 und 39 . 29230 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 D Ausschussüberweisungen . 29230 D Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 A Feststellung der Tagesordnung . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 B Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 C Zusatzpunkt 1: Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 C Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktio- Christian Dürr (FDP) . 29248 D nen der CDU/CSU und SPD zu den Raketen- angriffen auf Israel und der damit verbun- Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 A denen Eskalation der Gewalt Christian Dürr (FDP) . 29249 B Heiko Maas, Bundesminister AA . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 C Armin-Paulus Hampel (AfD) . 29233 C Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) . 29250 A Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU) . 29234 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 A Alexander Graf Lambsdorff (FDP) . 29235 C Dorothee Martin (SPD) . 29250 B Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 29236 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 B Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/ Dorothee Martin (SPD) . 29250 C DIE GRÜNEN) . 29237 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 D Dirk Wiese (SPD) . 29238 C Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 29250 D Dr. Anton Friesen (AfD) . 29239 D Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29251 A Jürgen Hardt (CDU/CSU) . 29240 B Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) . 29251 C Kerstin Griese (SPD) . -

Mitteilung Tagesordnung
18. Wahlperiode Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Mitteilung Berlin, den 26. Juni 2014 Die 11. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sekretariat Forschung und Technikfolgenabschätzung Telefon: +49 30 227-32861 Fax: +49 30 227-36845 findet statt am Mittwoch, dem 2. Juli 2014, Sitzungssaal 9:30 – ca. 13:00 Uhr Telefon: +49 30 227-30298 Paul-Löbe-Haus - Sitzungssaal 4.300 Fax: +49 30 227-36298 Tagesordnung Tagesordnungspunkt 1 Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Martin Stratmann, Berichterstatter/in: Präsident der Max-Planck-Gesellschaft München Abg. Dr. Wolfgang Stefinger [CDU/CSU] Abg. Dr. Ernst Dieter Rossmann [SPD] Selbstbefassung 18(18)SB-16 Abg. Dr. Rosemarie Hein [DIE LINKE.] Abg. Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] Tagesordnungspunkt 2 Berufliche Bildung a) Unterrichtung durch die Bundesregierung Federführend: Ausschuss für Bildung, Forschung und Berufsbildungsbericht 2014 Technikfolgenabschätzung BT-Drucksache 18/1180 Mitberatend: Ausschuss für Wirtschaft und Energie Ausschuss für Arbeit und Soziales Verteidigungsausschuss Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Ausschuss für Gesundheit Ausschuss für Tourismus Haushaltsausschuss Berichterstatter/in: Abg. Dr. Thomas Feist [CDU/CSU] Abg. Willi Brase [SPD] Abg. Dr. Rosemarie Hein [DIE LINKE.] Abg. Beate Walter-Rosenheimer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] Voten angefordert für den: 02.07.2014 18. Wahlperiode Seite 1 von 7 Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung b) Unterrichtung durch die Bundesregierung Federführend: Ausschuss für Bildung, Forschung und Berufsbildungsbericht 2013 Technikfolgenabschätzung BT-Drucksache 17/13650 Mitberatend: Ausschuss für Arbeit und Soziales Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - abschließende Beratung - Ausschuss für Tourismus Haushaltsausschuss Berichterstatter/in: Abg. Dr. Thomas Feist [CDU/CSU] Abg. Willi Brase [SPD] Abg. Dr. Rosemarie Hein [DIE LINKE.] Abg. -

40 Politiker Fordern Erhalt Des SWR- Sinfonieorchesters
ERKLÄRUNG 40 Politiker fordern Erhalt des SWR- Sinfonieorchesters Neue Unterstützung für das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg: 40 Bundestags- und Landtagsabgeordnete aus ganz Baden fordern in einer Erklärung seinen Erhalt. Das SWR-Sinfonieorchester in Freiburg Foto: Ingo Schneider "Das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg erhalten! Kulturverlust für Baden vermeiden!" Das sind die Kernforderungen der Erklärung einer "parteienübergreifenden Initiativgruppe zum Erhalt des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg". Beide Postulate für sich sind bekannt. Neu ist indes die in dieser Form bislang noch nicht geäußerte konzertierte Kraft dahinter: 40 Bundestags- und Landtagsabgeordnete haben das Papier unterzeichnet. DIE UNTERZEICHNER Nachdem die vom Südwestrundfunk 2012 beschlossene Fusion seiner beiden in Baden- Württemberg ansässigen Klangkörper – Radiosinfonieorchester Stuttgart (RSO) und SWR- Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg (SO) – ab Herbst 2016 mit Sitz in Stuttgart bislang von politischer Seite mit Verweis auf einen senderinternen Vorgang weitgehend ignoriert worden war, formiert sich dort nun Widerstand. Motor der Erklärung ist eine Initiativgruppe, die die Bundestagsabgeordneten Kerstin Andrae (Grüne), Gernot Erler (SPD) und Matern von Marschall (CDU) sowie die Landtagsabgeordneten Christoph Bayer (SPD), Bärbl Mielich (Grüne), Patrick Rapp (CDU) und Gabi Rolland (SPD) gebildet haben. Auch die übrigen Unterzeichner kommen aus badischen Wahlkreisen, von Waldshut bis zum Tauber-Odenwald-Kreis: ein -

Resolution "Starke Duale Ausbildung
Resolution: "Starke duale Ausbildung. Starkes Europa." Präambel: Das europäische Miteinander zu erhalten und zu fördern ist einer der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Europa muss sich dabei auf seine Stärken besinnen; seine Vielfalt, seine Geschichte, seine Regionen; und vor allem auf einen starken Mittelstand als zentrale Stütze für sozialen Frieden in der Gesellschaft. Im Dialog der EU-Mitgliedsländer muss es daher vermehrt darum gehen, das gemeinsame Europa von morgen zu gestalten - für Wachstum und zum Wohle aller. Resolution: Das deutsche Handwerk mit seinem dualen Berufsausbildungssystem garantiert eine hohe Ausbildungsleistung und steht für nachhaltiges Unternehmertum. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen in Europa und die jüngst durch die EU-Kommission geforderte Evaluierung am qualifikationsgebundenen Berufszugang appellieren die Unterzeichner an die europäischen Institutionen: 1. Der weitere Auf- und Ausbau des dualen Ausbildungs- und Qualifizierungsmodells und der zugrundeliegenden Strukturen im In- und Ausland muss nachdrücklich gefördert werden. 2. Die Vorteile und Stärken des qualifikationsgebundenen Berufszugangs und der zwingende Zusammenhang zwischen dualer Ausbildung und Meisterpflicht müssen endgültig anerkannt werden, um sich einer fatalen Dequalifizierung selbstbewusst entgegenzustellen. Begründung: Die Meisterqualifikation ist Garant für eine qualitativ und quantitativ hohe Ausbildungsleistung. Sie gewährleistet die Ausbildungsfähigkeit des Handwerks. Das zeigen die Entwicklungen in Folge der Novellierung der Handwerksordnung von 2004. Nur noch fünf Prozent der Auszubildenden im Handwerk findet man in den von der Meisterpflicht ausgenommenen Gewerken der Anlage B. Berufsqualifikation und Reglementierung gehen insoweit Hand in Hand. In modernen Wissensgesellschaften bedarf es einer Stärkung von Strukturen, die als Best Practise in der EU anzusehen sind und im Hinblick auf die Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. -

Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0
Deutscher Bundestag 89. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Februar 2015 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Antrag des Bundesministeriums der Finanzen Finanzhilfen zugunsten Griechenlands; Verlängerung der Stabilitätshilfe Einholung eines zustimmenden Beschlusses des Deutschen Bundestages nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nummer 2 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes auf Verlängerung der bestehenden Finanzhilfefazilität zugunsten der Hellenischen Republik Drs. 18/4079 und 18/4093 Abgegebene Stimmen insgesamt: 586 Nicht abgegebene Stimmen: 45 Ja-Stimmen: 541 Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0 Berlin, den 27.02.2015 Beginn: 11:05 Ende: 11:10 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -
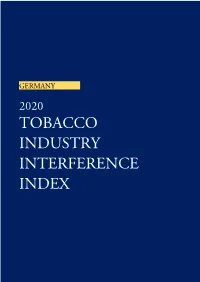
TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE INDEX September 2020
GERMANY 2020 TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE INDEX September 2020 Acknow e!"ements $%# report w&# written by L&)ra Graen. $e a)thor wo) ! l%ke to th&nk Katrin Sch& er and Ute Mons o- t+e Germ&n C&ncer Re#e&rch Center (DKF/0, Jo+&nne# Spatz o- Forum Smoke4Free, J&n Sch) 3 and Sonj& von Eichborn o- Unf&irtobacco1 M&rtina Pötsc+ke4(&nger o- the Germ&n Smoke-ree A %&nce (ABNR0 a# we a# Timo L&nge o- LobbyContro w+o pro6%!e! input and fee!back. $e a)thor wo) ! a #o like to e9pre## sincere gratitu!e to M&ry A##)nta o- t+e G oba Center for Goo! Go6ernance in Tobacco Contro (GGTC0 for her technica a!vice* $%# report i# f)nde! by B oomberg Ph% &nthropie# t+ro)"+ Stoppin" Tobacco Org&niz&tions &nd Pro!)cts (STO70* Endorse! by Germ&n Me!ica Action Gro)p Smoking or He& th (;ARG0, Germ&n NCD A %&nce (DANK), Germ&n Re#piratory Societ' (DG70, Germ&n C&ncer Re#e&rch Center (DKF/01 FACT e*<. – >omen A"&inst Tobacco1 Frie!en#band1 Institute for Therapy and He& th Re#e&rch (IFT Nord01 Center for A!!iction Prevention Ber in, R&)ch-rei Pl)# – He& th f&cilitie# for co)nse ing and tobacco ce##&tion, Unf&irtobacco1 V%6&nte# Ho#pita Ne)kö n 2 Table o- Content# B&ckgro)nd and Intro!)ction*****************************************************************************************************? Tobacco and H)m&n r%"+t#*****************************************************************************************************? (&ck o- Tobacco Contro Me&#)re# in Germ&ny D)e to Ind)#tr' Interference************************? Tobacco Ind)#tr' in Germ&ny*************************************************************************************************@ -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 171. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 13.Mai 2016 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko und der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten Drs. 18/8039 und 18/8311 Abgegebene Stimmen insgesamt: 572 Nicht abgegebene Stimmen: 58 Ja-Stimmen: 424 Nein-Stimmen: 145 Enthaltungen: 3 Ungültige: 0 Berlin, den 13.05.2016 Beginn: 10:05 Ende: 10:08 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Iris Eberl X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Klaus-Peter Flosbach X Seite: 3 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. -
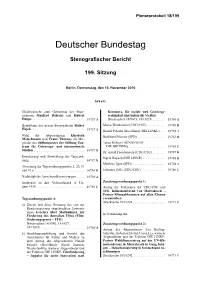
Plenarprotokoll 18/199
Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Gesamt 3. Namabst. 08.07
Seite: 1 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Ilse Aigner X Peter Altmaier X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Ernst-Reinhard Beck (Reutlingen) X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Dr. Christoph Bergner X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Börnsen (Bönstrup) X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexander Dobrindt X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Hartwig Fischer (Göttingen) X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Klaus-Peter Flosbach X Herbert Frankenhauser X Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) X Michael Frieser X Erich G. Fritz X Dr. Michael Fuchs X Hans-Joachim Fuchtel X Alexander Funk X Ingo Gädechens X Dr. Peter Gauweiler X Dr. Thomas Gebhart X Norbert Geis X Alois Gerig X Eberhard Gienger X Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Michael Glos X Josef Göppel X Peter Götz X Dr. Wolfgang Götzer X Ute Granold X Reinhard Grindel X Hermann Gröhe X Michael Grosse-Brömer X Markus Grübel X Manfred Grund X Monika Grütters X Olav Gutting X Florian Hahn X Dr. Stephan Harbarth X Jürgen Hardt X Gerda Hasselfeldt X Dr. Matthias Heider X Helmut Heiderich X Mechthild Heil X Ursula Heinen-Esser X Frank Heinrich X Rudolf Henke X Michael Hennrich X Jürgen Herrmann X Ansgar Heveling X Ernst Hinsken X Peter Hintze X Christian Hirte X Robert Hochbaum X Karl Holmeier X Franz-Josef Holzenkamp X Joachim Hörster X Anette Hübinger X Thomas Jarzombek X Dieter Jasper X Dr.