Jelinek-Handbuch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
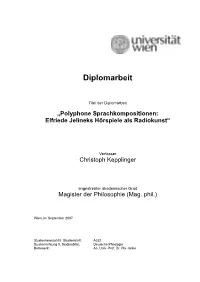
Diplomarbeit
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Polyphone Sprachkompositionen: Elfriede Jelineks Hörspiele als Radiokunst“ Verfasser Christoph Kepplinger angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im September 2007 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A332 Studienrichtung lt. Studienblatt: Deutsche Philologie Betreuerin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Pia Janke Inhalt 1. EINLEITUNG..............................................................................................................................................2 2. DIE REALISIERUNG DER TEXTE ALS HÖRSPIEL...........................................................................5 2.1. VON DEN FRÜHEN HÖRSPIELEN ZU DEN THEATERTEXT-BEARBEITUNGEN .........................................5 2.2. PERFORMANCE, POP UND MULTIMEDIA ...............................................................................................9 2.3. DER MEDIALE WANDEL UND DIE RE-POSITIONIERUNG DER AUTORIN..............................................12 3. PARTITUREN FÜR DEN RUNDFUNK .................................................................................................20 3.1. SCHREIB- UND BEARBEITUNGSVERFAHREN FÜR HÖRBARE TEXTE ...................................................20 3.2. VON DER GESCHRIEBENEN ZUR KLINGENDEN SPRACHE....................................................................24 3.3. DAS SCHWEIGEN – VOX FEMINARUM...................................................................................................31 3.4. POLYPHONE STIMMEN-KOMPOSITION ...............................................................................................33 -

Werke HP 12.12
DIE WELTWEITEN ÜBERSETZUNGEN VON ELFRIEDE JELINEKS WERKEN SAMT AUFFÜHRUNGSDOKUMENTATION (Stand: Dezember 2012) Verzeichnet sind nicht nur alle Übersetzungen, die durch Publikation oder Aufführungen öffentlich gemacht wurden, sondern auch unveröffentlichte Übersetzungen von Theatertexten. Aufführungen, szenische Lesungen und Hörspielbearbeitungen sind mittels Pfeilsymbol ( ) den jeweiligen Übersetzungen zugeordnet. Datum, Ort der Aufführung bzw. Lesung und RegisseurIn werden angeführt, bei Hörspielen auch Produzent und Sender. Geordnet ist die Dokumentation nach Gattungen, innerhalb dieser Gliederung nach dem Erscheinungsdatum der Originaltexte. Die Übersetzungen der einzelnen Texte sind alpha- betisch nach der Zielsprache gegliedert. Gibt es mehrere Übersetzungen eines Werkes in dieselbe Sprache, folgen diese Übersetzungen chronologisch aufeinander. Neuauflagen bzw. verschiedene Veröffentlichungen derselben Übersetzung – beispielsweise in Form einer Taschenbuchausgabe – sind ebenfalls chronologisch angeordnet. Abkürzungen Hg. HerausgeberIn DN Doppelnennung I Inszenierung LA Lizenzausgabe Ü ÜbersetzerIn SAMMELBÄNDE BULGARISCH Drami . (Dramen ). Ü: Vladko Murdarov. Sofia: Riva Verlag 2005. DN darin: Patekata. S. 7-12. (= Immer hinauf auf den Steg. Wie der Mensch auf die Bühne kommt ) Spjashtata krasavitsa. S. 13-26. (= Dornröschen ) 17.9.2007 Mladezhki teatar, Sofia, I: Veselin Dimov (gemeinsam mit Snez- hanka (= Schneewittchen ), Titel: Smartta i Momicheto (= Der Tod und das Mädchen ) Rosamunde . S. 27-46. (= Rosamunde ) Klara Sh . S. 47-118. (= Clara S.) 8.9.2005 Festival Apollonien, Sozopol, I: Dessislava Shpatova Malchanieto. S. 119-130. (= Das Schweigen ) Dzhaki. S. 131-166. (= Jackie ) Klaudia. Tjalo i zhena. S. 167-174. (= Claudia. Körper und Frau ) Vstrani. (Im Abseits). Ü: Vladko Murdarov. Sofia: Riva Verlag 2008. DN darin: Vstrani. Nobelova lekcija. S. 7-28. (= Im Abseits ) Kakvo se sluchi, sled kato Nora napusna mazha si, ili Oporite na obshtestvoto. -
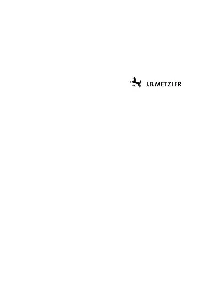
Jelinek- Handbuch
Pia Janke (Hrsg.) Jelinek- unter Mitarbeit von Christian Schenkermayr und Agnes Zenker Handbuch Verlag J. B. Metzler Stuttgart · Weimar Forschungsplattform Elfriede Jelinek | Universität Wien | Institut für Germanistik Bibliografische Information der Deutschen National bibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-476-02367-4 ISBN 978-3-476-05270-4 (eBook) DOI 10.1007/978-3-476-05270-4 Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. © 2013 Springer-Verlag GmbH Deutschland Ursprünglich erschienen bei J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 2013 www.metzlerverlag.de [email protected] V Inhalt Einleitung . VII Die Ausgesperrten (Dagmar C. G. Lorenz) . 89 Hinweise für die Benutzung . X Die Klavierspielerin Siglenverzeichnis . XI (Alexandra Tacke) . 95 Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr; Lust; Gier I. Leben und Öffentlichkeit . 1 (Rita Svandrlik) . 102 Die Kinder der Toten Biographische Aspekte und (Sabine Treude) . 113 künstlerische Kontexte Neid (Uta Degner) . 2 (Daniela Strigl). 119 Politisches und feministisches Kurzprosa Engagement (Fatima Naqvi). 125 (Pia Janke, Stefanie Kaplan) . 9 Theatertexte. 131 Selbstpräsentation Was geschah, nachdem Nora ihren Mann (Peter Clar) . 21 verlassen hatte oder Stützen der Gesell - Publikationsformen und schaften; Clara S.; Krankheit oder Werküberlieferung Moderne Frauen (Pia Janke, Teresa Kovacs). 27 (Dagmar von Hoff). 131 Burgtheater; Erlkönigin; Präsident Abend- II. Schreibverfahren . 35 wind; Ich liebe Österreich; Das Lebewohl (Evelyn Deutsch-Schreiner) . -

Jelinek-Rechnitz-Ha1.Pdf
Universität Wien Institut für Germanistik Wintersemester 2016/2017 SE-B NdL: Theater und Politik: Elfriede Jelinek Dozentin: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Pia Janke Das gleichzeitige Ungleichzeitige. Verfahren der Geschichtsdekonstruktion in Elfriede Jelineks Botenbericht Rechnitz (Der Würgeengel) Karolin Baumann Matrikelnummer: 1602375 Friedensstraße 35, 48145 Münster E-Mail: [email protected] Kulturpoetik der Literatur und Medien (MA), 3. Fachsemester Inhalt 1 Einleitung ............................................................................................................................ 1 2 Überlegungen zum (post)dramatischen Zeitkontinuum ...................................................... 3 2.1 Einheit der Zeit im antiken Botenbericht ......................................................................... 4 2.2 Zeitbegriff eines Dazwischen bei Jelinek ......................................................................... 7 3 Stimmen aus dem Heute und Damals. Konzeption und Motive der Botenrede ................. 9 3.1 Unbeteiligte Beteiligte. Boten zwischen Vergangenheit und Gegenwart ...................... 11 3.2 Der Engel als Verkehrung der Transzendenz ................................................................. 16 3.3 Der Ausnahmebote – Auftraggeberin Jelinek? .............................................................. 19 3.4 Stummer Chor der Opfer. T. S. Eliots The Hollow Men ................................................ 22 3.5 Nach Gräbern graben. Geschichte als Leerstelle .......................................................... -

Annuß Elfriede Jelinek – Theater Des Nachlebens
Annuß Elfriede Jelinek – Theater des Nachlebens Evelyn Annuß Elfriede Jelinek – Theater des Nachlebens Wilhelm Fink Verlag Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein Umschlagabbildung: „Ein Fest für Elfriede Jelinek“, Burgtheater, 10. Dezember 2004 anlässlich der Nobelpreisverleihung (Ausschnitt) Copyright: Rheinhard Werner, Wien Covergestaltung: Oliver Brentzel (dotcombinat, Berlin) und Evelyn Annuß Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem und alterungsbeständigem Papier ࠗ∞ ISO 9706 Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 URG ausdrücklich gestatten. © 2005 Wilhelm Fink Verlag, München (Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) www.fink.de Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn ISBN 3-7705-4207-X INHALT EINLEITUNG ................................................................................. -

Jelinek in Chinese: a Controversial Austrian Nobel Laureate in the Chinese Book Market
1 Jelinek in Chinese: a Controversial Austrian Nobel Laureate in the Chinese Book Market Arnhilt Johanna Hoefle Abstract The awarding of the world‟s best known literature prize to the controversial Austrian writer El- friede Jelinek in 2004 triggered off worldwide hype in its reception. So far, Jelinek‟s works have been translated into more than 40 languages. Chinese is one of them. Although the author‟s first works had already been translated back in the 1990s, on the Chinese mainland all translations of her works were actually published only after the key event of the Nobel Prize. They immediately received immense attention from the Chinese public and unleashed what could even be termed a „Jelinek fever‟. This paper is devoted to shedding light on the first introduction and the unexpected success of this controversial Austrian Nobel laureate in the Chinese book market. It will give an overview of the Chinese translations of Jelinek‟s works and will try to reveal some of the dynamics that led to their actual selection, translation, publication, marketing and status as bestsellers. The challenges of the rapidly transforming Chinese publishing industry and the impact of these chal- lenges on the reception of foreign literature will be discussed. Furthermore, the paper will outline the crucial role of the intermediaries, especially of the powerful literary agency involved, in this process of cultural transfer. Keywords: Chinese book market, Elfriede Jelinek, literary translation, Nobel Prize Hoefle, Arnhilt Johanna. “Jelinek in Chinese: a Controversial Austrian Nobel Laureate in the Chinese Book Market.” In Vienna Graduate Journal of East Asian Studies, Volume 2, eds. -

3. Wer Ist Elfriede Jelinek
1. ZUR EINFÜHRUNG..................................................................................................3 2. DER FORSCHUNGSSTAND..................................................................................11 3. WER IST ELFRIEDE JELINEK ...........................................................................16 3.1 HERKUNFT ..................................................................................................................16 3.2 JELINEKS ELTERN .......................................................................................................17 3.3 LEBENSLAUF ...............................................................................................................19 4. DIE ANALYSE DER THEATERTEXTE..............................................................25 4.1 DIE FRAU ALS WARE , BEGEHR - UND GEBÄRMASCHINE ..............................................25 4.1.1 Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften..............................................................................................................25 4.1.2 Clara S. Musikalische Tragödie .........................................................................31 4.1.3 Krankheit oder Moderne Frauen........................................................................37 4.2 „S INN EGAL . KÖRPER ZWECKLOS “ ..............................................................................44 4.2.1 Wolken.Heim.......................................................................................................46