Waldzustandsbericht 2011 Der Wald Im Fokus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
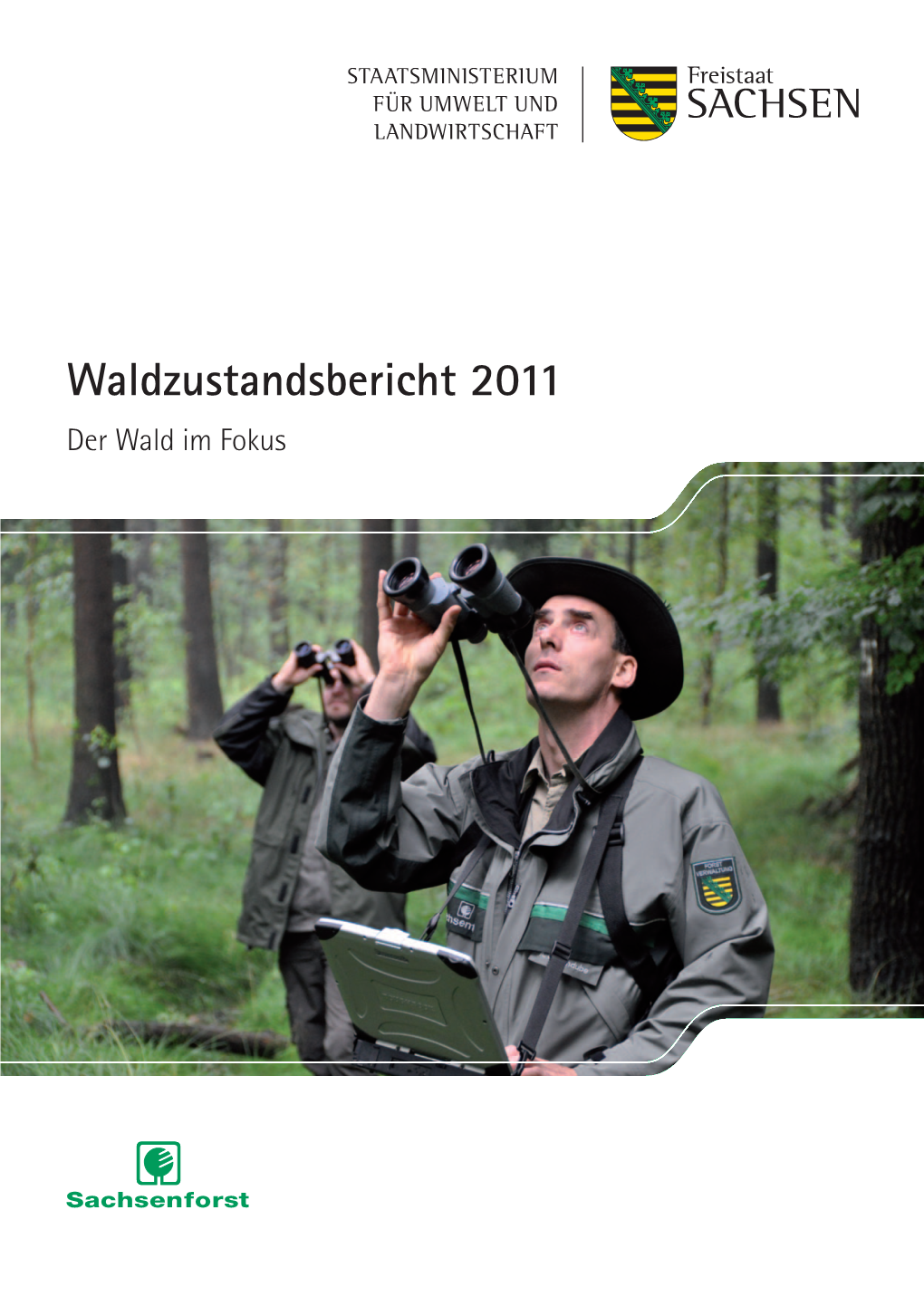
Load more
Recommended publications
-

XVIII. KONFERENCE České Limnologické Společnosti a Slovenskej Limnologickej Spoločnosti
XVIII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 25. – 29. června 2018, Kořenov Veronika Sacherová (ed.) Organizační výbor RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. – předsedkyně doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. Tadeáš Rulík RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. Vědecký výbor RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. – předsedkyně Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. RNDr. Petr Pařil, Ph.D. doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. Sponzoři XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti byla podpořena následujícími institucemi: CHKO Jizerské hory Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Vydala Česká limnologická společnost 2018 Tisk: http://www.tiskdo1000.cz/ 2 Milé kolegyně, kolegové, účastníci 18. konference ČLS a SLS, mám tu čest, že jako předseda výboru ČLS vás mohu v tomto úvodníku podruhé za sebou přivítat na společné konferenci ČLS a SLS a popřát vám příjemný pobyt v Jizerských horách. Je velmi potěšující, že ani po padesáti letech, které uplynuly od založení Limnospolu, se nám neomrzelo se pravidelně v tříletých intervalech scházet společně se slovenskými kolegy a sdělovat si, co se za tu dobu v našich společnostech událo, co kdo vybádal a publikoval. Co mne ale těší nejvíce, jsou desítky nových tváří, nových jmen účastníků, které naznačují, že česko-slovenská limnologie z pohledu populační dynamiky nevymírá, ale naopak se jedná o mladou, rostoucí populaci. A to je dobře. Za těch uplynulých 50 let, kterými si Limnospol úspěšně prošel, se můžeme pochlubit celou řadou úspěchů na poli základního výzkumu i užití limnologických poznatků v praxi, ale bez nové krve a elánu mladších kolegyň a kolegů to dále nepůjde. -
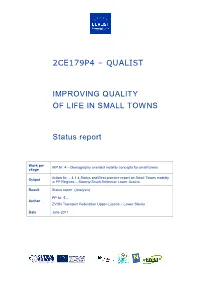
2Ce179p4 – Qualist Improving Quality of Life in Small
2CE179P4 – QUALIST IMPROVING QUALITY OF LIFE IN SMALL TOWNS Status report Work pa- WP Nr. 4 – Demography oriented mobility concepts for small towns ckage Action Nr. – 4.1.4 Status and Best practice report on Small Towns mobility Output in PP Regions – Saxony/South Bohemia/ Lower Austria Result Status report (Analysis) PP Nr. 5 – Author ZVON Transport Federation Upper-Lusatia – Lower Silesia Date June 2011 Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Preliminary remarks This “Small Towns Mobility Status Report in the PP-regions” grew out of two sub-reports: - Small towns mobility status Report (data collection, analysis of regional small towns mobility status reports, development of report for all RR regions incl. Best best practices) Responsible: Saxony Ministry of Economic Affairs, Labour and Transport - Mobility Report (Status and Best practice report on Small towns in the PP regions) Responsible: Transport Federation Upper-Lusatia – Lower- Silesia (ZVON) The editorial process was carried out by the consulting engineers - LUB Consulting GmbH, Dresden - ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden 2CE179P4 - QUALIST Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Index 1 Introduction................................................................................ 1 2 Brief description of study area.................................................... 2 2.1 Saxon Vogtland .................................................................. -

SCHLOESSERLAND SACHSEN. Fireplace Restaurant with Gourmet Kitchen 01326 Dresden OLD SPLENDOR in NEW GLORY
Savor with all your senses Our family-led four star hotel offers culinary richness and attractive arrangements for your discovery tour along Sa- xony’s Wine Route. Only a few minutes walking distance away from the hotel you can find the vineyard of Saxon master vintner Klaus Zimmerling – his expertise and our GLORY. NEW IN SPLENDOR OLD SACHSEN. SCHLOESSERLAND cuisine merge in one of Saxony’s most beautiful castle Dresden-Pillnitz Castle Hotel complexes into a unique experience. Schloss Hotel Dresden-Pillnitz August-Böckstiegel-Straße 10 SCHLOESSERLAND SACHSEN. Fireplace restaurant with gourmet kitchen 01326 Dresden OLD SPLENDOR IN NEW GLORY. Bistro with regional specialties Phone +49(0)351 2614-0 Hotel-owned confectioner’s shop [email protected] Bus service – Elbe River Steamboat jetty www.schlosshotel-pillnitz.de Old Splendor in New Glory. Herzberg Żary Saxony-Anhalt Finsterwalde Hartenfels Castle Spremberg Fascination Semperoper Delitzsch Torgau Brandenburg Senftenberg Baroque Castle Delitzsch 87 2 Halle 184 Elsterwerda A 9 115 CHRISTIAN THIELEMANN (Saale) 182 156 96 Poland 6 PRINCIPAL CONDUCTOR OF STAATSKAPELLE DRESDEN 107 Saxony 97 101 A13 6 Riesa 87 Leipzig 2 A38 A14 Moritzburg Castle, Moritzburg Little Buch A 4 Pheasant Castle Rammenau Görlitz A72 Monastery Meissen Baroque Castle Bautzen Ortenburg Colditz Albrechtsburg Castle Castle Castle Mildenstein Radebeul 6 6 Castle Meissen Radeberg 98 Naumburg 101 175 Döbeln Wackerbarth Dresden Castle (Saale) 95 178 Altzella Monastery Park A 4 Stolpen Gnandstein Nossen Castle -

B-Solutions FINAL REPORT by the EXPERT
Managed by the Association of European Border Regions by an Action Grant (CCI2017CE160AT082) agreed with the Directorate General of Regional and Urban Policy, European Commission. Financed by the European Union. b-solutions FINAL REPORT BY THE EXPERT Advice Case: Cross-border healthcare Advised Entity: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, regional association, CZ-DE-PL Expert: Hynek Böhm Table of content: I. Description of the Obstacle II. Indication of the Legal/Administrative Dispositions causing the Obstacle III. Description of a Possible Solution IV. Pre-Assessment of whether the Case could be solved with the ECBM V. Other Relevant Aspects to this Case VI. References and Appendix/Appendices if any Managed by the Association of European Border Regions by an Action Grant (CCI2017CE160AT082) agreed with the Directorate General of Regional and Urban Policy, European Commission. Financed by the European Union. Conetxt The Šluknov tip (further also ´Šluknov area´) is the most northern edge of the Czech Republic which, is separated from the rest of the Czech Republic by mountains (Lusatian mountains and Labské pískovce). It is surrounded by Germany from 3 sides. In this area, covering 50,000 inhabitants, there is only one general hospital which currently faces insolvency and a very real threat of a shut down. Another hospital in Varnsdorf focuses on the healthcare provision for the long-term patients and the outpatient care. Accessibility of other Czech hospitals (Děčín, Česká Lípa, Liberec) from most of the municipalities of the Šluknov area is at the border of the legislative limit of 50 minutes when the weather is good. In winter and under bad weather, the accessibility time extends significantly or may be limited fully due to blizzard and slippery roads when crossing the mountains. -

Download the Detailed Introduction of the VON Area
Regional fact sheets – VON - area Deliverable D4.2 Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH Hans Jürgen Pfeiffer • Ilka Hunger (with the assistence of ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden Peter Franz • Ernst Winkler) November 2014 Contract N°: IEE/12/970/S12.670555 Table of contents 1 Spatial Analysis 3 1.1 Short overview of the area characteristics 3 1.2 Settlement structure in the VON-region 5 1.3 Transport and mobility infrastructure offered 6 2 Socioeconomic and demographic structure 6 2.1 Population`s development in the VON-area (Upper-Lusatia – Lower Silesia) 6 2.2 Summary and conclusions for public transport according to the demographic development in the region 10 3 Regional public transport systems 12 3.1 General information 12 3.2 Public rail transport 13 3.3 Public transport (road) 16 3.4 Transport and mobility prognosis 17 3.4 Area in the VON region, which is provided for the AMC campaign 18 4 References 19 D4.2: Regional fact sheets – Area of the Transport Association Upper Lusatia – Lower Silesia (VON) 2 1 Spatial Analysis 1.1 Short overview of the area characteristics The region of VON in the Federal German State Saxony is the area in responsibility of the Transport Association Upper Lusatia - Lower Silesia (ZVON). The region includes the districts of Görlitz and Bautzen, but the district of Bautzen only partially. Focus of industrial development in the district of Bautzen is the construction of railway vehicles and the production of photovoltaic systems. The economic power of the district of Görlitz is ensured by steel production, production of railway vehicles and turbines. -

Greenline Busguide 2019/2020
GREENLINE BUSGUIDE 2019/2020 Die schönsten Reiseziele Europas / Europe´s most beautiful destinations / Les plus belles destinations en Europe GreenLine Gruppenhotels / hôtels de groupe / group hotels Sylt Flensburg Ostsee 1 4 Kiel Rügen A 23 2 Nordsee Schleswig-Holstein Stralsund 3 Usedom Lübeck Rostock Greifswald Ostfriesland A 20 6 5 10 A 26 Wismar Mecklenburg-Vorpommern7 A 29 Hamburg Bremerhaven 8 Neubrandenburg Wilhelmshaven 11 Schwerin 9 Emden A 19 Groningen A 27 Bremen Lüneburg A 28 Havel Oldenburg Elbe A 24 A 11 12 Niedersachsen A 10 Aller Stendal Weser Celle Brandenburg Berlin A’dam Oder Wolfsburg 15 Enschede Potsdam Den Haag Hannover 14 20 A 2 Frankfurt Niederlande Osnabrück 16 Hildesheim Braunschweig Arnheim 13 Spree Brandenburg Münster Ems Bielefeld Magdeburg Cottbus 19 Detmold 18 Lippe Dessau A 15 Sachsen-Anhalt17 A 13 Dortmund Ruhr Essen Göttingen Duisburg Ruhr Halle 24 25 Neisse Düsseldorf Kassel Werra Nordhausen Saale Leipzig 28 Görlitz 22 33 Nordrhein-Westfalen 21 Dresden A 7 Fulda 26 27 Köln Erfurt Weimar Siegen Maastricht Marburg A 4 29 Eisenach Gera Chemnitz Bonn 23 Thüringen Gießen Sachsen A 65 Lahn Suhl Fulda A 9 Hessen Plauen Koblenz A 5 Frankfurt a.M. Wiesbaden Hof Rheinland-Pfalz Coburg 32 A 1 Main Mainz A 3 Mosel Bayreuth Darmstadt Bamberg Trier Rhein Würzburg Saarland Ludwigshafen Mannheim Erlangen Saarbrücken 30 Fürth Nürnberg Kaiserslautern Heidelberg A 6 Karlsruhe Regensburg Neckar A 81 Bayern Donau Stuttgart Ingolstadt A 93 Tübingen Passau Straßburg A 8 Ulm Baden-Württemberg Landshut Inn Augsburg Isar 31 Freiburg München Friedrichshafen Lech Garmisch-Partenkirchen 2 Alle weiteren Infos & Buchung / Plus d'informations et réservation / More information & booking www.greenline-gruppenreisen.de Hotelübersicht / Présentation de l'Hôtel / Hotel overview Sylt Flensburg Ostsee Kiel Rügen A 23 Nordsee Schleswig-Holstein Stralsund Usedom Lübeck Rostock Greifswald Ostfriesland A 20 A 26 Ort / Region Wismar Mecklenburg-Vorpommern Hotelname / Nom des hôtels Ville / Localisation A 29 Hamburg Bremerhaven Neubrandenburg Nr. -
Geoparks in Deutschland Geoparks in Germany Deutschlands Erdgeschichte Erleben Experience Germany’S Geological History
Geoparks in Deutschland Geoparks in Germany Deutschlands Erdgeschichte erleben Experience Germany’s Geological History Kiel Nordisches Steinreich Schwerin Hamburg Eiszeitland am Oderrand Bremen Berlin TERRA.vita Hannover Potsdam Magdeburg Harz • Braunschweiger Cottbus Land • Ostfalen Leipzig Muskauer Ruhrgebiet Grenz Kyffhäuser Faltenbogen Welten Porphyr-(Łuk Mużakowa) Düsseldorf Inselsberg - Saale- Unstrut land Dresden Köln Drei Gleichen Erfurt Triasland Westerwald- Vulkanregion Lahn-Taunus Vogelsberg Schieferland Vulkanland Eifel Frankfurt Mainz Bayern-Böhmen Bergstraße- (Česko-Bavorský) Odenwald Saarbrücken Nürnberg Ries Stuttgart Schwäbische Alb München GEOPARKS IN DEUTSCHLAND INHALT CONTENT Geoparks in Deutschland Geoparks in Germany 3 Vom Norddeutschen Tief- Karte map 6 land bis zum Hochgebirge Geopark Bayern-Böhmen Geopark Bavaria-Bohemia 7 der Alpen, von der Mecklen- Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald burgischen Seenplatte über Geo-Nature Park Bergstraße-Odenwald 8 die bewaldeten Höhen der Geopark Eiszeitland am Oderrand Mittelgebirge bis zu den Geopark Ice Age Landscape on the Edge of the Oder River 9 Felsen der Schwäbischen Geopark GrenzWelten Geopark Border Worlds 10 Alb oder des Elbsandstein- Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen gebirges – Deutschlands Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen 11 Landschaften sind vielfältig. Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen GeoPark Inselsberg – Three Equals 12 GeoPark Kyffhäuser GeoPark Kyffhäuser 13 Woher stammt diese Vielfalt der Landschaftsformen? Geopark Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa Deutschlands Geoparks versuchen darauf eine Antwort zu Geopark Muskau Arch / Łuk Mużakowa 14 geben: Waren es in Nord- und Ostdeutschland und im Alpen- GeoPark Nordisches Steinreich vorland die Gletscher der Eiszeit, die das Landschaftsbild GeoPark Nordisches Steinreich 15 formten, so beherrschen in der Eifel oder am Vogelsberg erlo- Geopark Porphyrland Geopark Porphyry Country 16 schene Vulkane aus dem Tertiär das Bild. -

Schüleraustausch Mit Den Philippinen
Juni 2017 Aus dem Inhalt: - Schüleraustausch - Spracholympiaden AKTUELLES n Schüleraustausch mit den Philippinen Zusammen mit unserer Partnerschule „German zeigten ihrem Gast die Umgebung. In den vier European School Manila“ führen wir in regelmä- Wochen Aufenthalt besuchten die philippini- ßigen Abständen einen Schüleraustausch schen Schüler/innen die jeweilige Schule. Ne- durch. Am Samstag, den 01.04.2017 war es ben dem Lernen standen auch viele Ausflüge wieder soweit. Es reisten Schüler und Schüle- wie in den Leipziger Zoo, nach Belantis, Dres- rinnen aus Manila mit ihrer Lehrerin Frau Pfaff den und Berlin auf dem Programm. So lernten zu uns nach Sachsen. sie die deutsche Sprache und Deutschland nä- Voller Vorfreude trafen sich alle Gäste und de- her kennen. Die vier Wochen vergingen wie im ren Gastfamilien in den Internationalen Schulen Flug und wir mussten auf einer Abschlussfeier in Meerane. Bei einem gemeinsamen Mittages- unsere Gäste, die uns sehr ans Herz gewach- sen lernte man sich näher kennen. Sofort fühl- sen sind, wieder verabschieden. ten sich die Gäste bei uns wohl. Anschließend fuhren unsere Gäste mit ihren Gastfamilien (die- 2018 fahren unsere Schüler auf die se stammen aus allen Schulen der Saxony Philippinen und freuen sich jetzt International Schools) nach Hause und ver- schon auf ein Wiedersehen mit ihren brachten dort ein sonniges Wochenende. Viele Freunden. Familien unternahmen die ersten Ausflüge und Schulzeitung der Saxony International School – Carl Hahn gemeinnützige GmbH | Ausgabe Juni 2017 2 AKTUELLES n SIS Schüler auf Entdeckungstour in Ägypten n Kompetenztests der Oberschulen Ende April reisten neun Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen, Geithain und Elsterberg nach Kairo, um dort für zwei Wochen am englischsprachigen Unterricht teilzunehmen und die ägypti- sche Kultur kennenzulernen. -
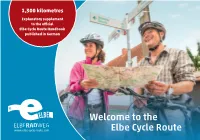
Welcome to the Elbe Cycle Route
1,300 kilometres Explanatory supplement to the offi cial Elbe Cycle Route Handbook published in German Welcome to the ELBERADWEG www.elbe-cycle-route.com Elbe Cycle Route 2 The Elbe Cycle Route – an overview Our contact details: The German CYCLE NETWORK DEN- Koordinierungsstelle Elberadweg Nord (D-routes) MARK c /o Herzogtum Lauenburg EuroVelo network Marketing und Service GmbH (EuroVelo routes) D 7 D 2 Elbstraße 59 | 21481 Lauenburg / Elbe Tel. +49 4542 856862 | Fax +49 4542 856865 Rostock [email protected] D 1 Hamburg D 11 Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte D 10 GERMANY c /o Magdeburger Tourismusverband NETHERLANDS D 7 Elbe-Börde-Heide e. V. ELBERADWEG Berlin Hannover Amsterdam Domplatz 1 b | 39104 Magdeburg Magdeburg D 12 POLAND Tel. +49 391 738790 | Fax +49 391 738799 D 3 [email protected] D 10 D 7 Antwerp Leipzig Dresden Koordinierungsstelle Elberadweg Süd BELGIUM Cologne D 4 D 4 c /o Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. Prague Frankfurt a. M. D 5 Bahnhofstraße 21 | 01796 Pirna D 5 LUXEM- Tel. +49 3501 470147 | Fax +49 3501 470111 BURG CZECH REPUBLIC [email protected] D 8 D 11 Koordinierungsstelle Stuttgart FRANCE Vienna Elberadweg Tschechien D 6 Nadace Partnerství Munich AUSTRIA Na Václavce 135/9 150 00 Prag 5 | Tschechien Zurich Tel. | Fax +420 274 816 727 SWITZERLAND [email protected] www.elbe-cycle-route.com Dear Cyclists, 1,300 kilometres full of surprises of the Vltava river. Gentle slopes make for a relaxed cycling trip. In addition to the route, We are very happy that you are interested Immerse yourself in a special experience – our brochure also contains information in the Elbe Cycle Route. -

Archeologické Rozhledy 2015
Archeologické rozhledy LXVII–2015 1 OBSAH Petr Květina – Jiří Unger – Petr Vavrečka, Presenting the invisible and unfat- 3–22 homable: Virtual museum and augmented reality of the Neolithic site in Bylany, Czech Republic – Jak představit, co je neviditelné a neuchopitelné? Virtuální museum a rozšířená realita neolitické lokality v Bylanech Martin Oliva, Kotázce redistribučních center štípané industrie kultury 23–44 s lineární keramikou. Litický inventář stupně IIb z Pustějova v Oderské bráně – On the issue of chipped industry redistribution centres with the Linear Pottery Culture. Lithic inventory of the IIb stage from Pustějov in the “Oderská brána” Gate Martin Trefný – Miloslav Slabina, K nejdůležitějším aspektům architektury, 45–78 hmotné kultury a k významu halštatského hradiště v Minicích (Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník) – The key aspects of the architecture, material culture and significance of the Hallstatt period hillfort in Minice (Kralupy nad Vltavou, central Bohemia) Eva Černá – Kateřina Tomková – Václav Hulínský, Proměny skel od 11. do kon- 79–108 ce 13. století v Čechách – The glass transformation in Bohemia between the eleventh century and the end of the thirteenth century DISKUSE Dagmar Dreslerová, Pravěká transhumance a salašnické pastevectví na úze- 109–130 mí České republiky: možnosti a pochybnosti – Prehistoric transhumance and summer farming in the Czech Republic: possibilities and doubts Milan Holub, Poznámka k úloze grafitu ve středověké keramice Moravy 131–140 a Slezska – Observations on the role of graphite in medieval pottery from Moravia and Silesia AKTUALITY L. Jiráň, XVII. kongres UISPP v Burgosu a ukončení činnosti Českého národního komi- 141 tétu archeologického David Vích, Seminář Detektory kovů v archeologii 2014 141–143 Milan Salaš, Úmrtí PhDr. -

Transeconet NEWS Issue 10, September 2011
TransEcoNet NEWS www.transeconet.eu Issue 10, September 2011 Editorial This summer work with people in the project re- gions stood in the focus of TransEcoNet. Excur- sions were carried out to inform local residents about ecological networks and the cultural history of their region. Interviews were made with local con- temporary witnesses addressing the way how they perceive landscape change. One main activity in this respect was also the preparation of documen- © M. Fiala tary films covering Central European border land- scapes. We talked to the director of the films, Lenka In this issue Ovčačková, about her experiences with the people Landscape and memory - documentary films 1 Interview with Lenka Ovčačková 3 in the regions. Additional information about activities Life in the back of beyond: Czech-German field trip 4 of other Euro-pean projects dealing with ecological Vital Landscapes and TransEcoNet 5 networks and cultural landscapes are also covered News from the Continuum Initiative 7 in this issue of TransEcoNet News. We wish you a Publications on ecological networks 7 Other European projects 8 pleasant reading! Event calendar 9 The Project Team of TransEcoNet Landscape and Memory Documentary films about people and landscapes in Central European border regions Some of the actions implemented within TransEcoNet people cope with this challenge and how they estab- aim at raising awareness for ecological networks and lish their way of life in the border landscapes. They for the general need to maintain and restore biological reflect on their daily routines and how they transfer diversity. Therefore, a series of documentary films is former traditions and experiences to the present being implemented covering the development of the landscape. -

Germany - Elbe Sandstone Mountains Hiking Tour 2021 Individual Self-Guided 8 Days/7 Nights
Germany - Elbe Sandstone Mountains Hiking Tour 2021 Individual Self-Guided 8 days/7 nights The Elbe Sandstone Mountains, located in the southeast of Germany, a few kilometers from Dresden are also known as Saxon Switzerland. This nickname was given by two Swiss painters who were impressed by the similarity of the area with their own country. With its chalky sandstone cliffs, deeply carved valleys, Table Mountains and gorges, this fascinating landscape is the only one of its kind in central Europe. During your walking tour you will see famous natural and cultural sights such as the Königstein Fortress”, the rocks “Barbarine” and “Pfaffenstein” and the well-known Rock Arch “Pravcická Brána” in Bohemian Switzerland, which is the largest natural stone bridge on the European continent. OK Cycle & Adventure Tours Inc. - 666 Kirkwood Ave - Suite B102 – Ottawa, Ontario Canada K1Z 5X9 www.okcycletours.com Toll Free 1-888-621-6818 Local 613-702-5350 Itinerary Day 1: Individual arrival in Bad Schandau Bad Schandau is a well-known health resort in the heart of the Saxon Switzerland. Day 2: Bad Schandau – fortress Hohnstein - Rathen 17 km 6 hrs Through the Saxon Switzerland National Park you walk uphill to the fortress Hohnstein. You will then arrive at Rathen with its natural theatre and its lake called “Amselsee”. Day 3: Rathen – Wehlen - Königstein 14 km 5 – 6 hours Please start early in the morning to benefit from the emptiness on the famous Bastei bridge. Here you can enjoy a wonderful view over the Elbe river valley and the Table Mountains of the Saxon Switzerland.