Studie Oberhof-Tbrsv
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
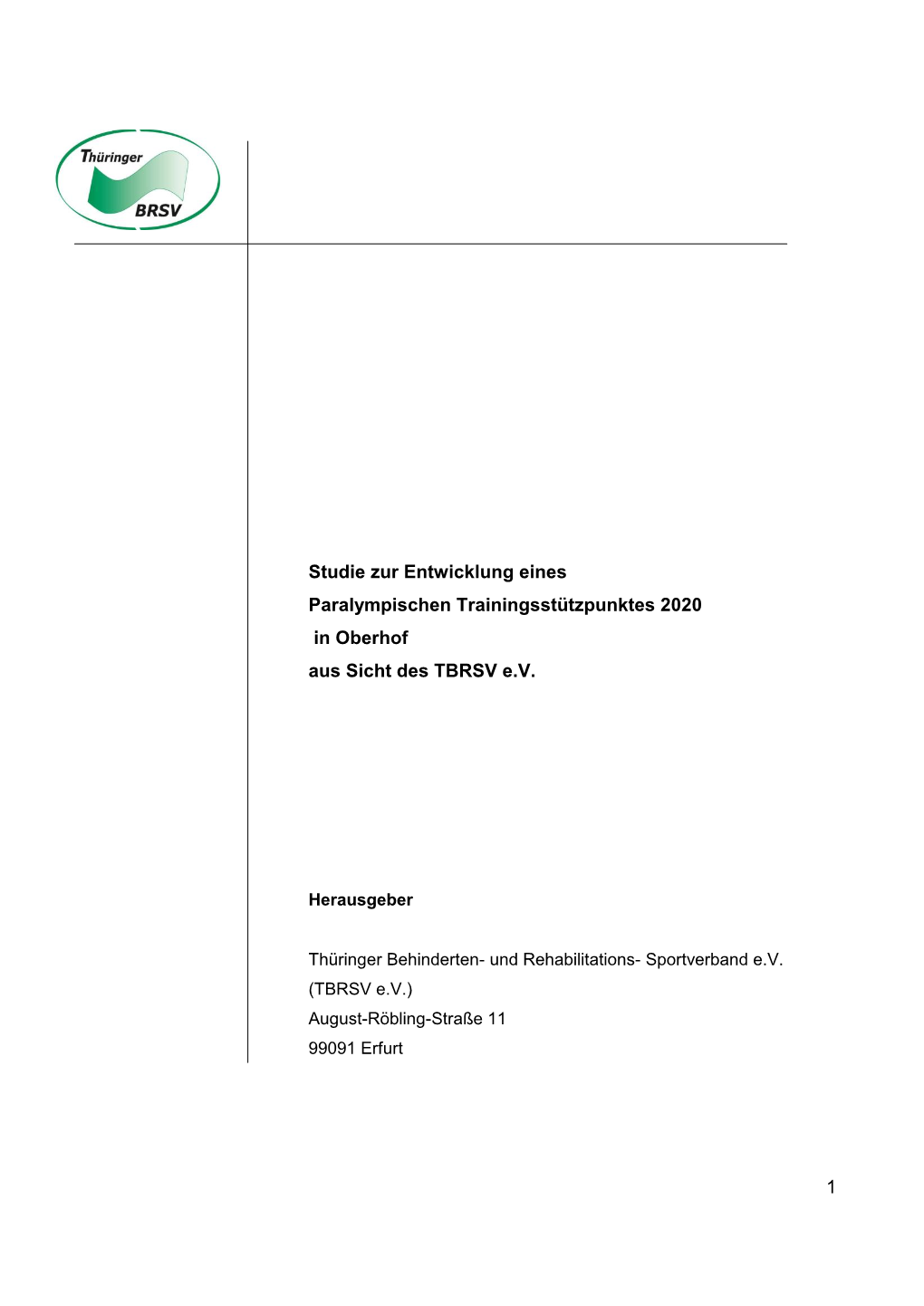
Load more
Recommended publications
-

Outstanding Performances at the Viii Paralympic Games
Paralympic Games The opening ceremony was OUTSTANDING PERFORMANCES a breathtaking celebration of Paralympic sport based on the AT THE VIII PARALYMPIC GAMES Games' theme "Awaken the Mind - Free the Body - Inspire the Spirit". Actor Louis Gossett Jr.'s narration he extinguishing of the the position of a watch hand. "Go 11 by Susanna Reiff* based on this motto reached a high Olympic flame in Salt Lake and up, up, up," one can hear a point when Rudy Garcia-Tolson, a TCity was an emotional guide shout on the cross-country 13 year-old boy who has lost both of moment. "It's all over now," is what track. In biathlon competitions, visu his legs and competes in triathlon, many felt. But that was not quite true ally impaired athletes use an spoke about his dream of participat as the second part of the Salt Lake acoustic rifle system, which allows ing in the 2004 Paralympics in 2002 celebrations was yet to come: them to adjust the rifle aim according Athens. "My spirit thinks I'm a regu the VIII Paralympic Winter Games. to audio cues heard through a head lar boy - and an athlete," said Immediately after the end of the set. As the athlete aims the rifle Garcia-Tolson. "My spirit soars." Eric Olympic events the crucial transition towards the target, the frequency of Weihenmeyer, the first blind man to period began for the Salt Lake the sound signal increases. The successfully climb Mount Everest Organizing Committee (SLOC). The Paralympic version of ice hockey is carried the Paralympic torch to a Olympic Village was transformed into played on sledges and is therefore podium - guided by his dog - to then the Paralympic Village, called ice sledge hockey. -

Practice and Challenges on Training System of Paralympic Athletics Project in Case of Arada and Addis Ketem Sub Cities
PRACTICE AND CHALLENGES ON TRAINING SYSTEM OF PARALYMPIC ATHLETICS PROJECT IN CASE OF ARADA AND ADDIS KETEM SUB CITIES. By: BIZUYE NEGA A THESIS SUBMITTED TO THE SCHOOL OF GRADUATE STUDIES ADDIS ABABA UNVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUEREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTERS OF SPORT SCIENCE June 2015 Addis Ababa, Ethiopia PRACTICE AND CHALLENGES ON TRAINING SYSTEM OF PARALYMPIC ATHLETICS PROJECT IN CASE OF ARADA AND ADDIS KETEM SUB CITIES. By – BIZUYE NEGA A THESIS SUBMITTED TO THE SCHOOL OF GRADUATE STUDIES ADDIS ABABA UNVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUEREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTERS OF SPORT SCIENCE June 2015 Addis Ababa ADDIS ABAB UNIVERSITY SCHOOL OF GRADUATE STUDIES FACULTY OF LIFE SCIENCE DEPARTEMENT OF SPORT SCIENCE PRACTICE AND CHALLENGES ON TRAINING SYSTEM OF PARALYMPIC ATHLETICS PROJECT IN CASE OF ARADA AND ADDIS KETEM SUB CITIES. By – BIZUYE NEGA A THESIS SUBMITTED TO THE SCHOOL OF GRADUATE STUDIES ADDIS ABABA UNVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUEREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTERS OF SPORT SCIENCE IN COACHING ATHLETICS Approved by Board of Examiner ----------------------- -------------- --------------- Chairman, department Signature Date Of graduate Committee …………………………… -------------- --------------- Advisor Signature Date ---------------------------------- ------------- --------------- External Examiner Signature Date ----------------------------------- -------------- -------------- Internal Examiner Signature Date June 2015 ADDIS ABABA ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my gratitude to Dr. Tesfay Asegedom my thesis adviser for his support and encouragement starting from shaping the topic, proposal development and the final research report. This study could not have been written without his professional comments and guidance thereafter and above all for his untiring meticulous corrections of the texts. This study would have been impossible without the support of my family. -

Paralympics Zeitung in Kooperation Mit Der
DONNERSTAG, 11. MÄRZ 2010 Paralympics Zeitung In Kooperation mit der Merkels Sportsgeist Schülerreporter fragen die Kanzlerin: Was fasziniert Sie am Behindertensport? Augen zu und durch So kommt man blind die Piste runter: Ein Selbstversuch zum Start der Spiele Der Tagesspiegel_2 Inhalt Das deutsche Team 4 20 Sportlerinnen und Sportler 8 Mixed Zone gehen auf Medaillenjagd Alle Termine und Sendezeiten der Wettkämpfe in Fernsehen und Internet „Mein Respekt!“6 Die Kanzlerin erzählt Schülern, 14 Fairness geht vor was sie an den Paralympics fasziniert In Kanada ist die Gleichstellung von Behinderten selbstverständlich Im Blindflug 7 Mit 120 die Piste runter, ohne etwas zu 15 Stille Helden sehen? Selbstversuch einer Schülerin Die DGUV hilft Menschen nach Schicksalsschlägen – seit 125 Jahren Fotos: dpa (2), Cinetext, privat, von Törne, DGUV; Titelbild: DGUV PParalympicsaralympics 22010010 DDabeiabei seinsein istist alles!alles! BBeiei KKLMLM iistst dderer WWegeg zzumum ZZieliel sschonchon dasdas hhalbealbe VVergnügen.ergnügen. DasDas giltgilt ggemäßemäß ddemem olympischenolympischen MottoMotto aauchuch ffürür ddieie sspannendenpannenden SSpielepiele iinn VVancouver.ancouver. WWirir wwünschenünschen aallenllen AAthletenthleten vvieliel FFreudereude bbeiei dderer TTeilnahmeeilnahme undund vielviel ErfolgErfolg bbeiei ddenen WWettkämpfen!ettkämpfen! wwww.klm.deww.klm.de Foto: John Sinal Hello! Salut! On behalf of the Interna- Chers lecteurs alle- tional Paralympic Com- mands et canadiens. mittee (IPC), it is a plea- Cela est une opportunité sure to see the Paralym- unique pour le mouve- pics Zeitung return to Hallo! ment olympique cana- the Paralympic audi- dien que les Jeux para- ence in Germany. This lympiques puissent se publication has been fol- Abschlussfeiern Olympi- déroulersurnotresolna- Foto: promo Foto: IPC lowing the Paralympic scher Spiele haben eine taletquelesjeunespour- Games since Athens in 2004, and now at neue Bedeutung: Mit ront apprendre tout sur les talents incroyab- the Vancouver 2010 Paralympic Winter Ga- dem Feuerwerk beginnt les de nos champions. -

IPC Biathlon and Cross-Country Skiing Media Guide 2015-2016
IPC Biathlon and Cross-Country Skiing Media Guide 2015-2016 IPC Biathlon and Cross-Country Skiing Media Guide 1 Table of contents 4 President’s welcome 6 Media and broadcast contacts 7 About the sport 11 Looking ahead to 2015-16 13 Competition calendar 2015-16 14 Accreditation for competitions 16 Classification explained 18 Ones to Watch 62 Vital statistics 68 Participation 70 Medals tables 72 Sochi 2014 Paralympic medallists 80 World Championships medallists 88 World Cup standings 90 National Paralympic Committee contacts 92 Officials 92 Anti-doping 2 IPC Biathlon and Cross-Country Skiing Media Guide IPC Biathlon and Cross-Country Skiing Media Guide 3 President’s welcome Russia, Germany and Finland. Once again the biggest names in the sports will go head-to-head on some of the best trail systems in the world. Most importantly the first Asian Cup will take place in PyeongChang, South Korea, as the sports expand in the region ahead of the 2018 Paralympic Winter Games. This will help raise the profile of those athletes who have entered into the World Cup top 10 for the first time in recent seasons, in their own territory. In addition, the World Cup programme is Dear media representative, being expanded and will include a mara- thon for the first time. With this, the sport Welcome to the Media Guide for the is once again aiming to expand its appeal 2015-16 IPC Biathlon and Cross-Country as well as responding to the wishes of the Skiing season. athlete community for yet more challen- ging races. After the success of the Sochi 2014 Paralympic Winter Games and the 2015 Cross-country skiing and biathlon has ex- World Championships, both of which perienced an upturn in interest in recent raised the bar in many areas for the sport, seasons and I hope that with the geo- the half-way point in the Paralympic cycle graphical expansion and their constantly is upon us. -

Hephaistos-Salt-Lake-Paralympics-2002.Pdf
opmaak salt lake12 10-04-2002 12:48 Pagina 1 Nederland op de PARALYM PI CS 2002 Een impressie uit salt lake opmaak salt lake12 10-04-2002 12:48 Pagina 2 colofon Kop inhoud Opdrachtgever Stichting Hephaïstos, ‘s-Gravenhage Koni nkli jk bezoek aan de Wi nt er Paralymi cs 4 De stichting Hephaïstos heeft onder meer tot doel ondersteuning te bieden aan publicaties Feest der herkenning: voorwoord Margo Vliegenthart, Staatssecretaris VWS 8 over gehandicaptensport. Voor meer informatie zie: www.stichtinghephiastos.nl Steeds meer de plaats die zij verdienen: voorwoord Rob Uijen, voorzitter NSV 10 Uitgeverij Pre mi um Pre ss, We e rt Geschiedenis 12 Auteurs Ja n Ri j p st ra Voorbereiding/ploegoverdracht 14 Annemari e Kapt ei n Sa l t La ke Ci t y 16 Met medewerking van Henk van Lint, Chef de Mission (dagboek) Olympisch dorp: Thuis ver van huis 18 Ei nd r e d a ct i e ? Opening 20 Fot ogr a f i e Stichting Hephaïstos (Jan Rijpstra en Annemarie Kaptein), behalve foto’s van Mathilde Dusol op Bi at lon / Bi at hlon 24 pagina’s: 4, 5, 7, 18, 19, 25, 26, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 51, 55, 57, 63, 74. Foto’s van Langlaufen / Cross-country 30 Hein Koops op pagina’s: 14, 15. En foto’s van het ANP op pagina’s: 12,13,22-23,72,73. Afdali ng /Downhi ll 36 Sup e r-G 42 Design Ja nJa a p Ry p ke ma , Amst e rd a m Reuzenslalom / Giant slalom 48 Druk Pre Vi si o n, Ei nd ho ve n Sl a l o m 54 Co p y r i g h t Stichting Hephaïstos, ’s-Gravenhage IJsslee-hockey / Ice sledge hockey 60 Sluitingsceremonie / Closing ceremony 66 Weer Thuis / Home again 70 Voor meer informatie over de Stichting Hephaïstos en voor het bestellen van boeken: Huldiging / honouring 72 www.stichtinghephaistos.nl Ui t sl a g e n / Re sul t s 7 4 Dagboek Cees Vervoorn 14-70 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting. -

Augenhöhe Tabellenerster
MONTAG,22. MÄRZ 2010 Paralympics Zeitung In Kooperation mit der Augenhöhe Interview mit DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher Tabellenerster Deutschland siegt im Medaillenspiegel Der Tagesspiegel_2 Inhalt Number One 4 Deutschland siegt 10 Outlook London im Medaillenspiegel TheEnglish capital wants to be agood host for the next Paralympics Goal accomplished 5 Team Canada finishes ranking third 12 Weiblicher Erfolg on the medal count Die größten Stars von Vancouver waren Frauen Neue Generation 6 Die Nachfolger von Schönfelder &Co. 13 See you in Sochi stehen schon bereit Theparalympic flag was passed to So- chi, wherethe 2014 Games will be held „Auf Augenhöhe“ 7 Ein Interview mit DBS-Präsident 14 Unforgetable Friedhelm Julius Beucher TheParalympic Post project was a great experience Pictures 8 Impressions from 15 „Life goes on“ Vancouver and Whistler Schülerinnen fragen die DGUV,was das Projekt Paralympics Zeitung ausmacht AFP Titelfoto: (2); dpa (2), Reuters (2), AFP (4), Rückeis Thilo Fotos: Foto: dpa Hallo! Hello! Liebe Sportfans, vom It wasagreatpleasure 12. bis 21.März 2010 forustohost the world trafen sich zahlreiche au- hereinWhistler and ßergewöhnliche Athle- Hello! Vancouverduring the tinnen und Athleten aus 2010 Olympic and Para- aller Welt zu den Para- lympic Games. lympischen Winterspie- We have experienced promo len in Vancouver. Als Vi- We have justseenfantas- PZ thrilling competition, Foto: zepräsidentin der EU- tic Paralympic Games Foto: fantastic athletes and as- Kommission ist es mir ein besonderes Anlie- hereinVancouverand tonishing performances. We arealso very gen, die Paralympics zu unterstützen. Sport Whistler.The euphoric pleased that the media coverage on the ga- bietet die ideale Plattform für einen interkul- fans from all over the mes wasbroader than ever beforeatPara- turellen Austausch zwischen Menschen un- worldwereableto lympic Winter Games. -

Reproductions Supplied by EDRS Are the Best That Can Be Made from the Original Document
DOCUMENT RESUME ED 473 802 CS 511 787 TITLE Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (85th, Miami, Florida, August 5-8, 2002). Miscellaneous Divisions. PUB DATE 2002-08-00 NOTE 516p.; For other sections of these proceedings, see CS 511 769-786. PUB TYPE Collected Works Proceedings (021) Reports Research (143) EDRS PRICE EDRS Price MF02/PC21 Plus Postage. DESCRIPTORS Advertising; Broadcast Journalism; Case Studies; Course Evaluation; Disabilities; Foreign Countries; Higher Education; *Internet; Internship Programs; *Journalism Education; Marriage; Mass Media Effects; Media Coverage; Newspapers; Olympic Games; Portfolios (Background Materials); Presidential Campaigns (United States); Religion; *Scholastic Journalism; *Student Attitudes; Visual Arts IDENTIFIERS *Civic Journalism; Framing (Communication Behavior); South Korea; Television News ABSTRACT The Miscellaneous Divisions of the proceedings contains the following 18 papers: "The Detroit Newspapers' Coverage of the Roman Catholic Archdiocese of Detroit Before and During the Newspaper Strike" (Geri Alumit Zeldes); "Uncivil Religion and Uncivil Science: A Case Study in News Framing and the Sociology of Knowledge" (Rick Clifton Moore); "Portrayal of Religion in Reality TV Programming: Hegemony and the Contemporary American Wedding" (Erika Engstrom and Beth Semic); "Are Disability Images in Advertising Becoming Bold and Daring? An Analysis of Prominent Themes in U.S. and UK Campaigns" (Beth A. Haller and Sue Ralph); "An Analysis of the Dissimilar Coverage of the 2002 Olympics and Paralympics: Frenzied Pack Journalism Versus the Empty Press Room" (Anne V. Golden); "Students as Citizens: Experiential Approaches to Teaching Civic Journalism" (Chike Anyaegbunam and Buck Ryan); "How Public Sphere Theorists Have Influenced Civic Journalism" (Sherrie L.