Online-Quellen Nutzen: Recherche Im Internet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Duckduckgo Search Engines Android
Duckduckgo search engines android Continue 1 5.65.0 10.8MB DuckduckGo Privacy Browser 1 5.64.0 10.8MB DuckduckGo Privacy Browser 1 5.63.1 10.78MB DuckduckGo Privacy Browser 1 5.62.0 10.36MB DuckduckGo Privacy Browser 1 5.61.2 10.36MB DuckduckGo Privacy Browser 1 5.60.0 10.35MB DuckduckGo Privacy Browser 1 5.59.1 10.35MB DuckduckGo Privacy Browser 1 5.58.1 10.33MB DuckduckGo Privacy Browser 1 5.57.1 10.31MB DuckduckGo Privacy browser © DuckduckGo. Privacy, simplified. This article is about the search engine. For children's play, see duck, duck, goose. Internet search engine DuckDuckGoScreenshot home page DuckDuckGo on 2018Type search engine siteWeb Unavailable inMultilingualHeadquarters20 Paoli PikePaoli, Pennsylvania, USA Area servedWorldwideOwnerDuck Duck Go, Inc., createdGabriel WeinbergURLduckduckgo.comAlexa rank 158 (October 2020 update) CommercialRegregedSeptember 25, 2008; 12 years ago (2008-09-25) was an Internet search engine that emphasized the privacy of search engines and avoided the filter bubble of personalized search results. DuckDuckGo differs from other search engines by not profiling its users and showing all users the same search results for this search term. The company is based in Paoli, Pennsylvania, in Greater Philadelphia and has 111 employees since October 2020. The name of the company is a reference to the children's game duck, duck, goose. The results of the DuckDuckGo Survey are a compilation of more than 400 sources, including Yahoo! Search BOSS, Wolfram Alpha, Bing, Yandex, own web scanner (DuckDuckBot) and others. It also uses data from crowdsourcing sites, including Wikipedia, to fill in the knowledge panel boxes to the right of the results. -

EFF, Duckduckgo, and Internet Archive Amicus Brief
Case: 17-16783, 11/27/2017, ID: 10667942, DktEntry: 42, Page 1 of 39 NO. 17-16783 IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT HIQ LABS, INC., PLAINTIFF-APPELLEE, V. LINKEDIN CORPORATION, DEFENDANT-APPELLANT. On Appeal from the United States District Court for the Northern District of California Case No. 3:17-cv-03301-EMC The Honorable Edward M. Chen, District Court Judge BRIEF OF AMICI CURIAE ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION, DUCKDUCKGO, AND INTERNET ARCHIVE IN SUPPORT OF PLAINTIFF-APPELLEE Jamie Williams Corynne McSherry Cindy Cohn Nathan Cardozo ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION 815 Eddy Street San Francisco, CA 94109 Email: [email protected] Telephone: (415) 436-9333 Counsel for Amici Curiae Case: 17-16783, 11/27/2017, ID: 10667942, DktEntry: 42, Page 2 of 39 DISCLOSURE OF CORPORATE AFFILIATIONS AND OTHER ENTITIES WITH A DIRECT FINANCIAL INTEREST IN LITIGATION Pursuant to Rule 26.1 of the Federal Rules of Appellate Procedure, Amici Curiae Electronic Frontier Foundation, DuckDuckGo, and Internet Archive each individually state that they do not have a parent corporation and that no publicly held corporation owns 10 percent or more of their stock. i Case: 17-16783, 11/27/2017, ID: 10667942, DktEntry: 42, Page 3 of 39 TABLE OF CONTENTS CORPORATE DISCLOSURE STATEMENTS ..................................................... i TABLE OF CONTENTS ...................................................................................... ii TABLE OF AUTHORITIES ............................................................................... -
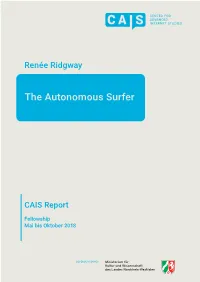
The Autonomous Surfer
Renée Ridgway The Autonomous Surfer CAIS Report Fellowship Mai bis Oktober 2018 GEFÖRDERT DURCH RIDGWAY The Autonomous Surfer Research Questions The Autonomous Surfer endeavoured to discover the unknown unknowns of alternative search through the following research questions: What are the alternatives to Google search? What are their hidden revenue models, even if they do not collect user data? How do they deliver divergent (and qualitative) results or knowledge? What are the criteria that determine ranking and relevance? How do p2p search engines such as YaCy work? Does it deliver alternative results compared to other search engines? Is there still a movement for a larger, public index? Can there be serendipitous search, which is the ability to come across books, articles, images, information, objects, and so forth, by chance? Aims and Projected Results My PhD research investigates Google search – its early development, its technological innovation, its business model of the past 20 years and how it works now. Furthermore, I have experimented with Tor (The Onion Router) in order to find out if I could be anonymous online, and if so, would I receive diver- gent results from Google with the same keywords. For my fellowship at CAIS I decided to first research search engines that were incorporated into the Tor browser as default (Startpage, Disconnect) or are the default browser now (DuckDuckGo). I then researched search engines in my original CAIS proposal that I had come across in my PhD but hadn’t had the time to research; some are from the Society of the Query Reader (2014) and others I found en route or on colleagues’ suggestions. -

GOGGLES: Democracy Dies in Darkness, and So Does the Web
GOGGLES: Democracy dies in darkness, and so does the Web Brave Search Team Brave Munich, Germany [email protected] Abstract of information has led to a significant transfer of power from cre- This paper proposes an open and collaborative system by which ators to aggregators. Access to information has been monopolized a community, or a single user, can create sets of rules and filters, by companies like Google and Facebook [27]. While everything is called Goggles, to define the space which a search engine can pull theoretically still retrievable, in practice we are looking at the world results from. Instead of a single ranking algorithm, we could have through the biases of a few providers, who act, unintentionally or as many as needed, overcoming the biases that a single actor (the not, as gatekeepers. Akin to the thought experiment about the tree search engine) embeds into the results. Transparency and openness, falling in the forest [3], if a page is not listed on Google’s results all desirable qualities, will become accessible through the deep re- page or in the Facebook feed, does it really exist? ranking capabilities Goggles would enable. Such system would be The biases of Google and Facebook, whether algorithmic, data made possible by the availability of a host search engine, providing induced, commercial or political dictate what version of the world the index and infrastructure, which are unlikely to be replicated we get to see. Reality becomes what the models we are fed depict without major development and infrastructure costs. Besides the it to be [24]. -

Mass Surveillance
Mass Surveillance Mass Surveillance What are the risks for the citizens and the opportunities for the European Information Society? What are the possible mitigation strategies? Part 1 - Risks and opportunities raised by the current generation of network services and applications Study IP/G/STOA/FWC-2013-1/LOT 9/C5/SC1 January 2015 PE 527.409 STOA - Science and Technology Options Assessment The STOA project “Mass Surveillance Part 1 – Risks, Opportunities and Mitigation Strategies” was carried out by TECNALIA Research and Investigation in Spain. AUTHORS Arkaitz Gamino Garcia Concepción Cortes Velasco Eider Iturbe Zamalloa Erkuden Rios Velasco Iñaki Eguía Elejabarrieta Javier Herrera Lotero Jason Mansell (Linguistic Review) José Javier Larrañeta Ibañez Stefan Schuster (Editor) The authors acknowledge and would like to thank the following experts for their contributions to this report: Prof. Nigel Smart, University of Bristol; Matteo E. Bonfanti PhD, Research Fellow in International Law and Security, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa; Prof. Fred Piper, University of London; Caspar Bowden, independent privacy researcher; Maria Pilar Torres Bruna, Head of Cybersecurity, Everis Aerospace, Defense and Security; Prof. Kenny Paterson, University of London; Agustín Martin and Luis Hernández Encinas, Tenured Scientists, Department of Information Processing and Cryptography (Cryptology and Information Security Group), CSIC; Alessandro Zanasi, Zanasi & Partners; Fernando Acero, Expert on Open Source Software; Luigi Coppolino,Università degli Studi di Napoli; Marcello Antonucci, EZNESS srl; Rachel Oldroyd, Managing Editor of The Bureau of Investigative Journalism; Peter Kruse, Founder of CSIS Security Group A/S; Ryan Gallagher, investigative Reporter of The Intercept; Capitán Alberto Redondo, Guardia Civil; Prof. Bart Preneel, KU Leuven; Raoul Chiesa, Security Brokers SCpA, CyberDefcon Ltd.; Prof. -
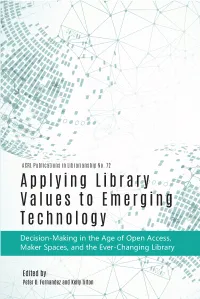
Applying Library Values to Emerging Technology Decision-Making in the Age of Open Access, Maker Spaces, and the Ever-Changing Library
ACRL Publications in Librarianship No. 72 Applying Library Values to Emerging Technology Decision-Making in the Age of Open Access, Maker Spaces, and the Ever-Changing Library Editors Peter D. Fernandez and Kelly Tilton Association of College and Research Libraries A division of the American Library Association Chicago, Illinois 2018 The paper used in this publication meets the minimum requirements of Ameri- can National Standard for Information Sciences–Permanence of Paper for Print- ed Library Materials, ANSI Z39.48-1992. ∞ Cataloging-in-Publication data is on file with the Library of Congress. Copyright ©2018 by the Association of College and Research Libraries. All rights reserved except those which may be granted by Sections 107 and 108 of the Copyright Revision Act of 1976. Printed in the United States of America. 22 21 20 19 18 5 4 3 2 1 Contents Contents Introduction .......................................................................................................ix Peter Fernandez, Head, LRE Liaison Programs, University of Tennessee Libraries Kelly Tilton, Information Literacy Instruction Librarian, University of Tennessee Libraries Part I Contemplating Library Values Chapter 1. ..........................................................................................................1 The New Technocracy: Positioning Librarianship’s Core Values in Relationship to Technology Is a Much Taller Order Than We Think John Buschman, Dean of University Libraries, Seton Hall University Chapter 2. ........................................................................................................27 -

Merging Multiple Search Results Approach for Meta-Search Engines
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by D-Scholarship@Pitt MERGING MULTIPLE SEARCH RESULTS APPROACH FOR META-SEARCH ENGINES By Khaled Abd-El-Fatah Mohamed B.S-------- Cairo University, Egypt, 1995 M.A-------Cairo University, Egypt, 1999 M.A------- University of Pittsburgh 2001 Submitted to the Graduate Faculty of School of Information Sciences in Partial Fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2004 UNIVERSITY OF PITTSBURGH INFORMATION SCIENCES This dissertation was presented by Khaled Abd-El-Fatah Mohamed It was defended on Janauary 29, 2004 and approved by Chris Tomer, PhD, Associate Professor, DLIS Jose-Marie Griffiths, PhD, Professor, DLIS Don King, Research Professor, DLIS Amy Knapp, PhD, ULS Dissertation Director: Chris Tomer, PhD, Associate Professor MERGING MULTIPLE SEARCH RESULTS APPROACH FOR META-SEARCH ENGINES Khaled A. Mohamed, PhD University of Pittsburgh, 2004 Meta Search Engines are finding tools developed for enhancing the search performance by submitting user queries to multiple search engines and combining the search results in a unified ranked list. They utilized data fusion technique, which requires three major steps: databases selection, the results combination, and the results merging. This study tries to build a framework that can be used for merging the search results retrieved from any set of search engines. This framework based on answering three major questions: 1. How meta-search developers could define the optimal rank order for the selected engines. 2. How meta-search developers could choose the best search engines combination. 3. What is the optimal heuristic merging function that could be used for aggregating the rank order of the retrieved documents form incomparable search engines. -

Fingerprinting Detection
ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS: SEMI-SUPERVISED LEARNING FOR BROWSER FINGERPRINTING DETECTION Sarah Bird Vikas Mishra Steven Englehardt Mozilla INRIA Mozilla [email protected] [email protected] [email protected] Rob Willoughby David Zeber Walter Rudametkin University of British Colombia Mozilla INRIA [email protected] [email protected] [email protected] Martin Lopatka Mozilla [email protected] November 1, 2019 ABSTRACT As online tracking continues to grow, existing anti-tracking and fingerprinting detection techniques that require significant manual input must be augmented. Heuristic approaches to fingerprinting de- tection are precise but must be carefully curated. Supervised machine learning techniques proposed for detecting tracking require manually generated label-sets. Seeking to overcome these challenges, we present a semi-supervised machine learning approach for detecting fingerprinting scripts. Our approach is based on the core insight that fingerprinting scripts have similar patterns of API access when generating their fingerprints, even though their access patterns may not match exactly. Using this insight, we group scripts by their JavaScript (JS) execution traces and apply a semi-supervised approach to detect new fingerprinting scripts. We detail our methodology and demonstrate its abil- ity to identify the majority of scripts (>94.9%) identified by existing heuristic techniques. We also show that the approach expands beyond detecting known scripts by surfacing candidate scripts that arXiv:2003.04463v1 [cs.CR] 9 Mar 2020 are likely to include fingerprinting. Through an analysis of these candidate scripts we discovered fin- gerprinting scripts that were missed by heuristics and for which there are no heuristics. In particular, we identified over one hundred device-class fingerprinting scripts present on hundreds of domains. -

Online Legal Research Handout
The New On-Line Search Fundamentals 1. Search Process Natural language searches – Natural language searching is essentially the keyword searching we all know and love; the search results you get reflect algorithmic decision- making by the people who designed the search engine. Often the results you get will be based on the number of times your search terms appear in a document or on a web page. Boolean searches – Boolean searches are also referred to as “terms and connectors” searches. These are the searches using quotation marks, minus signs, slashes, and other symbols to “tell” the search engine exactly what you are searching for. Boolean searching gives you a way to limit your searches by dates, run searches in specific fields, and overall return more precise results. Natural Language v. Boolean searching compared - Most search engines (including Google, Bing, Westlaw Next, and Lexis Advance) are designed for natural language searching. - You can override natural language searching 1. If you know the terms and connectors used by that search engine. (I often click on “help” or something similar to see what terms and connectors the search engine uses.); or 2. If you can find the “advanced search” page for the search engine. - Natural language searching provides the “best” search results when You are not sure where to start and you need to figure out what search terms to use (i.e., you don’t know the words used on the webpages or in the documents you are looking for); You want a large number of search results you can sift through to figure out what kinds of results to expect; or You are researching a conceptual issue rather than a specific topic. -
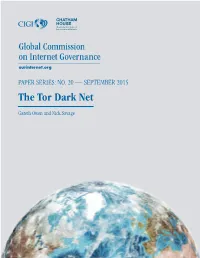
The Tor Dark Net
PAPER SERIES: NO. 20 — SEPTEMBER 2015 The Tor Dark Net Gareth Owen and Nick Savage THE TOR DARK NET Gareth Owen and Nick Savage Copyright © 2015 by Gareth Owen and Nick Savage Published by the Centre for International Governance Innovation and the Royal Institute of International Affairs. The opinions expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Centre for International Governance Innovation or its Board of Directors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution — Non-commercial — No Derivatives License. To view this license, visit (www.creativecommons.org/licenses/by-nc- nd/3.0/). For re-use or distribution, please include this copyright notice. 67 Erb Street West 10 St James’s Square Waterloo, Ontario N2L 6C2 London, England SW1Y 4LE Canada United Kingdom tel +1 519 885 2444 fax +1 519 885 5450 tel +44 (0)20 7957 5700 fax +44 (0)20 7957 5710 www.cigionline.org www.chathamhouse.org TABLE OF CONTENTS vi About the Global Commission on Internet Governance vi About the Authors 1 Executive Summary 1 Introduction 2 Hidden Services 2 Related Work 3 Study of HSes 4 Content and Popularity Analysis 7 Deanonymization of Tor Users and HSes 8 Blocking of Tor 8 HS Blocking 9 Conclusion 9 Works Cited 12 About CIGI 12 About Chatham House 12 CIGI Masthead GLOBAL COMMISSION ON INTERNET GOVERNANCE PAPER SERIES: NO. 20 — SEPTEMBER 2015 ABOUT THE GLOBAL ABOUT THE AUTHORS COMMISSION ON INTERNET Gareth Owen is a senior lecturer in the School of GOVERNANCE Computing at the University of Portsmouth. -

Crypto Course Magdeburg 23. November 2019
Crypto Course Magdeburg 23. November 2019 Jan & Julia Digitalcourage e.V. ▶ non-profit association for data protection and civil rights ▷ "for a world worth living in the digital age" ▷ Big Brother Awards ▷ Actions on current topics ▶ Digitalcourage university group Bielefeld (www.digitalcourage.de/hsg-bi) ▷ CryptoParties, Backup Parties, Linux Install Parties ▷ Regular meetings at the university CryptoParty ▶ Digital self-defense ▶ Protection against mass surveillance ▶ Beginner friendly ▶ Public, non-commercial, worldwide ▶ By users for users ▶ Join in and become part of the CryptoParty movement ▶ https://cryptoparty.in The Course at a Glance ▶ Why should I learn how to encrypt? ▶ How to secure my browser ▶ Basics of smartphone security LET'S GO! The Course at a Glance ▶ Why should I learn how to encrypt? ▶ How to secure my browser ▶ Basics of smartphone security Digital Identity Metadata ▶ Search terms (Search History) ▶ Entered, seen, clicked ▶ IP address ▶ Language ▶ Date, time ▶ Device, operating system, browser ▶ Location (GPS or Browser) ▶ https://myactivity.google.com/ Google Services To no one you are more honest than to the search field of google. Privacy Why do we need privacy? ▶ „The right to be left alone.“ ▶ Free development of personality ▶ Control over the consequences of one's own actions ▶ Self-determination (who knows what about me) ▶ Protection against criticism and discrimination ▶ Security (passwords, property,...) ▶ Freedom ▶ Intimacy? ▷ IMPORTANT FOR THE INDIVIDUAL Why does a society need privacy? ▶ Important -
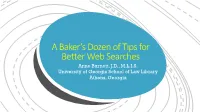
A Baker's Dozen of Tips for Be Er Web Searches
A Baker’s Dozen of Tips for Beer Web Searches Anne Burnett, J.D., M.L.I.S. University of Georgia School of Law Library Athens, Georgia Lawyers use the § ABA Tech Report 2019 web for legal § 90% use free online resources research either regularly or occasionally When to use free resources § If item(s) likely to be freely available § If starting with free & switching to When do subscription for supplemental lawyers use the material will save $$$ web for § If time spent on free doesn’t outweigh research? $$ spent on paid § Recent primary legal information § Government information What is free § Company and directory information web good for? § Information about individuals § Reference information and statistics § Comprehensive sites--collecting all relevant material, from all jurisdictions § High quality, reliable secondary sources What is not § Annotated codes, cases with available? headnotes § Sophisticated citator services, such as Shepard's or KeyCite § Older materials The Tips Use Quotation Marks • Phrase searching • “consumer protection” #1 Can I Quote You? • “John F. Kennedy” • Single word in precise form • “childcare” ≠ “child care” Space = AND Google and Bing recognize OR Minus sign excludes terms • RICO –Puerto #2 • Vikings –football –team Smooth Operators AROUND(x) – proximity operator • John AROUND(2) Kennedy • John F. Kennedy • John Fitzgerald Kennedy • John Kennedy • Kennedy, John F. Limit by • Domain: .edu, .org., .gov, .int, -.com, .de • File type: .pdf, .com, .ppt, .xls • Language #3 • Country Learn Your Limits • Last update