Jahresbericht 2015 INHALTSVERZEICHNIS
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
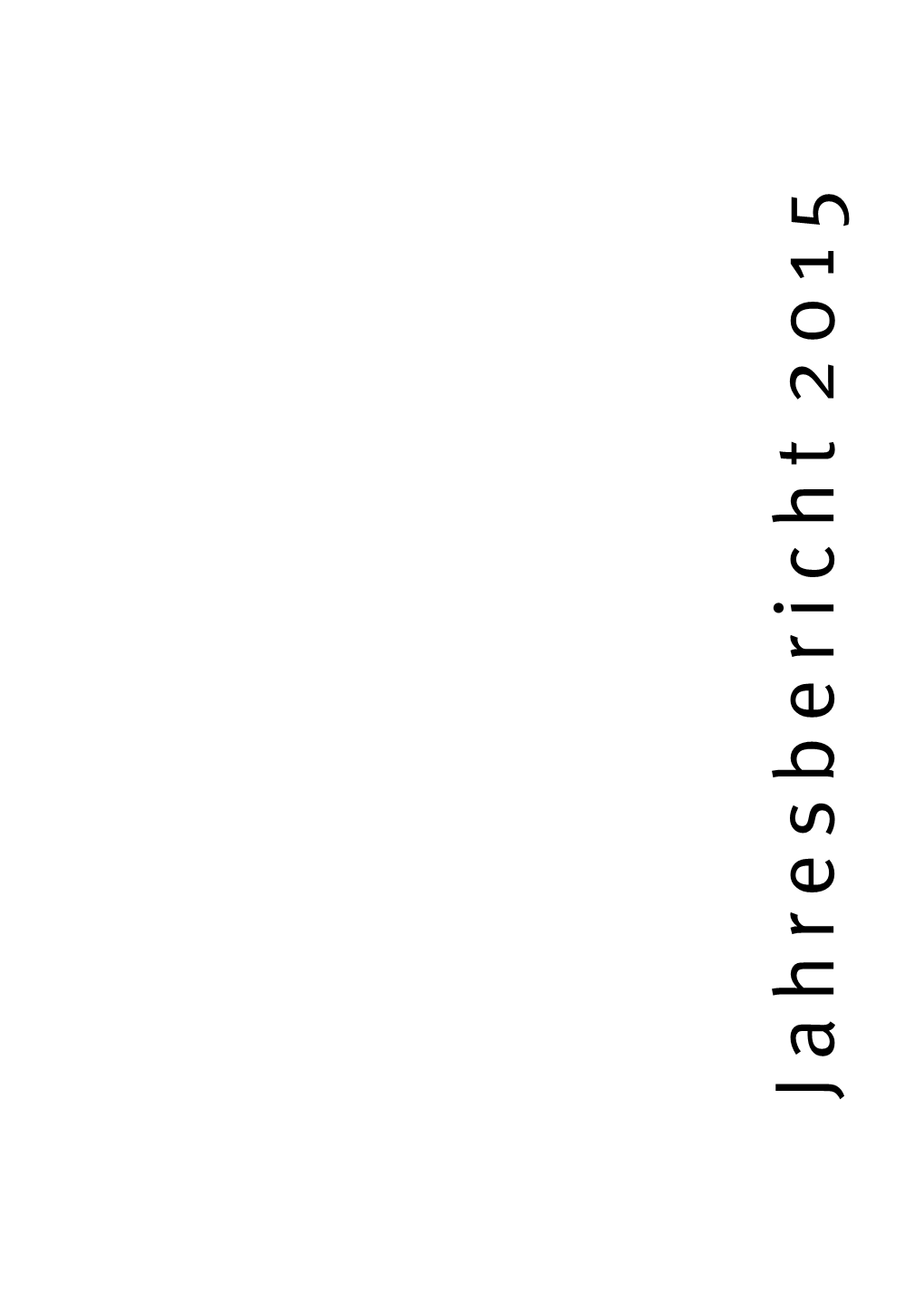
Load more
Recommended publications
-

Dr. Antonio Calcagno Department of Philosophy King's University
Dr. Antonio Calcagno Department of Philosophy King’s University College 266 Epworth Avenue London, Ontario N6A 2M3 [email protected] PUBLICATIONS SUMMARY: 4 refereed books; 11 refereed edited books; 4 special refereed journal issues; 65 refereed articles; 13 invited articles, 43 book reviews; 5 book translations, 10 article translations REFEREED BOOKS 4. Antonio Calcagno, Lived Experience from the Inside Out: Social and Political Philosophy in Edith Stein, (Pittsburgh: Duquesne University Press: 2014), xvi + 231pp. Winner of the Edward Goodwin Ballard Book Prize in Phenomenology for best book in Phenomenology 2014. 3. Antonio Calcagno, Badiou and Derrida: Politics, Events and Their Time (New York/London: Continuum, 2007), viii + 136 pp. 2. Antonio Calcagno, The Philosophy of Edith Stein (Pittsburgh: Duquesne University Press, 2007), xv + 151 pp. Selected by Choice for public libraries. 1. Antonio Calcagno, Giordano Bruno and the Logic of Coincidence: Unity and Multiplicity in the Philosophical Thought of Giordano Bruno in Renaissance and Baroque Studies, vol. 23 (Frankfurt: Peter Lang, 1998), 233 pp. SERIES EDITOR: 2019– Continental Philosophy and the History of Thought Series, Lexington Books at Rowman and Littlefield. Series edited with Christian Lotz. REFEREED EDITED BOOKS 11. Edith Stein’s Investigation Concerning the State: Sociality, Nationhood, Ethics, eds. Eva Reyes-Gacitúa and Antonio Calcagno, in series Contributions to Phenomenology (Dordrecht: Springer, forthcoming). 10. Gerda Walther’s Phenomenology of Sociality, Psychology, and Religion, ed. Antonio Calcagno, in series History of Women Philosophers and Scientists (Dordrecht: Springer, 2018). DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-97592-4. 9. Roberto Esposito: Biopolitics and Philosophy, eds. Inna Viriasova and Antonio Calcagno (Albany, NY: State University of New York Press, 2018). -

Das Projekt Der Aufklärung
Das Projekt der Aufklärung Das Projekt der Aufklärung Philosophisch-theologische Debatten von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart Walter Sparn zum 75. Geburtstag Herausgegeben von Joar Haga, Sascha Salatowsky, Wilhelm Schmidt-Biggemann und Wolfgang Schoberth EVANGELISCHE VERLAGSANSTALT Leipzig Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2018 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig Printed in Germany Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt. Cover: Zacharias Bähring, Leipzig Satz: Stephan Mikusch, Erlangen Druck und Binden: Hubert & Co., Göttingen ISBN 978-3-374-05183-0 www.eva-leipzig.de Danksagung Zum 75. Geburtstag von Walter Sparn fand am 18. und 19. November 2016 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der langjährigen Wirkungs- stätte des Jubilars, das Kolloquium »Das Projekt der Aufklärung. Philosophisch- theologische Debatten von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart« statt. Viele Weggefährtinnen und Weggefährten waren unserem Aufruf gefolgt, persönlich -
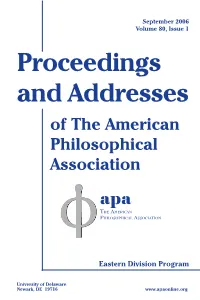
Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association
September 2006 Volume 80, Issue 1 Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association apa The AmericAn PhilosoPhicAl Association Eastern Division Program University of Delaware Newark, DE 19716 www.apaonline.org The American Philosophical Association Eastern Division One Hundred Third Annual Meeting Marriott Wardman Park Hotel Washington, DC December 27 - 30, 2006 Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association (ISSN 0065-972X) is published five times each year and is distributed to members of the APA as a benefit of membership and to libraries, departments, and institutions for $75 per year. It is published by The American Philosophical Association, 31 Amstel Ave., University of Delaware, Newark, DE 19716. Second-Class Postage Paid at Newark, DE and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Proceedings and Addresses, The American Philosophical Association, University of Delaware, Newark, DE 19716. Editor: David E. Schrader Phone: (302) 831-1112 Publications Coordinator: Erin Shepherd Fax: (302) 831-8690 Associate Editor: Richard Bett Web: www.apaonline.org Meeting Coordinator: Linda Smallbrook Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association, the major publication of The American Philosophical Association, is published five times each academic year in the months of September, November, January, February, and May. Each annual volume contains the programs for the meetings of the three Divisions; the membership list; Presidential Addresses; news of the Association, its Divisions and Committees, and announcements of interest to philosophers. Other items of interest to the community of philosophers may be included by decision of the Editor or the APA Board of Officers. -

Main Program 2015 Marion.Pdf
Breached Horizons: The Work of Jean-Luc Marion Jean-Luc Marion A Roman Catholic philosopher and theologian, Jean-Luc Marion is Professor Emeritus of Philosophy at the University Paris IV (La Sorbonne), Professor at the École Normale Supérieure, Paris, and holds the Andrew Thomas Greeley and Grace McNichols Greeley Chair of Catholic Studies at the Divinity School of the University of Chicago. In 2008, he was elected a member of the Académie Française. He is winner of the Prix Charles Lambert de l’Académie des sciences morales et politiques (1977), the 1992 Grand Prix de Philosophie de l’Académie Française, and the 2008 Karl-Jaspers Preis. He also won the Humboldt-Stiftung Prize in 2012. He was made a member of the Accademia dei Lincei, Rome, in 2010. In 2014, Jean-Luc Marion gave the Gifford Lectures. Jean-Luc Marion’s work provides both a philosophical and theological treatment of questions about the nature of God and His relation to the created world and human beings. Engaging contemporary French and German philosophy, especially phenomenology, Marion thinks God in terms of a pragmatic theology of absence. He considers God as a saturated phenomenon that exceeds the structures of mind, consciousness and intentionality. Understood as excess, God cannot be seen, known or spoken: God is an absence that breaches the horizons of our own thinking and being. Marion’s later works focus on rethinking the impact of this notion of God on the nature of love, especially love for God and neighbor. MAJOR WORKS • God Without Being (1991) • Reduction -

Il Chiasmo Della Traduzione: Metafora E Verità – in Effetti 226 6
MIMESIS / ESSERE E LIBERTÀ N. 25 Collana diretta da Claudio Ciancio COMITATO SCIENTIFICO: Gerardo Cunico (Università di Genova) Adriano Fabris (Università di Pisa) Giovanni Ferretti (Università di Macerata) Albert Franz (Technische Universität Dresden) Roberto Mancini (Università di Macerata) Giuseppe Nicolaci (Università di Palermo) Maurizio Pagano (Università del Piemonte Orientale) Ugo Perone (Università del Piemonte Orientale) Giuseppe Riconda (Università di Torino) Mario Ruggenini (Università di Venezia) Leonardo Samonà (Università di Palermo) Federico Vercellone (Università di Torino) Silvia Benso (Rochester University, USA) Brian Schroeder (Rochester University, USA) CARLA CANULLO IL CHIASMO DELLA TRADUZIONE Metafora e verità MIMESIS Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Macerata MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine) www.mimesisedizioni.it [email protected] Collana: Essere e libertà, n. 25 Isbn: 9788857540474 © 2017 – MIM EDIZIONI SRL Via Monfalcone, 17/19 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Phone: +39 02 24861657 / 24416383 INDICE PREMESSA 9 CAPITOLO PRIMO. TRADURRE 17 1. Dove si pone la questione 17 a. Un momento ermeneutico della ragione? 18 b. L’ermeneutica dopo la koinè 26 2. Una duplice de-regionalizzazione, ovvero: l’ampliamento dell’ermeneutica e della traduzione 34 3. Interpretazione e traduzione 43 4. Atque nihil grece dictum est, quod latine dici non possit! 54 5. Dalla traduzione come paradigma alla Veranschaulichung metaforale 61 6. Il senso di un percorso 70 CAPITOLO SECONDO. NEL LABIRINTO DELLA TRADUZIONE: IL POLEMOS TRADUTTIVO 73 1. Dal confl itto delle traduzioni al confl itto della traduzione 73 2. Un contatto senza chiasmo: teoremi per la traduzione vs poetica della traduzione 76 3. I contrasti dell’equivalenza 82 4. -

BENJAMIN, BONHOEFFER and CELAN Ugo Perone
THE RISKS OF THE PRESENT: BENJAMIN, BONHOEFFER AND CELAN Ugo Perone (Università del Piemonte Orientale) The following remarks try to trace a scenario of twentieth-century philosophy, which in my opinion shows a new interest in the issue of time. Many have underscored that nineteenth-century philosophy replaces the paradigm of Nature with that of History as an historical a priori in Foucault’s sense, that is, as the horizon within which the problems are to be located and solved. The issue of identifying the dominant nineteenth-century paradigm—further complicated by the declining resort to the great narratives of this “short century”—is still open, so I do not believe it improper to point out that many twentieth- century philosophers suddenly reconsidered the issue of time as a way of defining the nineteenth-century paradigm of time in a new manner. 1. Time in the Philosophy of the 20th Century The following remarks try to trace a scenario of twentieth-century philosophy, which in my opinion shows a new interest in the issue of time. Many have underscored that nineteenth-century philosophy replaces the paradigm of Nature with that of History as an historical a priori in Foucault’s sense, that is, as the horizon within which the problems are to be located and solved. The issue of identifying the dominant nineteenth-century paradigm—further complicated by the declining resort to the great narratives of this “short century”—is still open, so I do not believe it improper to point out that many twentieth- century philosophers suddenly reconsidered the issue of time as a way of defining the nineteenth-century paradigm of time in a new manner. -

Philosophical Readings
PHILOSOPHICAL READINGS ONLINE JOURNAL OF PHILOSOPHY Editor: Marco Sgarbi Volume IX – Issue 1 – 2017 ISSN 2036-4989 Special Issue: The Wisdom of the Ancients. The German-Jewish Revaluation of Ancient Philosophy Guest Editors: Anna Romani and Fabio Fossa ARTICLES Platos’ Republic: The Limits of Politics Catherine H. Zuckert ............................................................................................................1 A Lesson in Politics: Some Remarks on Leo Strauss' Socrates and Aristophanes Marco Menon ........................................................................................................................6 Plato, Arendt and the Conditions of Politics Luca Timponelli....................................................................................................................12 Leo Strauss on Returning: Some Methodological Aspects Philipp von Wussow .............................................................................................................18 Back to the Roots. The Correspondence Between Leo Strauss and Jacob Klein David Janssens....................................................................................................................25 Repetition of Antiquity at the Peak of Modernity as Phenomenological Problem Iacopo Chiaravalli..............................................................................................................31 Progress as a Problem: Strauss and Löwith in Dialogue between Antiquity and Modernity Anna Romani .......................................................................................................................37 -

Spaziofilosofico 2/2016
© SpazioFilosofico 2016 – ISSN: 2038-6788 SPAZIOFILOSOFICO 2/2016 Fondatori Enrico Guglielminetti Luciana Regina Editorial Board Enrico Guglielminetti (Direttore) Erica Benner Silvia Benso Edward S. Casey Gianfranco Dalmasso Susan Haack Ágnes Heller Simo Knuuttila Thomas Macho Ugo Perone Luciana Regina John Sallis Brian Schroeder Bernhard Waldenfels Jason M. Wirth Palle Yourgrau Editorial Advisory Board Teodolinda Barolini Peter Dahler-Larsen Mario Dogliani Jennifer Greene Hans Joas John D. Lyons Angelo Miglietta Angelo Pichierri Notger Slenczka Francesco Tuccari Redazione Ezio Gamba Comunicazione e Stampa Alessandra Mazzotta Progetto Grafico Filippo Camedda © 2016 SpazioFilosofico Tutti i diritti riservati ISSN: 2038-6788 172 © SpazioFilosofico 2016 – ISSN: 2038-6788 Gli articoli Della rivista sono sottoposti a blinD review. La pubblicazione è suborDinata per ogni articolo all’approvazione dei valutatori anonimi esterni alla direzione e all’accoglimento di eventuali richieste di revisione. 173 © SpazioFilosofico 2016 – ISSN: 2038-6788 SPAZIOFILOSOFICO 2/2016 GRAZIA a cura di Alessandra Cislaghi © SpazioFilosofico 2016 – ISSN: 2038-6788 INDICE A. CISLAGHI, Charme e chance. Editoriale 181 A. CISLAGHI, Charm and chance. Editorial 183 TEORIA A. CISLAGHI, Charis, Kairós. La riuscita della grazia 187 (E. COZZI, Appendice: Kairós: un rilievo dell’XI secolo a Torcello) E. GUGLIELMINETTI, Filling the Void or Filling the Full? On the Concept of Grace 201 L. ŠKOF, An Interval of Grace: The Time of Ethics 211 M. CACCIARI, Oltre il dono 225 U. PERONE, L’artificio della grazia. Il sogno infranto della modernità 231 L. IRIGARAY, Il toccare della grazia 239 POLITICHE R. MANCINI, Invece del sacrificio: lo scandalo della grazia 251 PRATICHE M. CAROU, El mate, o la cotidianeidad de charis y kairós en la América profunda 263 B. -

A Proposition About Spatio-Temporal Assumptions and Novelty
INTERGENERATIONAL EFFECTUATION OF FUTURE-DIRECTED DECISIONS: A PROPOSITION ABOUT SPATIO-TEMPORAL ASSUMPTIONS AND NOVELTY A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI`I AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN POLITICAL SCIENCE DECEMBER 2014 By Michael Francis Miller Thesis Committee: Jairus Victor Grove, Chairperson James Allen Dator Jenifer Sunrise Winter Keywords: futures thinking, future-directed decision making, spatio-temporal assumptions, emergence of novelty, intergenerational change Table of Contents Preface …………………………………………………………………………………………… 3 Chapter 1. Introduction ………………………………………………………………………….. 5 Chapter 2. Proposition …………………………………………………………………………… 7 Chapter 3. Methodology ……………………………………………………………………….... 9 Chapter 4. Monadic-Motion-Relation Theory …………………………………………………. 11 Noise, Sequencing and Pathways ………………………………………………………. 16 Problem of Wholeness …………………………………………………………………. 20 Problem of Reality ……………………………………………………………………… 20 Problem of Monads …………………………………………………………………….. 24 Problem of Motion ………………………………………………………………………25 Problem of Relations …………………………………………………………………… 30 Problem of Change ……………………………………………………………………... 30 Universal Spatio-Temporal Thought Collective ……………………………………….. 31 Reformational Anti-Spatio-Temporal Movement ……………………………………… 35 Chapter 5. Definition of the Future …………………………………………………………….. 37 The Futural Problem ………………………………………………………………….... 37 Futural Motion …………………………………………………………………………. 41 Chapter 6. Intergenerational Transmission -

Gennaio/Aprile 2013
Bollettino della Società Filosofica Italiana Rivista Quadrimestrale Nuova Serie n. 208 – gennaio/aprile 2013 Indice Studi e interventi G. Wolters, European Humanities in Times of Globalized Parochialism p. 3 E. Piergiacomi, A che serve venerarlo, se dio non fa nulla? Epicuro e il piacere della preghiera p. 19 V. Limone, La Trinità creatrice. Fichte, Hegel, Schelling interpreti di Giovanni p. 29 Didattica della filosofia M. Villani, Insegnare la solidarietà: indicazioni per un percorso didattico p. 43 M. Ariotti, Quali virtù proporre ai giovani di un possibile secolo XXI p. 63 P. Mancinelli, A scuola di filosofia. Infinito e mistero nella riflessione filosofica. Tentativo di percorso interdisciplinare p. 71 Convegni e informazioni p. 76 Le Sezioni p. 82 Recensioni p. 98 XXXVIII Congresso Nazionale della Società Filosofica Italiana Catania 31/10-2/11/2013 p. 109 1 S.F.I. Società Filosofica Italiana Sede Sociale: c/o ILIESI/CNR “Villa Mirafiori” - Via Nomentana, 118 - 00161 Roma Tel. Segr. tel. e Fax:++39.06.8604360; e-mail: [email protected] - web site: www.sfi.it CONSIGLIO DIRETTIVO Stefano Poggi (Presidente) Francesco Coniglione e Carlo Tatasciore (Vice-Presidenti) Enrico Berti, Francesca Brezzi, Clementina Cantillo, Giuseppe Cosentino, Ennio De Bellis, Giuseppe Giordano, Elio Matassi, Ugo Perone, Renato Pettoello, Riccardo Pozzo, Bianca Maria Ventura Segretario-Tesoriere: Carla Guetti Bollettino della Società Filosofica Italiana Rivista quadrimestrale della S.F.I. Direttore: Stefano Poggi Redazione: Giuseppe Giordano ed Emidio Spinelli (Coordinatori) Paola Cataldi, Francesco Verde Sede, Amministrazione, Redazione: c/o ILESI/CNR “Villa Mirafiori” - Via Carlo Fea, 2 - 00161 Roma Stampa: Stampadiretta - via Borrello, 34 - 95124 Catania I contributi destinati alla pubblicazione vengono preventivamente sottoposti a procedura di peer review. -

The Possible Present He Has Been Assessore Alla Cultura for the Province of Turin
INTRODUCTION Struggling with the Angel Finitude, Time, and Metaphysical Sentiment Ugo Perone is one of the most lively, productive, and original contem- porary Italian philosophers. Born in Turin in 1945 and educated at the University of Turin under the guidance of Italy’s greatest hermeneutician, Luigi Pareyson, Perone was schooled in the study of Secrétan, Schiller, Feuerbach, Benjamin, and Descartes in addition to other major philoso- phers (especially Hegel, Schelling, Kierkegaard, Husserl, Heidegger, and Merleau-Ponty) whose names constellate his numerous books. A contin- ual engagement with theology, most notably that of Barth, Bonhoeff er, and Bultmann, is also integral to Perone’s philosophical research, which in recent years has extended to a consideration of poetry (especially Celan) and narrative as areas capable of crucial philosophical contributions. Fol- lowing years spent in Germany (Munich, Freiburg, Berlin), since 1993 Perone has been Professor of Moral Philosophy at the Università del Piemonte Orientale in Vercelli. Perone’s philosophical activity has never been confi ned solely to the world of academia; he has always been an ambassador and promoter of culture and education within the wider public sphere. Founder and direc- tor of the prestigious Scuola d’Alta Formazione Filosofi ca (School of Higher Philosophical Education) in Turin, a postdoctoral institution that has seen the presence of famous philosophers such as Jean-Luc Marion, Dieter Henrich, John Searle, Charles Larmore, Agnes Heller, Emanuele Severino, and Jean-Luc Nancy, Perone has also played a fundamental role in the cultural life of Turin and the surrounding region. During most of the 1990s Perone was involved in the administration of his hometown, Turin, as assessore alla cultura; in 2001–2003 he was appointed clara fama director of the Italian Cultural Institute in Berlin; and since 2008 ix © 2011 State University of New York Press, Albany x the possible present he has been assessore alla cultura for the province of Turin.