Charles T. Studd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Pentecostal Missionary Union (PMU), a Case Study Exploring the Missiological Roots of Early British Pentecostalism (1909-1925)
The Pentecostal Missionary Union (PMU), a case study exploring the missiological roots of early British Pentecostalism (1909-1925) Item Type Thesis or dissertation Authors Goodwin, Leigh Publisher University of Chester Download date 29/09/2021 14:08:25 Link to Item http://hdl.handle.net/10034/314921 This work has been submitted to ChesterRep – the University of Chester’s online research repository http://chesterrep.openrepository.com Author(s): Leigh Goodwin Title: The Pentecostal Missionary Union (PMU), a case study exploring the missiological roots of early British Pentecostalism (1909-1925) Date: October 2013 Originally published as: University of Chester PhD thesis Example citation: Goodwin, L. (2013). The Pentecostal Missionary Union (PMU), a case study exploring the missiological roots of early British Pentecostalism (1909- 1925). (Unpublished doctoral dissertation). University of Chester, United Kingdom. Version of item: Submitted version Available at: http://hdl.handle.net/10034/314921 The Pentecostal Missionary Union (PMU), a case study exploring the missiological roots of early British Pentecostalism (1909-1925) Thesis submitted in accordance with the requirements of the University of Chester for the degree of Doctor of Philosophy by Leigh Goodwin October 2013 Thesis Contents Abstract p. 3 Thesis introduction and acknowledgements pp. 4-9 Chapter 1: Literature review and methodology pp.10-62 1.1 Literature review 1.2 Methodology Chapter 2: Social and religious influences on early British pp. 63-105 Pentecostal missiological development 2.1 Social influences affecting early twentieth century 2.1 Missiological precursors to the PMU’s faith mission praxis 2.2 Exploration of theological roots and influences upon the PMU Chapter 3: PMU’s formation as a Pentecostal faith mission pp. -
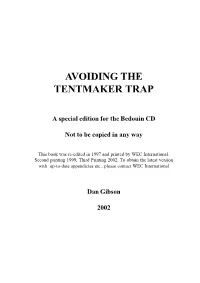
Avoiding the Tentmaker Trap
AVOIDING THE TENTMAKER TRAP A special edition for the Bedouin CD Not to be copied in any way This book was re-edited in 1997 and printed by WEC International. Second printing 1999, Third Printing 2002. To obtain the latest version with up-to-date appendicies etc., please contact WEC International Dan Gibson 2002 1 Chapter One Tom and Sue (A case study) Tom and Sue were excited. Their interest in missions had been growing for several years now and finally the pieces were falling together. Several weeks back Tom responded to an advert in a professional journal for a position in the Middle East and the reply was positive. The company wanted them in two weeks time! At first they were taken back by the suddenness of it all, but the company was adamant that they must come in two weeks or else someone else would fill the position. They spent a long evening together discussing the pro's and cons. Tom would have to quit his job at the plant. Sue would need to leave her work at the flower shop. It would mean leaving their church and close friends. That much seemed normal, although a little frightening. They had grown used to the security that comes from a steady job, income and the support of their church. But Sue was excited about the possibilities of missions. The more they discussed it the more excited they got. First of all they wouldn't have to join a mission organization. They were painfully aware of a young couple from their church who had spent several years trying to raise enough support for missions and then had fallen short and were now trying to sort their lives out. -

SERIE NUM° TITRE DU LIVRE AUTEUR Série a : Bibles, Dictionnaires Et Encyclopédies Série B : Canevas D'etude (CEB) Et Comment
BIBLIOTHEQUE DE PRÊT EGLISE de "LA BONNE NOUVELLE" 4, rue des Magasins - 67000 STRASBOURG LISTE DE TOUS LES LIVRES séries A à Q (classement par thème) Mise à jour en janvier 2013 Thèmes (cliquez sur le lien pour parvenir à chaque thème) Série A : Bibles, dictionnaires et encyclopédies Série B : Canevas d'EtUde (CEB) et commentaires bibliqUes Série C : Doctrine Série D : Evangélisation Série E : Vie chrétienne/Edification Série F : Biographies Série G : Romans chrétiens/poèmes Série H : Eglise/Histoire de l'Eglise Série J : JeUnesse Série K : Famille et édUcation Série L : Relation d'aide Série M : Témoignages Série N : Science et foi Série O : Divers et Histoire Série P : Sectes, religions et occultisme Série Q : QUestions de société Série A : Bibles, dictionnaires et encyclopédies Revenir à la page de présentation SERIE NUM° TITRE DU LIVRE AUTEUR A 1 EPITRES DE PAUL AUX ROMAINS - CORINTHIENS - GALATES - EPHESIENS BONNET A 2 EVANGILE DE JEAN et ACTES DES APOTRES BONNET A 3 EVANGILES DE MATTHIEU, MARC ET LUC BONNET A 4 DICTIONNAIRE DE LA BIBLE BOST J.A. A 5 EXPLICATION DE L'EPITRE AUX EPHESIENS MONOD A.L. A 6 INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT (Epîtres de Paul) - a - (= A 91) GODET Frédéric A 7 EVANGILE DE LUC - tome 1 GODET Frédéric A 8 EVANGILE DE LUC - tome 2 GODET Frédéric A 9 EVANGILE DE JEAN - tome 1 GODET Frédéric A 10 BIBLE (LA) - Tome 1 KAHN Zadoc A 11 ETUDES BIBLIQUES DUBOIS Ch. A 12 ETUDES BIBLIQUES - ANCIEN TESTAMENT - a - (= A 232) GODET Frédéric A 13 NEHEMIE - UN MESSAGE VIVANT ET ACTUEL AU PEUPLE DE DIEU -- A 14 EPITRES DE PAUL CRAMPON A. -

Lived Religion and the Changing Spirituality and Discourse of Christian Globalization: a Canadian Family's Odyssey
Lived Religion and the Changing Spirituality and Discourse of Christian Globalization: A Canadian Family’s Odyssey MARGUERITE VAN DIE Queen’s University Few individuals have presented a greater challenge to a secular society’s understanding of the past than the missionary. “Once almost universally acclaimed as a self-sacrificing benefactor, he or she is now more com- monly dismissed as an interfering busybody and in all probability a misfit at home who could find only among the colonized a captive audience on whom to impose a narrow set of beliefs and moral taboos.”1 Thankfully, in the three decades since this memorable characterization by Canadian church historian John Webster Grant, research into related areas such as gender and theological change has done much to deconstruct these stereotypes. Recent work on Christian globalization has moreover drawn attention to the ways the missionary enterprise changed religion not simply among the indigenous population, but also at home. Mark Noll, for example, has argued that by the early twentieth century as part of a larger global “multi-centering,” Christianity in North America was subtly shifting away from traditional church and imperial norms towards new models. It is now generally accepted that this re-centering was accompa- nied by an enormous release of evangelical energy, and the impact of an emerging global society profoundly reshaped Christianity.2 My essay builds on Noll’s observations, but rather than focusing on missionary institutions and their spokespersons, it examines from below some of the continuities and changes in the spirituality and discourse of Christian globalization. It does this within the context of three generations Historical Papers 2015: Canadian Society of Church History 114 Spirituality and Discourse of Christian Globalization of a well-to-do Toronto family for whom missions and international travel were a compelling way of life. -

Charles Thomas STUDD 1 Charles Thomas STUDD 1860-1931
Nos Ancêtres dans la foi : les évangéliques Charles Thomas STUDD 1 Charles Thomas STUDD 1860-1931 Premier Croisé de la WEC Chine-Indes-Congo Studd en 1929/30 Sommaire LA WEC : WORLDWIDE EVANGELIZATION FOR CHRIST CRUSADE ..................................................... 1 Studd, fondateur de la WEC ..................................................................................................................... 1 Charte des Croisés de l’Evangélisation Mondiale.................................................................................. 2 QUI ETAIT STUDD ? ........................................................................................................................... 2 Sa famille ................................................................................................................................................... 2 Sa conversion et sa consécration à Dieu ................................................................................................. 3 Les 3 champs missionnaires ou Studd a travaillé ................................................................................... 5 Un prédicateur aux images décapantes................................................................................................... 5 Recommandations missionnaires ............................................................................................................. 6 Regard de Studd sur les moments importants de sa vie.......................................................................... 7 Comment Priscilla -

Charles T. Studd, Iqpoitie
NSTRUCT OR Camel Caravans Carrying Merchandise From China's Outlying Regions to Peking EWING GALLOWAY. N. Y. Charles T. Studd, iqpoitie BOUT sixty years ago an el- hour or so, he went in. To his aston- evangeligt. As he was not intereelPd derly man was making his ishment, he found the stage occupied in religious things, the were A way toward the Kingstown by a large number of women and not familiar to him, alt e- harbor, near Dublin. He was a man men, and at the time of his entry a called several not very comp much interested in all sports, but espe- man with a wonderful voice was sing- Preferences to some evangelists jus cially in horse racing; and he had just ing a solo. He had never heard the recently arrived from America, and come from the famous Irish Derby. song before, and was much impressed thought that these must be the men. He wished to return to his home in by it. The words moved him greatly. He listened to the evangelist, and England by the cross-channel route, "There were ninety and nine that safely surely he had never heard anyone but, to his annoyance, found that the lay speak so impressively. He did not boat had just left. There was no In the shelter of the fold, leave Dublin by the next boat, as he alternative, therefore, but to remain But one was out on the hills away, had intended, but, stayed on diy after Far off from the gates of gold." overnight in Dublin. -
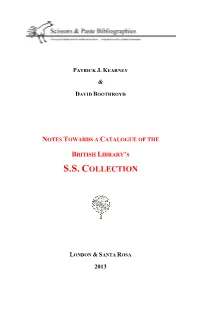
S.S. Collection
PATRICK J. KEARNEY & DAVID BOOTHROYD NOTES TOWARDS A CATALOGUE OF THE BRITISH LIBRARY ’S S.S. COLLECTION LONDON & SANTA ROSA 2013 Introduction The Discovery: The S.S. collection is an informally catalogued accumula- tion of books, periodicals and other material that has for a va- riety reasons, to be described below, been suppressed and is kept from public access. The first open discussion of the S.S. of any significance appeared in Peter Fryer’s Private Case, Public Scandal (1966), a marvellous little polemic that grew out of research he was doing towards a history of contraception. 1 Fryer found that a number of books he needed to refer to in the course of his work were kept in the British Library’s Private Case, their extensive erotica collection. 2 Unlike most other national or academic libraries that have erotic or obscene material on their shelves, the British Library did not include it in their General Catalogue, but did maintain a separate and effectively secret catalogue of it, a copy of which was kept at the issuing desk in the Reading Room. A reader who was persistent enough could find out if a book he wanted was in the Private Case, and pro- vided he could establish a good enough reason to see it would be given to him or her. 3 Below the level of the Private Case, though, Fryer found an even more closely guarded cache of books, which he be- came aware of when investigating Charles Bradlaugh M.P., a radical Victorian champion of woman’s suffrage and contra- ception, who was libelled in an 1888 biography of him by Charles R. -

Abide in Jesus Preise Für Deutschland Und Österreich: € 3,80; Ab 10 Stück € 2,00; Ab 50 Stück € 1,50 Zuzüglich Versandkosten
Abide in Jesus Preise für Deutschland und Österreich: € 3,80; ab 10 Stück € 2,00; ab 50 Stück € 1,50 zuzüglich Versandkosten für die Schweiz: CHF 5,70 In Jesus bleiben zuzüglich Versandkosten Bestellmöglichkeiten Deutschland Österreich und Deutschland Wertvoll leben, STA Shop AdventistBookCenter Im Kiesel 3 Bogenhofen D- 73635 Rudersberg / Württ. A-4963 St.Peter/Hart bei Braunau/Inn Tel. +49 (0) 7183 309 98 47 Tel. +43 (0) 2294000 Jesus Christ: www.wertvollleben.com, www.stashop.de www.adventistbookcenter.at E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] “Abide in me, and I in you.” Österreich Schweiz TOP LIFE Wegweiser-Verlag Advent-Verlag Krattigen Prager Str. 287 Leissigenstr.17 A-1210 Wien CH-3704 Krattigen Tel. +43 (0) 13199301-0 Tel. +41 33 654 1065, vormittags www.toplife-center.com Shop: www.av-buchshop.ch E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] HELMUT HAUBEIL 2 TABLE OF CONTENTS The Path to Complete Joy 7 ABIDE IN JESUS CHAPTER 1 JESUS’ MOST PRECIOUS GIFT “Abide in Me, and I in you.” Abiding in Christ means What does Jesus teach about the Holy Spirit? a constant receiving of His Spirit, Do you know Jesus’ most impressive message? a life of unreserved surrender to His service. What are the tasks of the Holy Spirit? E.G. White Desire of Ages, DA 676.2 25 CHAPTER 2 SURRENDER TO JESUS Abiding in Him is not a work that we have to do as a condition in What does surrender mean? Do I consequently lose my own will? order to enjoy His salvation. -

Charles Studd Pioneer Missionary
CHARLES STUDD PIONEER MISSIONARY PLEASE NOTE! The visuals for this series can be purchased from many CEF offices and online shops. For a list of CEF offices and online shops in Europe, please visit www.teachkids.eu and click on "Locations". Text: Roy Harrison Illustrated by: Tim Shirey Text published by: European CEF® Kilchzimmer 4438 Langenbruck Switzerland www.cefeurope.com UK publisher: WEC Publications Bulstrode Oxford Road Gerrards Cross Bucks SL9 8SZ England ISBN 0 900828 55 9 Copyright © 2005 European Child Evangelism Fellowship® All rights reserved worldwide. May be reproduced for personal, nonprofit and non-commercial uses only. Visit www.teachkids.eu for full details of permission. Charles Studd Table of contents Lesson Page Introduction 3 Lesson 1 A life given over to Christ 5 Lesson 2 Charles obeys God’s call 11 Lesson 3 Missionaries in China 17 Lesson 4 New steps of faith 23 Lesson 5 Taking the Gospel to Africa and the world 29 Summary of steps for counselling the child who wants to come to Christ 34 2 Introduction Charles Studd was totally surrendered to the Lord. He gave up home, wealth, comfort and family for Christ. The goal of his life was the glory of God in the evangelisation of the unreached. He was human. He had his weaknesses. But he set an example in his burning love for the Lord and for the lost. This missionary story was written to encourage Christian boys and girls to be witnesses for Christ where they are, and to seek God’s will about becoming missionaries. The need today is great. -

Pontifícia Universidade Católica Do Paraná Escola De Educação E Humanidades Pós-Graduação Em Teologia Stricto Sensu Mestrado
1 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ ESCOLA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA STRICTO SENSU MESTRADO PEDRO CARLOS ARAÚJO SOUZA A DIMENSÃO PNEUMATOLÓGICA DA IGREJA: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA IGREJA BATISTA NO BRASIL CURITIBA 2018 2 PEDRO CARLOS ARAÚJO SOUZA A DIMENSÃO PNEUMATOLÓGICA DA IGREJA: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA IGREJA BATISTA NO BRASIL Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Teologia, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC- PR), como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Teologia. Orientador: Prof. Dr. Marcial Maçaneiro CURITIBA 2018 3 Dados da Catalogação na Publicação Pontifícia Universidade Católica do Paraná Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBI/PUCPR Biblioteca Central SOUZA, Pedro Carlos Araújo. A dimensão pneumatológica da igreja: um estudo na perspectiva da Igreja Batista no Brasil / Pedro Carlos Araújo Souza; Orientador: Prof. Dr. Marcial Maçaneiro. – 2018. 110f.; 30 Cm. Dissertação (Programa de Mestrado em Teologia). Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), 2018. 1. Anabatistas. 2. Batistas. 3. Pneumatologia. 4. Eclesiologia. 5. Pentecostal. I. Pedro Carlos Araújo Souza. II. Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). III. Título. 4 5 Todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. Billy Grahan (in memorian). 6 Dedico esse trabalho primeiramente a Deus, após, às pessoas e instituições citadas. Minha gratidão a todos, pelo apoio nessa caminhada. 7 AGRADECIMENTOS A Deus, pela Sua presença constante em minha vida, que pela Sua graça e misericórdia permitiu-me escrever e concluir esta dissertação. Ao meu Orientador, Prof. Dr. Marcial Maçaneiro, pela oportunidade em orientar- me no desenvolvimento deste trabalho. -

Misión Global
MISIÓN GLOBAL Tabla de contenido Introducción Prefacio Parte I – Biblia y Misión 1. Qué involucra el llamado misionero – Robert E. Speer 2. Todo el Evangelio para todas las etnias – Rigoberto Diguero 3. Nuestro Dios misionero – Pedro Larson 4. La misión cristiana en el Nuevo Testamento – David E. Ramos 5. El propósito de la iglesia local – Carlos Van Engen 6. Por qué sembrar iglesias – Carlos Van Engen 7. Rumbo a la misión (Bernabé) – Levi DeCarvalho 8. Misionología de Romanos – Carlos González 9. Discipulado y misión – Levi DeCarvalho Parte II – Historia y Misión 10. Diez épocas de la historia cristiana – Ralph D. Winter 11. Historia de la transformación – Paul E. Pierson 12. Sociedades Misioneras – Andrew F. Walls 13. Expansión secuencial del Cristianismo – Andrew Walls 14. Las tesis de Pierson – Levi DeCarvalho Parte III – Cultura y Misión 15. Puentes de Dios – Donald McGavran 16. Aspectos culturales en la misión – Levi DeCarvalho 17. Observando a Juanito: Cómo aprender un idioma – David Rising 18. El aprendizaje del idioma es comunicación… es ministerio – Brewster y Brewster 19. Principios de adaptación cultural – Levi DeCarvalho 20. Cosmovisión y misión cristiana – Levi DeCarvalho Parte IV- Estrategia y Misión 21. La iglesia y las organizaciones para eclesiásticas – José Cruz 22. La relación iglesia y agencia misionera – Edison Queiroz 23. El complejo de langosta – Federico A. Bertuzzi 24. Conversión en grupo – A. L. Warnshuis 25. Hechos 2:8 debe ir de la mano con Hechos 1:8 – Pedro Samuel Pablo 26. Mujeres y misión – Sonia Acuña y Elva Elisa Ayala G. 27. Los cuatro pasos de la obra misionera – Levi DeCarvalho 28. -

Christian Citizenship and the Foreign Work of the Ymca
CHRISTIAN CITIZENSHIP AND THE FOREIGN WORK OF THE YMCA By REBECCA ANN HODGES A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in HISTORY in the Graduate Division of the UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY COMMITTEE IN CHARGE: Professor Rebecca McLennan, Chair Professor David Henkin Professor Wendy Brown SUMMER 2017 1 Copyright 2017 by Rebecca Ann Hodges All Rights Reserved 1 ABSTRACT CHRISTIAN CITIZENSHIP AND THE FOREIGN WORK OF THE YMCA by Rebecca Ann Hodges Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Rebecca McLennan, Chair Beginning in the last decade of the nineteenth century, Christian reformers of the North American Young Men’s Christian Association and related organizations set themselves the task of training the rising leadership of nations around the world in a set of ideals they termed “Christian citizenship.” Motivated by ideas about God’s universal grace, by liberal ideals of personhood, and by fears of moral crisis, the middle class evangelical reformers of the YMCA, the YWCA, the Student Volunteer Movement (SVM), and the World’s Student Christian Federation (WSCF) sought not only to “evangelize the world in this generation,” but to teach good citizenship and encourage fair play among individuals and among nations—to foster ideals of justice, equality, and democracy among their constituencies in China, Japan, India, and beyond, in a millennial project ultimately designed to save the world, politically as well as spiritually. From the 1890s into the 1920s, Christian reformers dedicated themselves to the work of imparting the ideals of “Christian citizenship” through educational, social, and religious programs, as well as through training in sports and sportsmanship.