Jahresbericht 2014 (PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Pulitzer Prizes for International Reporting in the Third Phase of Their Development, 1963-1977
INTRODUCTION THE PULITZER PRIZES FOR INTERNATIONAL REPORTING IN THE THIRD PHASE OF THEIR DEVELOPMENT, 1963-1977 Heinz-Dietrich Fischer The rivalry between the U.S.A. and the U.S.S.R. having shifted, in part, to predomi- nance in the fields of space-travel and satellites in the upcoming space age, thus opening a new dimension in the Cold War,1 there were still existing other controversial issues in policy and journalism. "While the colorful space competition held the forefront of public atten- tion," Hohenberg remarks, "the trained diplomatic correspondents of the major newspa- pers and wire services in the West carried on almost alone the difficult and unpopular East- West negotiations to achieve atomic control and regulation and reduction of armaments. The public seemed to want to ignore the hard fact that rockets capable of boosting people into orbit for prolonged periods could also deliver atomic warheads to any part of the earth. It continued, therefore, to be the task of the responsible press to assign competent and highly trained correspondents to this forbidding subject. They did not have the glamor of TV or the excitement of a space shot to focus public attention on their work. Theirs was the responsibility of obliging editors to publish material that was complicated and not at all easy for an indifferent public to grasp. It had to be done by abandoning the familiar cliches of journalism in favor of the care and the art of the superior historian .. On such an assignment, no correspondent was a 'foreign' correspondent. The term was outdated. -

STUDY GUIDE Prepared by Maren Robinson, Dramaturg
by Susan Felder directed by William Brown STUDY GUIDE Prepared by Maren Robinson, Dramaturg This Study Guide for Wasteland was prepared by Maren Robinson and edited by Kerri Hunt and Lara Goetsch for TimeLine Theatre, its patrons and educational outreach. Please request permission to use these materials for any subsequent production. © TimeLine Theatre 2012 — STUDY GUIDE — Table of Contents About the Playwright ........................................................................................ 3 About the Play ................................................................................................... 3 The Interview: Susan Felder ............................................................................ 4 Glossary ............................................................................................................ 11 Timeline: The Vietnam War and Surrounding Historical Events ................ 13 The History: Views on Vietnam ...................................................................... 19 The Context: A New Kind of War and a Nation Divided .............................. 23 Prisoners of War and Torture ......................................................................... 23 Voices of Prisoners of War ............................................................................... 24 POW Code of Conduct ..................................................................................... 27 Enlisted vs. Drafted Soldiers .......................................................................... 28 The American -

Jean Anderson Papers, 1894-1983
Jean Anderson Papers, 1894-1983 MSS 41 Overview Creator: Jean Anderson Title: Jean Anderson Papers Collection Number: MSS 41 Collection Dates: 1894-1983 Size: 2 boxes Accession #: 2016.69 Repository: Hanover College Archives Duggan Library 121 Scenic Drive Hanover, Indiana 47243-0287 Phone: (812) 866-7181 [email protected] Collection Information: Scope and Content Note The Jean Anderson Papers documents the life and career of Jean Anderson from 1894- 1983. The collection includes materials related to her work as a French professor at Hanover College; her father Henry Anderson; her niece Ann Steinbrecher Windle; her personal and family life; her travels to Europe; Hanover College; Indiana history; family history. Documents includes correspondence, travel diaries, and newspaper clippings. Other topics include Hanover, Indiana in the Civil War, World War I, World War II, Adolf Hitler, and the Shewsbury-Windle House. Historical Information Jean Jussen Anderson was born in Chicago, Illinois on 18 August 1887 to Henry and Anna Jussen Anderson. She worked as a professor of French at Hanover College from 1922-1952. Anderson died in Madison, Indiana on 17 December 1977. Administrative Information: Related Items: Related materials may be found by searching the Hanover College online catalog. Acquisition: Donated by Historic Madison, Inc., 2016 2/18 Jean Anderson Papers MSS 41 Property rights and Usage: This collection is the property of Hanover College. Obtaining permission to publish or redistribute any copyrighted work is the responsibility of the author and/or publisher. Preferred Citation: [identification of item], Jean Anderson Papers, MSS 41, Hanover College Finding Aid Updated: 4/19/2019 Container List Box Folder Folder Title Date Notes Jean Anderson; New York City, New York; S.S. -

Forty-Two Years and the Frequent Wind: Vietnamese Refugees in America
FORTY-TWO YEARS AND THE FREQUENT WIND: VIETNAMESE REFUGEES IN AMERICA Photography by Nick Ut Exhibition Curator: Randy Miller Irene Carlson Gallery of Photography August 28 through October 13, 2017 A reception for Mr. Ut will take place in the Irene Carlson Gallery of Photography, 5:00 – 6:00 p.m. Thursday, September 21, 2017 Nick Ut Irene Carlson Gallery of Photography FORTY-TWO YEARS AND THE FREQUENT WIND: August 28 – October 13, 2017 VIETNAMESE REFUGEES IN AMERICA About Nick Ut… The second youngest of 11 siblings, Huỳnh Công (Nick) Út, was born March 29, 1951, in the village of Long An in Vietnam’s Mekong Delta. He admired his older brother, Huynh Thanh My, who was a photographer for Associated Press, and who was reportedly obsessed with taking a picture that would stop the war. Huynh was hired by the AP and was on assignment in 1965 when he and a group of soldiers he was with were overrun by Viet Cong rebels who killed everyone. Three months after his brother’s funeral, Ut asked his brother’s editor, Horst Faas, for a job. Faas was reluctant to hire the 15-year-old, suggesting he go to school, go home. “AP is my home now,” Ut replied. Faas ultimately relented, hiring him to process film, make prints, and keep the facility clean. But Ut wanted to do more, and soon began photographing around the streets of Saigon. "Then, all of a sudden, in 1968, [the Tet Offensive] breaks out," recalls Hal Buell, former AP photography director. "Nick had a scooter by then. -
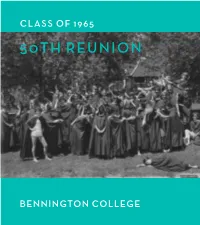
Class of 1965 50Th Reunion
CLASS OF 1965 50TH REUNION BENNINGTON COLLEGE Class of 1965 Abby Goldstein Arato* June Caudle Davenport Anna Coffey Harrington Catherine Posselt Bachrach Margo Baumgarten Davis Sandol Sturges Harsch Cynthia Rodriguez Badendyck Michele DeAngelis Joann Hirschorn Harte Isabella Holden Bates Liuda Dovydenas Sophia Healy Helen Eggleston Bellas Marilyn Kirshner Draper Marcia Heiman Deborah Kasin Benz Polly Burr Drinkwater Hope Norris Hendrickson Roberta Elzey Berke Bonnie Dyer-Bennet Suzanne Robertson Henroid Jill (Elizabeth) Underwood Diane Globus Edington Carol Hickler Bertrand* Wendy Erdman-Surlea Judith Henning Hoopes* Stephen Bick Timothy Caroline Tupling Evans Carla Otten Hosford Roberta Robbins Bickford Rima Gitlin Faber Inez Ingle Deborah Rubin Bluestein Joy Bacon Friedman Carole Irby Ruth Jacobs Boody Lisa (Elizabeth) Gallatin Nina Levin Jalladeau Elizabeth Boulware* Ehrenkranz Stephanie Stouffer Kahn Renee Engel Bowen* Alice Ruby Germond Lorna (Miriam) Katz-Lawson Linda Bratton Judith Hyde Gessel Jan Tupper Kearney Mary Okie Brown Lynne Coleman Gevirtz Mary Kelley Patsy Burns* Barbara Glasser Cynthia Keyworth Charles Caffall* Martha Hollins Gold* Wendy Slote Kleinbaum Donna Maxfield Chimera Joan Golden-Alexis Anne Boyd Kraig Moss Cohen Sheila Diamond Goodwin Edith Anderson Kraysler Jane McCormick Cowgill Susan Hadary Marjorie La Rowe Susan Crile Bay (Elizabeth) Hallowell Barbara Kent Lawrence Tina Croll Lynne Tishman Handler Stephanie LeVanda Lipsky 50TH REUNION CLASS OF 1965 1 Eliza Wood Livingston Deborah Rankin* Derwin Stevens* Isabella Holden Bates Caryn Levy Magid Tonia Noell Roberts Annette Adams Stuart 2 Masconomo Street Nancy Marshall Rosalind Robinson Joyce Sunila Manchester, MA 01944 978-526-1443 Carol Lee Metzger Lois Banulis Rogers Maria Taranto [email protected] Melissa Saltman Meyer* Ruth Grunzweig Roth Susan Tarlov I had heard about Bennington all my life, as my mother was in the third Dorothy Minshall Miller Gail Mayer Rubino Meredith Leavitt Teare* graduating class. -

Unquiet American: Malcolm Browne in Saigon, 1961–65
THE UNQUIET AMERICAN: Malcolm Browne in Saigon, 1961–65 The Unquiet American: Malcolm Browne in Saigon, 1961–65, other invidious means to impede reporting he perceived Browne’s photograph of the self-immolation of Thich an exhibit drawn from The Associated Press Corporate as critical of his government. Meanwhile, the White House Quan Duc, taken on June 11, 1963, led President John F. From left: Archives, honors the courageous journalism of Malcolm and Pentagon provided little information to reporters and Kennedy to reappraise U.S. support of Diem. After Diem’s Malcolm Browne at work in New York as a chemist for the Foster D. Snell Browne (1931–2012) during the early years of the Vietnam pressured them for favorable coverage of both the political murder on Nov. 1, 1963, in a coup that most probably had Co. in 1953, before his induction into the military and subsequent career War. While Browne was reporting a war being run largely and military situations. the administration’s tacit approval, Browne provided an in journalism. covertly by the White House, the CIA and the Pentagon, unmatched account of Diem’s final hours that received PHOTO COURTESY LE LIEU BROWNE he was waging his own battles in another: the war against Browne arrived in Saigon on Nov. 7, 1961, joining Vietnamese tremendous play. For his breaking news stories and his Associated Press General Manager Wes Gallagher, left, walks with AP journalists. Meanwhile, he accompanied U.S. advisers colleague Ha Van Tran. The bureau soon acquired two astute analysis of a war in the making, Browne won the correspondent Malcolm Browne in Saigon upon Gallagher’s arrival, March 20, by helicopter into the countryside seeking the latest formidable additions, correspondent Peter Arnett and Pulitzer Prize for international reporting in 1964. -

The Hannay Family by Col. William Vanderpoel Hannay
THE HANNAY FAMILY BY COL. WILLIAM VANDERPOEL HANNAY AUS-RET LIFE MEMBER CLAN HANNAY SOCIETY AND MEMBER OF THE CLAN COUNCIL FOUNDER AND PAST PRESIDENT OF DUTCH SETTLERS SOCIETY OF ALBANY ALBANY COUNTY HISTORICAL ASSOCIATION COPYRIGHT, 1969, BY COL. WILLIAM VANDERPOEL HANNAY PORTIONS OF THIS WORK MAY BE REPRODUCED UPON REQUEST COMPILER OF THE BABCOCK FAMILY THE BURDICK FAMILY THE CRUICKSHANK FAMILY GENEALOGY OF THE HANNAY FAMILY THE JAYCOX FAMILY THE LA PAUGH FAMILY THE VANDERPOEL FAMILY THE VAN SLYCK FAMILY THE VANWIE FAMILY THE WELCH FAMILY THE WILSEY FAMILY THE JUDGE BRINKMAN PAPERS 3 PREFACE This record of the Hannay Family is a continuance and updating of my first book "Genealogy of the Hannay Family" published in 1913 as a youth of 17. It represents an intensive study, interrupted by World Wars I and II and now since my retirement from the Army, it has been full time. In my first book there were three points of dispair, all of which have now been resolved. (I) The name of the vessel in which Andrew Hannay came to America. (2) Locating the de scendants of the first son James and (3) The names of Andrew's forbears. It contained a record of Andrew Hannay and his de scendants, and information on the various branches in Scotland as found in the publications of the "Scottish Records Society", "Whose Who", "Burk's" and other authorities such as could be located in various libraries. Also brief records of several families of the name that we could not at that time identify. Since then there have been published two books on the family. -

IMMF 13 Bios Photogs.Pdf (188
Index of photographers and artists with lot numbers and short biographies Anderson, Christopher (Canada) - Born in British Columbia 1971). He had been shot in the back of the head. in 1970, Christopher Anderson also lived in Texas and Colorado In Lots 61(d), 63 (d), 66(c), 89 and NYC. He now lives in Paris. Anderson is the recipient of the Robert Capa Gold Medal. He regularly produces in depth photographic projects for the world’s most prestigious publica- Barth, Patrick (UK) Patrick Barth studied photography at tions. Honours for his work also include the Visa d’Or in Newport School of Art & Design. Based in London, he has been Perpignan, France and the Kodak Young Photographer of the working since 1995 as a freelance photographer for publications Year Award. Anderson is a contract photographer for the US such as Stern Magazine, the Independent on Sunday Review, News & World Report and a regular contributor to the New Geographical Magazine and others. The photographs in Iraq York Times Magazine. He is a member of the photographers’ were taken on assignment for The Independent on Sunday collective, VII Agency. Review and Getty Images. Lot 100 Lot 106 Arnold, Bruno (Germany) - Bruno Arnold was born in Bendiksen Jonas (Norway) 26, is a Norwegianp photojournal- Ludwigshafen/Rhine (Germany) in 1927. Journalist since 1947, ist whose work regularly appears in magazines world wide from 1955 he became the correspondent and photographer for including GEO, The Sunday Times Magazine, Newsweek, and illustrated magazines Quick, Revue. He covered conflicts and Mother Jones. In 2003 Jonas received the Infinity Award from revolutions in Hungary and Egypt (1956), Congo (1961-1963), The International Centre of Photography (ICP) in New York, as Vietnam, Cambodia, Laos (1963-1973), Biafra (1969-1070), well as a 1st prize in the Pictures Of the Year International Israel (1967, 1973, 1991, 1961 Eichmann Trial). -

L-G-0003024000-0005815489.Pdf
Margrid Bircken / Andreas Degen (Hg.) Reizland DDR Deutungen und Selbstdeutungen literarischer West-Ost-Migration Mit 5 Abbildungen V&R unipress Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-8471-0255-7 ISBN 978-3-8470-0255-0 (E-Book) Mit freundlicher Unterstützung des Literaturforums im Brecht-Haus. 2015, V&R unipress in Göttingen / www.vr-unipress.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Printed in Germany. Titelbild: Berliner Mauer, Straße des 17. Juni (Tiergarten), Sektorengrenze am Brandenburger Tor, Neu aufgestellte Telefonzellen. Landesarchiv Berlin / Schütz, Gert; F Rep. 290, Nr. 0067647. Druck und Bindung: CPI buchbuecher.de GmbH, Birkach Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. Helmut Peitsch zum 65. Geburtstag Inhalt Einwanderung von Autoren in die DDR. Einführung, Bestandsaufnahme und Systematik ................................ 11 Historischer Überblick Bernd Stöver Rübergemacht. Die DDR als Einwanderungsland . ...... 33 1940er Jahre Margrid Bircken Anna Seghers’ Figuren in der Entscheidung . ...... 55 Helen Thein Eine Amerikanerin in Ostberlin: Edith Anderson . ...... 73 Hans-Christian Stillmark Alexander Stillmarks Wechsel von Lübeck nach Erfurt – 1949 ein ungewöhnliches Engagement . ................... 87 1950er Jahre Andreas Degen Hans Henny Jahnn und die DDR. Interessen und Vorbehalte . ......103 Christoph Kleßmann Der unbekannte Moorsoldat. Der kommunistische KZ-Häftling Rudi Goguel (1908–1976) als kritischer Zeithistoriker in der DDR . ......135 Leonore Krenzlin Franz Villons kleiner Bruder. Der junge Biermann in der DDR (1953– 1965) . ................................149 8 Inhalt Peter Geist »in einem Blütenbaum / Von blutgen Propellern zerschnitten«. -

Photojournalism / Documentary Photography
Library Reader Resources Series #4 Photojournalism / Documentary Photography Cover: Cornell Capa. First Lady Jacqueline Kennedy Onassis, 1960. Readers Resource #4 was compliled for ICP Library International Center of Photography Library by Bernard Yenelouis 8/2002, LC updated by Pia 1114 Avenue of the Americas, Concourse Byron 3/2010. New York NY 10036-7703 (212) 857-0004 tel / (212) 857-0091 fax [email protected] Margaret Bourke-White. Eyes on Russia, Simon Don McCullin. The Destruction Business. Open & Schuster, 1931 TR820.5.R8 .B68 1931 Gate, 1971 TR820 .M33 1971 Margaret Bourke-White & Erskine Caldwell. Susan Meiselas. Carnival Strippers, Farrar You Have Seen Their Faces. Viking, 1937 Straus & Giroux 1975 TR681.W6 M45 2003 TR820.5.U6 .B68 1995 Carl Mydans. Carl Mydans Photojournalist, Bill Burke. I Want To Take Picture. Nexus Abrams, 1985 TR820 .M93 1985 Press, 1987 TR820.5.S64 .B87 1987 James, Nachtwey. Inferno. Phaidon, 1999 Robert Capa & John Steinbeck. A Russian TR820.6 .N33 1999 Journal, Viking, 1948 TR820 .C36.S7 1948, TR820.5.S65 .S74 1948 Gilles Peress. Telex Iran. Aperture, 1983 TR820.I7 .P47 1983 Robert Capa. Slightly Out of Focus. Holt, 1947 TR140 .C37 1999 .C37 1999 Sylvia Plachy & James Ridgeway. Red Light – Inside the Sex Industry. powerHouse Books, Henri Cartier-Bresson. The Decisive Moment. 1996 TR820.5.U6 .P53 1996 Simon & Schuster, 1952 TR140 .C37 2007 Sebatiao Salgado. Migrations: Humanity in Bruce Davidson. East 100th St. Harvard, 1970 Transition. New York: Aperture, 2000. TR820.5.U6 D38 2003 TR820.5 .S25 2000 David Douglas Duncan. War Without Heroes. Inge Bondi. CHIM – The Photographs of David New York: Harper & Row, 1970 TR820.6 Seymour. -

J4568/7568 History of Photojournalism Fall 2013 Class Schedule Keith Greenwood, Ph.D
J4568/7568 History of Photojournalism Fall 2013 Class Schedule Keith Greenwood, Ph.D. (Schedule is subject to change with advance notice) All readings available through the ERES system are marked (E) All items available through Blackboard are marked (BB) All reserve materials available at the Journalism Library are marked (R) Please have readings completed and be ready to discuss on the date listed. Items marked with a * are covered on reading quizzes. Week 1 August 20 Why Study History? Introduction, discussion of course requirements August 22 History and Visual Evidence Wisconsin Death Trip by Michael Lesy (BB)/(R) & “The Questionable Uses of 19th Century Photographs” by C. Zoe Smith in Journal of Visual Literacy (E) "You Can't Believe Your Eyes: Inaccuracies in Photographs of North American Indians" by Joanna Cohan Scherer (E) Written Assignment #1 due before class August 27 Week 2 August 27 Early History of Photojournalism *American Photojournalism Ch. 1 “Four Streams Nourish Photojournalism” & *American Photojournalism Ch. 2 “From Photography’s Invention to Proto-Photojournalism” pp. 17-34 August 29 Photographing Conflict: Civil War *American Photojournalism Ch. 2 “From Photography’s Invention to Proto-Photojournalism” pp. 35-59 & *“Photographs of War,” Ch. 3 in Carlebach, Origins of Photojournalism in America (E) & *Reading quiz #1 due before class. Reserve materials: Timothy O'Sullivan, America's Forgotten Photographer by James Horan (R) Witness to an Era: The Life and Photographs of Alexander Gardner by D. Mark Katz (R) Working Stiffs: Occupational Portraits in the Age of Tintypes by Michael Carlebach (R) History of Photojournalism Schedule Fall 2013 Week 3 Sept. -

NOW out of NEVER the Element of Surprise in the East European Revolution of 1989
NOW OUT OF NEVER The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989 By TIMUR KURAN* I. UNITED IN AMAZEMENT UR jaws cannot drop any lower," exclaimed Radio Free Eu- rope one day in late 1989. It was commenting on the electrify- ing collapse of Eastern Europe's communist regimes.' The political land- scape of the entire region changed suddenly, astonishing even the most seasoned political observers. In a matter of weeks entrenched leaders were overthrown, the communist monopoly on power was abrogated in one country after another, and persecuted critics of the communist sys- tem were catapulted into high office. In the West the ranks of the stunned included champions of the view that communist totalitarianism is substantially more stable than ordinary authoritarianism.2 "It has to be conceded," wrote a leading proponent of this view in early 1990, "that those of us who distinguish between the two non-democratic types of government underestimated the decay of Communist countries and expected the collapse of totalitarianism to take longer than has actually turned out to be the case."3 Another acknowl- edged her bewilderment through the title of a new book: The Withering Away of the Totalitarian State. And Other Surprises.4 * This research was supported by the National Science Foundation under grant no. SES- 880803 1. A segment of the paper was drafted during a sabbatical, financed partly by a fellow- ship from the National Endowment for the Humanities, at the Institute for Advanced Study in Princeton. I am indebted to Wolfgang Fach, Helena Flam, Jack Goldstone, Kenneth Ko- ford, Pavel Pelikan, Jean-Philippe Platteau, Wolfgang Seibel, Ulrich Witt, and three anon- ymous readers for helpful comments.