Fritz Leonhardt »Leichtbau – Eine Forderung Unserer Zeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Per Molti Secoli L'uomo Potè Attuare La Trasmissione Di Informazioni A
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” POLI DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DIPARTIMENTO DI CONFIGURAZIONE ED ATTUAZIONE DELL’ARCHITETTURA Dottorato in Tecnologia e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente XVIII Ciclo Indirizzo: Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente - Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/17- Tesi di Dottorato di Ricerca COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE E SEGNI. LE TORRI EMITTENTI E RICEVENTI. Dottorando Docente Tutor Angelo Vallefuoco Prof. Arch. Mariella dell’Aquila Coordinatore d’indirizzo Coordinatore Prof. Arch. Mariella Dell’Aquila Prof. Arch. Virginia Gangemi 1 2 Indice Premessa 5 Capitolo primo LE TELECOMUNICAZIONI origini e sviluppo 9 1.1 - Le origini 9 1.2 - I primi passi delle comunicazioni elettriche 12 1.3 - Gli esordi delle telecomunicazioni in Italia 17 1.4 - Le telecomunicazioni italiane dal 1925 al 1945 26 1.5 - La ricostruzione degli impianti dopo gli eventi bellici del 1940/45 30 1.6 - Le telecomunicazioni italiane dal 1948 al 1980 31 1.7 - Le nuove frontiere delle telecomunicazioni ai nostri giorni 38 Capitolo secondo SISTEMI PER TRANS-MITTERE apparati emittenti e riceventi 45 2.1 - Sistemi di trasmissione 45 I segnali 46 I canali di comunicazione a distanza 47 Il "rumore" 50 Modello di un sistema di trasmissione 50 Le reti di telecomunicazione 52 Capitolo terzo FORMA E FUNZIONI evoluzione delle architetture per le telecomunicazioni 55 3.1 - I precursori delle torri di telecomunicazioni 55 3.2 - La torre Eiffel: simbolo della tecnica innovatrice del XIX secolo 56 3.3 - La Fernsehturm di Berlino: metafora e ideologia 62 3.4 - Forma e struttura: la torre di Collserola 69 3.5 - Natura e artificio: le torri per le comunicazioni di Calatrava 76 Conclusioni 81 Appendice: Le torri per le comunicazioni 85 Riferimenti bibliografici 129 3 4 Premessa La costruzione di una torre è uno dei sogni più grandi dell’umanità. -
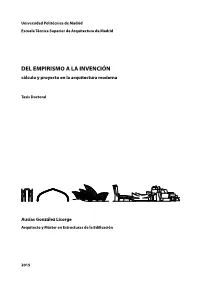
Libro 1.Indb
Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid DEL EMPIRISMO A LA INVENCIÓN cálculo y proyecto en la arquitectura moderna Tesis Doctoral Ausías González Lisorge Arquitecto y Máster en Estructuras de la Edifi cación 2015 Del empirismo a la invención y la vía paralela II.1 3 4 II.1 Del empirismo a la invención y la vía paralela Departamento de Composición Arquitectónica Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid DEL EMPIRISMO A LA INVENCIÓN cálculo y proyecto en la arquitectura moderna Ausías González Lisorge Arquitecto y Máster en Estructuras de la Edifi cación Directores: Miguel Ángel Baldellou Santolaria Doctor Arquitecto Ana Esteban Maluenda Arquitecta y Doctora en Teoría e Historia de la Arquitectura 2015 7ULEXQDOQRPEUDGRSRUHO0DJIFR\([FPR6U5HFWRUGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH 0DGULG HOGtDGH GH 3UHVLGHQWH 9RFDO 9RFDO 9RFDO 6HFUHWDULR 6XSOHQWH 6XSOHQWH 5HDOL]DGRHODFWRGHGHIHQVD\OHFWXUDGHOD7HVLVHOGtDGH HQOD(VFXHOD7pFQLFD6XSHULRUGH$UTXLWHFWXUDGH0DGULG &DOLILFDFLyQ«««««««««««« (O35(6,'(17( /2692&$/(6 (/6(&5(7$5,2 A mis padres, Antonio y Nieves, por su genero- sidad. A mi compañera, Diana, por su comprensión y paciencia. Agradecimientos Querría agradecer, en primer lugar, a Miguel Ángel Baldellou haberme de- dicado parte de su tiempo y haberme enseñado a dudar. También agradez- co a Ana Esteban sus consejos, ayudas y sus orientaciones. Esta Tesis no hubiera sido posible sin ellos. Asimismo, agradezco a Mattia Marzaro que hiciese las veces de tutor en mi estancia en Venecia y Trieste, así como sus consejos y que me dedicase su tiempo y su ayuda desinteresadamente. Doy las gracias a Giovanni Marras por sus siempre bien recibidas correc- ciones y puntualizaciones y a Giuseppina Scavuzzo por su interés en mi investigación y por su ayuda. -

Eminent Structural Engineer: Dr Fritz Leonhardt (1909–1999)
Eminent Structural Engineer: Dr Fritz Leonhardt (1909–1999) Reiner Saul, Dr, Eng. E. h.; Holger S. Svensson, Eng.; Hans-Peter Andrä, Dr, Eng.; Leonhardt, Andrä und Partner, Beratende Ingenieure VBI, GmbH, Stuttgart, Germany Prologue to the construction – tests on the cable clamps, the friction of the abutments, The most difficult part while writing aerodynamic stability etc. this article was to compile 90 years of an exceptionally creative life into In 1948, Leonhardt designed, again in a concise text. The authors apologise Cologne, a continuous steel box girder the absence of some important names with a main span of 184,5 m and slen- within this text, particularly those who derness ratios of L/56 in the span and played an important role in Dr Leon- L/24 over the piers. Also in 1948, Leon- hardt’s life. hardt designed with Willi Baur his first bridge from prestressed concrete with a span of 30 m, prestressed by concen- Brief CV trated tendons. In 1964, Leonhardt and Baur designed 12.07.1907 Born in Stuttgart a 480 m long bridge with spans of 90 m 1927–1931 Student of Civil Engi- across the Caroni River in Venezuela. neering at the Stuttgart The bridge was built completely be- University (Emil Mörsch, hind the abutment and than launched, Otto Graf) a world novelty for concrete bridges. 1932–1933 Graduate studies at the From this the incremental launching Purdue Universtiy bridges developed, built behind the abutments in length of about 25 m and 1934–1938 Bridge Engineer for Fig. 1: Dr Fritz Leonhardt (1999) Highway Bridges in Stu- then launched. -
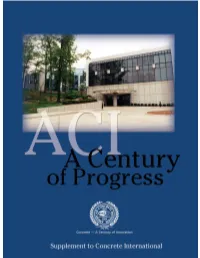
ACI: a Century of Progress
In our recognition of ACI’s centennial, we also celebrate the development and growth of the concrete industry. In this first 100 years, ACI has achieved the maturity to feel proud about the progress attained and has the maturity to look forward with confidence to the goals for the next 100. Globalization and electronic communications make the world smaller every day. It is important to recognize that a worldwide concrete community/industry exists. The mission for each of us is to build a reservoir of knowledge and cooperation to meet and solve the worldwide needs of that community. Concrete can easily be called the best construction material invented by man. For concrete to be recognized and succeed as the prime construction material, we must work together to develop and expand the excellence of our workforce. That workforce includes every single individual and organization involved in making concrete the extraordinary material that it is: students, professors, researchers, technicians, craftsmen, inspectors, materials and product producers, engineers, designers, architects, and even owners. We will need to follow all possible paths so that 100 years from now we will have transformed every goal into an achievement and every hope into history. —José M. Izquierdo ACI President 2003 ACI: A Century of Progress American Concrete Institute: A Century of Progress .................................................................................................... 2 1904-1929: Formation and Growth ............................................................................................................................. -

Assignment 5 Building Structure List L1 Intro Sports Palace
ARE 214B Building Structures 1 B Term 2 2019-2020 Instructor: B. Lonnman Assignment 5 Building Structure List Make of list of each reference to a building or structure mentioned in the lectures. Identify and describe in one or two sentences the significant aspect or issue. Include: Name of building or structure, place, architect and/or engineer, date of completion. DUE: May 27th. (end of term) Submit as a single pdf with page breaks between lectures. L1_Intro Sports Palace (Rome, Italy) P. L. Nervi, 1957 A shallow dome roof constructed of r/c with inclined Y-shaped buttress struts as the support. Portuguese National Pavilion Expo 98 (Lisbon, Portugal) Alvaro Siza A long-span curved concrete roof plane between two stone cladded pavilions designed to resist sliding force with the ground and overturning moment of the foundation. HSBC Headquarters (Hong Kong) Norman Foster A skeleton high rise structure with hanging tensional steel columns, transferring loads to the eight main clustered columns and form 4 connected steel tubes. Pont du Gard (nr Nimes, France) Roman construction, 1st century AD 3 layers of various sized and scaled stone arches formed a tall bridge. Exchange House (London, UK) Skidmore Owings & Merrill (SOM). 1996 A parabolic steel arch with 2 interior diagonal member to resist any deformation occurred by wind load or other external forces. Statue of Liberty (NYC, USA) Gustave Eiffel & F. A. Bartholdi [sculptor], 1886 A tall sectional sculpture supported by lightweight steel framing to four column steel central mast and used Asbestos as to resist corrosion, casted in France but tansported to the USA for assembly and installation. -

International Conferences & Conventions Sub-Committee
International Conferences & Conventions Sub‐Committee AGENDA 7:15 a.m. – 8:30 a.m. Monday, October 22, 2012 Sheraton Centre – Gingersnap, 4th floor Toronto, Ontario Mission: To plan, develop and implement programs for International Conferences, Seminars and Workshops in support of the International Committee’s goals. MEMBERS Ramon L. Carrasquillo, Chair, USA H.S. Lew, USA Mario A. Chiorino, Italy Robert C. Lewis, United Kingdom Cesar A. Constantino, USA Mario E. Rodriguez, Mexico Marwan A. Daye, Saudi Arabia Shunsuke Sugano, Japan Augusto Holmberg, Chile Waon‐ho Yi, Korea Jose M. Izquierdo‐Encarnacion, USA Renée J. Lewis, Staff Liaison 1.0 Call to Order 2.0 Welcome and Introductions 3.0 Approval of Spring 2012 Meeting Minutes The minutes from the spring 2012 meeting in Dallas are attached as Exhibit A. 4.0 Approval of Agenda, Additions, Deletions 5.0 International Lunch 5.1 Fall 2012 – Toronto, ON (Sunday, October 21, 2012, 11:30 am – 1:30 pm) ~ Forming Our Future Professor Michel Virlogeux will give a presentation on Modern Trends in Bridge Design in Europe during the International Lunch in Toronto. Currently there are 77 people registered for the lunch. It is expected that this number will increase. 5.2 Spring 2013 – Minneapolis, MN (Sunday, April 14, 2013) ~ Responsibility in Concrete Construction Peter Richner, President of RILEM, has been confirmed as the speaker for the International Lunch during the Spring 2013 Convention. 5.3 Fall 2013 – Phoenix, AZ (Sunday, October 20, 2013) ~ Innovation in Conservation Cesar Constantino planned to contact the former Chief Engineer of Construction and now head of Administration for the Panama Canal to make a presentation on the Panama Canal Expansion. -

L-G-0003934345-0019231381.Pdf
Holger Svensson CABLE-STAYED BRIDGES 40 Years of Experience Worldwide Holger Svensson CABLE-STAYED BRIDGES 40 Years of Experience Worldwide Prof. Dipl.-Ing. Holger Svensson Consulting Engineer Niederlausitzstraße 22 15738 Zeuthen Germany [email protected] Translated by: Prof. Dipl.-Ing. Holger Svensson, Zeuthen, Germany Prof. Dr. Guido Morgenthal, Weimar, Germany (sections on dynamics) Review and Improvement: Paul Beverley, U.K. Cover: Helgeland Bridge over Leirfjord, Sandnessjøen, Norway © Helga Rutzen, Düsseldorf, Germany © 2012 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag für Architektur Library of Congress Card No.: applied for und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstr. 21, 10245 Berlin, Germany British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. Bibliographic information published by Production: HillerMedien, Berlin, Germany the Deutsche Nationalbibliothek Coverdesign and Layout: Sophie Bleifuß, Berlin, Germany The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Typesetting: Uta-Beate Mutz, Leipzig, Germany Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is Printing: Medialis, Berlin, Germany available in the Internet at <http://dnb.ddb.de>. Binding: Stein + Lehmann, Berlin, Germany All rights reserved (including those of translation into other Printed in the Federal Republic of Germany. languages). No part of this book may be reproduced in any form – Printed on acid-free paper. by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission Print ISBN: 978-3-433-02992-3 from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this ePDF ISBN: 978-3-433-60229-4 book, even when not specifically marked as such, are not to be oBook ISBN: 978-3-433-60104-4 considered unprotected by law. -

Order Exist Within the Structural Art Feti Selmani University for Business and Technology, [email protected]
University of Business and Technology in Kosovo UBT Knowledge Center UBT International Conference 2018 UBT International Conference Oct 27th, 9:00 AM - 10:30 AM Does an(y) order exist within the Structural Art Feti Selmani University for Business and Technology, [email protected] Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference Part of the Civil and Environmental Engineering Commons Recommended Citation Selmani, Feti, "Does an(y) order exist within the Structural Art" (2018). UBT International Conference. 45. https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2018/all-events/45 This Event is brought to you for free and open access by the Publication and Journals at UBT Knowledge Center. It has been accepted for inclusion in UBT International Conference by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For more information, please contact [email protected]. Does an(y) order exist within the Structural Art Feti Selmani1 UBT – Higher Education Institution, Lagjja Kalabria, 10000 p.n., Prishtine, Kosovo [email protected] Abstract. Many authors have treated the beauty and aesthetics from the social and philosophic point of view [Kant, Plato], whereas very few of them have meditated within the domain of Architecture let alone Structural Engineering [1]. The Beautiful is beautiful, and the Ugly is ugly, but subjectivity apart, is any mean of defining a way or some Principles which can be of Guide for the designer. Is there any mathematics within the beauty, i.e., can the beauty be described in a mathematical way? It is a simple, yet a very difficult question answering, since both the beauty and aesthetics falls into the domain of feelings, whereas each human doesn't feel the same when seeing an object created by another human. -

Weber-5ICCH-31-01-2015 Ohne Fußnoten Gekürzt
THE LAST WITNESSES – PHYSICAL MODELS IN ARCHITECTURE AND STRUCTURAL DESIGN, TAKING THE TECHNICHAL UNIVERSITY IN STUTTGART AS AN EXAMPLE 1 Christiane Weber Keywords Physical models History of structural design Conservation of physical models Abstract Structural model analysis marked a phase in the history of structural engineering that has run its course. For a few decades (approx. the 1930s to the 1970s), the most cost-effective method of designing and testing complex load-bearing structures was by using physical models. The mod- els made for this purpose are important witnesses of the history of structural engineering. Taking the institutes and facilities at Stuttgart Technical University as an example, this essay documents the tradition of these objects. The models are analyzed with regard to their genesis and materiali- ty, and their use in tests. Their present condition, their preservation in a collection, as well as the danger to and loss of them represents a further aspect. 1 Institut für Architekturtheorie und Denkmalpflege,Arbeitsbereich Baugeschichte und Denkmalpflege, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Technikerstr. 21, A – 6020 Innsbruck, [email protected] 5th International Congress on Construction History The last witnesses – physical models in architecture and structural design INTRODUCTION As objects models have attracted greater attention over the past few years. This trend may well be related to a vague sense of loss, given the increasing virtualization in the digital design process, which would appear to be making physical models superfluous. Even if the jury is out on this hypothesis, it is nonetheless noticeable that architecture models in particular have become the focus of scholarly research (Bühler 2013, Cachola Schmal/Elser 2012, Conference “La ma- quette. -

Robert Park Thomas Paulay
CONNECTIONS The EERI Oral History Series Robert Park Thomas Paulay Robert Reitherman Interviewer CONNECTIONS The EERI Oral History Series Robert Park Thomas Paulay CONNECTIONS The EERI Oral History Series Robert Park Thomas Paulay Robert Reitherman, Interviewer M Earthquake Engineering Research Institute New Zealand Society for Earthquake Engineering Inc Editor: Gail Hynes Shea, Berkeley, California Cover and book design: Laura H. Moger, Moorpark, California Copyright 2006 by the Earthquake Engineering Research Institute All rights reserved. All literary rights in the manuscript, including the right to publish, are reserved to the Earthquake Engineering Research Institute. No part may be reproduced, quoted, or transmitted in any form without the written permission of the Executive Director of the Earthquake Engineering Research Institute. Requests for permission to quote for publi- cation should include identification of the specific passages to be quoted, anticipated use of the passages, and identification of the user. The opinions expressed in this publication are those of the oral history subjects and do not necessarily reflect the opinions or policies of the Earthquake Engineering Research Institute. Published by the Earthquake Engineering Research Institute 499 14th Street, Suite 320 Oakland, CA 94612-1934 Tel: (5 10) 45 1-090s Fax: (510) 451-5411 E-mail: [email protected] Web site: http://www.eeri.org EERI Publication Number: OHS-12 ISBN (pbk.): 1-932884-1 1-4 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Park, R. (Robert), 1933- Robert Park and Thomas Paulay / Robert Reitherman, interviewer. p. cm. -- (Connections: the EERI oral history series ; 12) Includes index. ISBN 1-932884-1 1-4 (alk.