DIE WASSERVERSORGUNG in DER STEIERMARK Susanne Bauer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vulkanland Steiermark“, Fassung Vom 03.03.2019
Bundesrecht konsolidiert Gesamte Rechtsvorschrift für DAC Verordnung „Vulkanland Steiermark“, Fassung vom 03.03.2019 Langtitel Verordnung der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus zur Festsetzung von Bedingungen für regionaltypische Qualitätsweine mit Herkunftsprofilen für das Weinbaugebiet Vulkanland Steiermark (DAC-Verordnung „Vulkanland Steiermark“) StF: BGBl. II Nr. 299/2018 Präambel/Promulgationsklausel Auf Grund des § 34 Abs. 1 des Weingesetzes 2009, BGBl. I Nr. 111/2009, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2018, wird verordnet: Text § 1. Das Weinbaugebiet Vulkanland Steiermark entspricht den politischen Bezirken Südoststeiermark, Hartberg/Fürstenfeld, Weiz, sowie den Gemeinden des Bezirkes Leibnitz links der Mur. § 2. Wein darf unter der Bezeichnung „DAC“ in Verbindung mit der Angabe des Weinbaugebietes Vulkanland Steiermark („Gebietswein“) in Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen für Qualitätswein sowie folgenden Anforderungen entspricht: 1. Der Wein muss ausschließlich aus handgelesenen Trauben bereitet worden sein, die im Weinbaugebiet Vulkanland Steiermark geerntet wurden. 2. Die kommissionelle Verkostung im Rahmen des Verfahrens zur Vergabe der staatlichen Prüfnummer für Wein mit der Verkehrsbezeichnung „Vulkanland Steiermark DAC“ hat in der Außenstelle des Bundesamtes für Weinbau in Silberberg zu erfolgen. 3. Die für Wein mit der Verkehrsbezeichnung „Vulkanland Steiermark DAC“ erteilte staatliche Prüfnummer darf ausschließlich für das Inverkehrbringen des geprüften Weines und der -

Baurecht Datenquelle: GIS-Steiermark, BEV Erstellung: Amt Der Stmk
Baurecht Datenquelle: GIS-Steiermark, BEV Erstellung: Amt der Stmk. LR. Abteilung 13, Umwelt und Raumordnung Referat Bau- und Raumordnung GIS-Digitalisierung: Michael Hierzmann Stand: 11.02.2015 Altenmarkt bei Sankt Gallen Mariazell Neuberg an der Mürz Altaussee Wildalpen Sankt Gallen Grundlsee Landl Spital am Semmering Ardning Turnau Mürzzuschlag Bad Aussee Liezen Sankt Barbara im Mürztal Admont Bad Mitterndorf Aflenz Wörschach Thörl Stainach-Pürgg Selzthal Langenwang Eisenerz Tragöß-Sankt Katharein Krieglach Rettenegg Lassing Radmer Ratten Sankt Lorenzen im Mürztal Aigen im Ennstal Vordernberg Kindberg St. Kathrein am Hauenstein Gröbming Mitterberg-Sankt Martin Trieben Gaishorn am See Waldbach-Mönichwald Sankt Jakob im Walde Pinggau Schäffern Rottenmann Sankt Lorenzen am Wechsel Kapfenberg Trofaiach Stanz im Mürztal Öblarn Kalwang Fischbach Ramsau am Dachstein Sankt Marein im Mürztal DechantskirchenFriedberg Hohentauern Wald am Schoberpaß Wenigzell Proleb Strallegg Aich Kammern im Liesingtal Vorau Bruck an der Mur Haus Michaelerberg-Pruggern Sankt Peter-Freienstein Rohrbach an der Lafnitz Irdning-Donnersbachtal Mautern in Steiermark Breitenau am Hochlantsch Niklasdorf Gasen Miesenbach bei Birkfeld Pölstal Traboch Pernegg an der Mur Birkfeld Grafendorf bei Hartberg Schladming Leoben Lafnitz Sölk Sankt Kathrein am Offenegg Pöllauberg Kraubath an der Mur Greinbach Pusterwald Fladnitz an der Teichalm Gaal Sankt Marein-Feistritz Sankt Michael in Obersteiermark Pöllau Seckau Sankt Stefan ob Leoben Frohnleiten Hartberg Anger Sankt Johann in -

Rund Ums Kind 20 Homepage.Pdf
m´ u s K d i n n u d R d i l m e f B n e e z st ir r k Fü Hartberg- Bezirkshauptmannschaft SozialhilfeverbandSozialhilfeverband Hartberg-Fürstenfeld Hartberg-FürstenfeldHartberg-Fürstenfeld Impressum: Herausgeber: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld Elternberatungszentrum des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld Rochusplatz 2, 8230 Hartberg Tel.: 03332/606-0 E-Mail: [email protected] Homepage: www.bh-hartberg-fuerstenfeld.steiermark.at Gestaltung und Realisierung: DSA Marion Wanasky Mag.(FH) Magdalena Kahlbacher Monika Mauroschek Druck: Schmidbauer, Fürstenfeld Vollständigkeit, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleicher- maßen für beide Geschlechter. 2 Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld Rund um´s Kind im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld Ratgeber über Leistungen für werdende Eltern und Eltern von Kindern bis 6 Jahren im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld Stand September 2020 3 Bezirkshauptmann Werte Eltern! Als Vater von zwei reizenden noch minderjährigen Mädchen weiß ich wie schön es ist, Eltern zu wer- den und zu sein. Schon vor der Geburt und natürlich auch nachher ändert sich sehr viel. Das gesamte Leben, ob Tages- ablauf, Freizeitgestaltung oder Urlaub wird an die Kinder angepasst. Die zentrale Aufgabe und Leistung der behördlichen Kinder- und Jugendhilfe ist es, das Kindeswohl zu schützen und die Eltern bestmöglich in ihrer Rolle als Mutter und Vater zu unterstützen. Vieles ist leichter zu verstehen und stellt keine scheinbar unlösbaren Probleme dar, wenn man über die jeweiligen Entwicklungsschritte des Kindes Bescheid weiß. Und es macht vieles leichter, wenn man weiß, wen man im Bedarfsfall fragen und wohin man sich vertrauensvoll wenden kann. -

8. Magna Nachwuchs-Cup 2007 U8 Hallentunier Gruppeneinteilung Gruppe a Gruppe B Krottendorf I Weiz I Weiz II St
8. Magna Nachwuchs-Cup 2007 U8 Hallentunier www.bramreiter.at Gruppeneinteilung Gruppe A Gruppe B Krottendorf I Weiz I Weiz II St. Ruprecht Naas Gutenberg Krottendorf II Strallegg Grp Beginn Begegnung Ergebnis A Krottendorf I - Weiz II 0 : 1 A Naas - Krottendorf II 5 : 0 B Weiz I - St. Ruprecht 1 : 4 B Gutenberg - Strallegg 0 : 0 A Naas - Krottendorf I 3 : 0 A Krottendorf II - Weiz II 0 : 0 B Gutenberg - Weiz I 3 : 0 B Strallegg - St. Ruprecht 0 : 5 A Krottendorf I - Krottendorf II 0 : 1 A Weiz II - Naas 0 : 3 B Weiz I - Strallegg 0 : 0 B St. Ruprecht - Gutenberg 2 : 0 Kreuzspiele Ergebnis Naas - Gutenberg 3 : 0 St. Ruprecht - Weiz II 4 : 0 Plazierungsspiele Ergebnis Spiel um Platz 7 Krottendorf I - Weiz I 1 : 0 Spiel um Platz 5 Krottendorf II - Strallegg 1 : 0 Spiel um Platz 3 Ergebnis Gutenberg - Weiz II 0 : 1 Finale Ergebnis Naas - St. Ruprecht 0 : 1 8. Magna Nachwuchs-Cup 2007 U10 Hallentunier www.bramreiter.at Gruppeneinteilung Gruppe A Gruppe B Krottendorf Naintsch I Naintsch II St. Ruprecht Weiz Gleisdorf Gutenberg Stubenberg Grp Beginn Begegnung Ergebnis A Krottendorf - Naintsch II 0 : 0 A Weiz - Gutenberg 4 : 1 B Naintsch I - St. Ruprecht 1 : 7 B Gleisdorf - Stubenberg 4 : 0 A Weiz - Krottendorf 2 : 2 A Gutenberg - Naintsch II 0 : 3 B Gleisdorf - Naintsch I 6 : 0 B Stubenberg - St. Ruprecht 0 : 2 A Krottendorf - Gutenberg 1 : 0 A Naintsch II - Weiz 3 : 3 B Naintsch I - Stubenberg 0 : 2 B St. Ruprecht - Gleisdorf 2 : 1 Kreuzspiele Ergebnis Weiz - Gleisdorf 1 : 3 St. -

Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl G.G.A. 2019 Bezirk
Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. 2019 Bezirk Deutschlandsberg Deutschlandsberg Deutsch Barbara Furth 1 8524 Bad Gams Eberhardt Margaretha Dorfstraße 29 8530 Deutschlandsberg Farmer-Rabensteiner Furth 8 8524 Bad Gams Ganster Rudolf Niedergams 31 8524 Bad Gams Hamlitsch GmbH & Co KG Wirtschaftspark 28 8530 Deutschlandsberg Leopold - Mühle - KG Frauentalerstraße 120 8530 Deutschlandsberg Mandl Manfred Niedergams 22 8524 Bad Gams Reiterer Josef Bösenbacherstraße 94 8530 Deutschlandsberg Schmuck Isabella Blumauweg 77 8530 Deutschlandsberg Eibiswald Grubelnik Martin "Aibler Ölpresse" Aibl 201 8552 Eibiswald Kainacher Inge und Anton Haselbach 8 8552 Eibiswald Kremser Gudrun Hörmsdorf 23 8552 Eibiswald Moser Peter Hörmsdorf 133 8552 Eibiswald Wechtitsch Erich u. Angelika Oberlatein 32 8552 Eibiswald Frauental an der Laßnitz Hainzl-Jauk Gottfried u. Barbara Grazerstraße 231 8523 Frauental Groß Sankt Florian Floriani-Ölmühle Marktring 17 a 8522 Groß St. Florian Jauk Josef u. Aloisia Petzelsdorfstraße 31 8522 Groß St. Florian Jauk Gregor Petzelsdorfstraße 31 8522 Groß St. Florian Lamprecht Stefan Kraubathstrasse 34 8522 Groß St. Florian Mandl jun. Anton Nassau 8 8522 Groß St. Florian Schmitt Margret Kelzen 14 8522 Groß St. Florian Stelzer Manfred u. Gertrude Florianerstraße 61 8522 Groß St. Florian Wieser Johann u. Waltraud Grazerstraße 118 8522 Groß St. Florian Zeck Markus Hasreith 17 8522 Groß St. Florian Lannach Jöbstl Karl Teiplbergstraße 64 8502 Lannach Niggas Theresia Radlpaßstraße 13 8502 Lannach Rumpf Herta Kaiserweg 4 8502 Lannach Pölfing-Brunn Gaisch Udo-Markus Jagernigg 15 8544 Pölfing Brunn Jauk Christian Brunn 45 8544 Pölfing Brunn Orthaber Annemarie Pölfing 8 8544 Pölfing Brunn Preding Bauer Erwin Wieselsdorfer Straße 51 8504 Preding Sankt Johann im Saggautal Wrolli Gottfried Untergreith 131 8443 Gleinstätten Sankt Josef Neumann Christian St. -

Verordnung Der Steiermärkischen Landesregierung Vom 10
1 von 3 Jahrgang 2014 Ausgegeben am 10. September 2014 99. Verordnung: Änderung der Steiermärkischen Bezirkshauptmannschaftenverordnung elektronischen Signatur bzw. der Echtheit de Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser 99. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Juli 2014, mit der die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung geändert wird Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, zuletzt in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 wird mit Zustimmung der Bundesregierung verordnet: Die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung, LGBl. Nr. 99/2012, wird geändert wie folgt: 1. § 2 lautet: s Ausdrucks finden Sie unter: „§ 2 Sprengel der politischen Bezirke Die Sprengel der in § 1 genannten politischen Bezirke umfassen folgende Gemeinden: Bezirk Gemeinden Bruck-Mürzzuschlag Aflenz, Turnau, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, https://as.stmk.gv.at Sankt Marein im Mürztal, Tragöß-Sankt Katharein, Mariazell, Thörl, Kindberg, Stanz im Mürztal, Krieglach, Sankt Barbara im Mürztal, Mürzzuschlag, Langenwang, Spital am Semmering, Neuberg an der Mürz Deutschlandsberg Deutschlandsberg, Frauental an der Laßnitz, Eibiswald, Groß Sankt Florian, Lannach, Pölfing-Brunn, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Stainz, Wettmannstätten, Wies Graz-Umgebung -

Publikatieblad C 125
ISSN 0378-7079 Publikatieblad C 125 38e jaargang van de Europese Gemeenschappen 22 mei 1995 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen Nummer Inhoud Bladzijde I Mededelingen II Voorbereidende besluiten Commissie 95/C 125/01 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de lijst van agrarische probleem gebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG ( Oostenrijk ) 1 NL 2 22 . 5 . 95 NL Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr . C 125/1 II (Voobereidende besluiten) COMMISSIE Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG ( Oostenrijk ) ( 95/C 125/01 ) COM(9S) 58 def. — 95/0060(CNS) (Door de Commissie ingediend op 8 maart 1995) DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, taire lijst van agrarische probleemgebieden, alsmede gege vens over de kenmerken van die gebieden ; Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Overwegende dat als criteria zijn gehanteerd, de zeer ongunstige klimatologische omstandigheden als bedoeld Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april in artikel 3 , lid 3 , eerste streepje, van Richtlijn 751 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in 268/EEG en de ligging op een hoogte van ten minste 700 sommige probleemgebieden ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij de meter ( centrum van de plaats of gemiddelde hoogte van Akte van toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, de gemeente ), en, bij wijze van uitzondering, ten minste en met name op artikel 2 , lid 2 , 600 m in de Salzburgse vooralpen, en in het aan de rivier de Mur grenzende gebied ( Murtal ) in Midden-Stiermar Gezien het voorstel van de Commissie, ken; Overwegende dat de in artikel 3 , lid 3 , tweede streepje , Gezien het advies van het Europees Parlement, van Richtlijn 75/268/EEG bedoelde sterke hellingen een hellingsgraad van meer dan 20% hebben; Overwegende dat omvangrijke delen van het grondgebied van de nieuwe Lid-Staten met permanente natuurlijke Overwegende dat, bij combinatie van de twee bovenge handicaps te kampen hebben en dat in verklaring nr . -

Regionalprogramm Tiefengrundwasser Übersicht Nord
Regionalprogramm Tiefengrundwasser Übersicht Nord Aflenz Langenwang Eisenerz Turnau St. Barbara Rettenegg Thörl Krieglach Ratten Vordernberg St. Lorenzen St. Kathrein Pinggau 186 St. Jakob Waldbach-Mönichwald Tragöß-St. Katharein Kindberg 185 Schäffern St. Lorenzen Trofaiach Kapfenberg 184 Stanz Fischbach 183 St. Marein Dechantskirchen182 Friedberg Wenigzell 181 Proleb Strallegg 180 Vorau Hinweise zur Prüfung finden Sie unter https://as.stmk.gv.at. Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Kammern 179 St. Peter-Freienstein Bruck Breitenau Rohrbach Niklasdorf Gasen 178 Miesenbach Traboch 177 176 Pernegg Birkfeld Grafendorf Leoben 175 174 Lafnitz Pöllauberg 173 159 160 161 172 158 Kraubath St. Michael Fladnitz 162 Greinbach Pöllau 163 164 171 St. Kathrein 157 St. Stefan Anger 166 168 170 Frohnleiten 156 165 132 155 169 HartbergSt. Johann St. Marein-Feistritz Passail 167 131 133 154 Hartberg Umgebung Stubenberg 134 Floing 153 Thannhausen 130 147 Naas 135 148 152 129 136 149 Rohr Übelbach Mortantsch 146 Kaindorf 128 150 151 Buch-St. Magdalena Semriach 124 125 127 137 145 St. Margarethen 126 Puch Gutenberg-Stenzengreith 144 123 Weiz 138 Ebersdorf Peggau 117 122 139 141 142 143 Hartl Deutschfeistritz 116 121 118 140 Feistritztal St. Radegund113 114 115 119 120 Neudau 96 Pischelsdorf Waltersdorf Kainach Kumberg Mitterdorf St. Ruprecht 94 95 Stattegg 112 97 Ilztal Großsteinbach 93 98 102 Weinitzen 111 Geistthal-Södingberg 91 Albersdorf-Prebuch Gersdorf Burgau 92 Gratkorn 101 Lobmingtal Gratwein-Straßengel 90 99 100 110 108 64 Stiwoll 89 103 109 Eggersdorf 84 104 Blumau 85 87 107 63 65 86 88 Ludersdorf-Wilfersdorf Köflach 83 105 Sinabelkirchen Bärnbach 71 82 81 106 Maria Lankowitz 62 66 Kainbach Ilz Großwilfersdorf 70 80 St. -
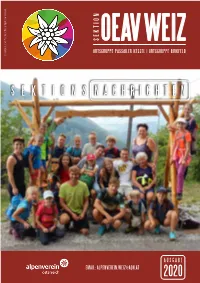
Email: [email protected] 2020 Vorwort
Österreichische Post AG / Postentgelt bar bezahlt / Postentgelt AG Post Österreichische EMAIL: [email protected] 2020 VORWORT Liebe Vereinsmitglieder! 2019 in der Phase des Ausklangs, lässt uns wieder auf hen und einzulassen, sich austauschen und mit Freude ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückblicken – auf gemeinsame Unternehmungen erleben. Auch das ist ausschließlich positive Ereignisse. Kein Misstrauens- Alpenverein! antrag, keine Fake News störten unsere Begeisterung für eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Ein aufrichtiger Dank gilt unseren Sponsoren, deren Treue und Unterstützung uns Auftrag ist, trotz zahlrei- Zeitig im Frühjahr, vor Beginn der Wandersaison, er- cher Gipfeltreffen, auch nicht auf unsere Hauptaufga- richteten wir mit unserem Passailer Brückenkünstler- ben zu vergessen: Die Erhaltung unserer Wanderwege, Team den südlichen Zustieg zum Lehbauersteg neu. der Schutz der Natur, die Ausbildung für Bergsportin- Somit haben wir in den letzten acht Jahren alle Brü- teressierte und die Interressenserweckung der Jugend cken und Stege in der Großen Raabklamm erneuert. zu Natur- und Bergerlebnissen. Ein großer Dank gilt unseren beiden Ortsgruppen Birk- feld und Passail, die zum 35-jährigen Jubiläum unse- Allen Helfern und Mitverantwortlichen gilt mein inni- res Familien- und Jugendstützpunktes Wittgruberhof ger Dank für eure Bereitschaft und für euren Einsatz, Großartiges beigetragen haben. die ein erfolgreiches Gelingen ermöglichen. So wurde von unseren Birkfeldern der Gastraum einla- Siegfried Pirkheim dend und behaglich umgestaltet, und unsere Passailer Obmann verschafften dem Innenhof einen einfühlsam ange- passten Abstellplatz. Pünktlich zum Jubiläumsfest erstrahlte der Wittgru- berhof mit seinen gelungenen Adaptierungen. Noch- mals herzlich gratulieren möchte ich der Ortsgruppe Passail zu ihrem 40-jährigen Bestehen und ihrer stim- mungsvollen Ausrichtung der feierlichen Bergmesse zeitgemäße Küchen am Buchkogel. -

Anlage 2 Zur Verordnung Der Steiermärkischen Landesregierung Vom 7
REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM REGION OSTSTEIERMARK Anlage 2 zur Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 7. Juli 2016 Blattübersicht LANDSCHAFTSRÄUMLICHE EINHEITEN Legende Rettenegg Teilräume § 3 Planungsinformation Ratten Bergland über der Waldgrenze Gewässer und Kampfwaldzone A1 St. Pinggau A2 Kathrein am Sankt Waldbach-Mönichwald Fließgewässer Hauenstein Jakob Forstwirtschaftlich geprägtes Bergland im Walde Sankt Schäffern Lorenzen am Eisenbahn Wechsel Grünlandgeprägtes Bergland Fischbach Autobahnen, Schnellstraßen Friedberg Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften Landesstraßen [B] Wenigzell Dechantskirchen und inneralpine Täler Strallegg Landesstraßen [L] Vorau Außeralpines Hügelland Rohrbach an sonstige Straßen der Lafnitz Gasen Miesenbach Außeralpine Wälder und Auwälder bei Birkfeld Bezirksgrenzen Grafendorf Ackerbaugeprägte Talböden und Becken Birkfeld bei Hartberg Gemeindegrenzen Lafnitz Siedlungs- und Industrielandschaften Pöllauberg Fladnitz Greinbach an der Pöllau Teichalm Sankt Kathrein am Hartberg Offenegg Umgebung Sankt Johann in B1 Hartberg der Haide B2 Anger Passail Naas Floing Thannhausen Rohr bei Stubenberg Hartberg Kaindorf Buch-St. Puch Magdalena Mortantsch bei Weiz Weiz Gutenberg-Stenzengreith Feistritztal Hartl Ebersdorf Pischelsdorf Bad am Kulm Waltersdorf Mitterdorf Sankt Neudau an der Ruprecht an Raab der Raab Ilztal Gersdorf an Albersdorf-Prebuch Großsteinbach Burgau der Feistritz Bad Blumau Ludersdorf-Wilfersdorf Sinabelkirchen Hofstätten Ilz an der Raab Gleisdorf C1 Ottendorf C2 Großwilfersdorf Markt an der Fürstenfeld St. Margarethen Hartmannsdorf Rittschein an der Raab Söchau Loipersdorf bei Fürstenfeld REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM REGION OSTSTEIERMARK - Landschaftsräumliche Einheiten Gemeindeindex Ilz: C1, C2 Sankt Ruprecht an der Raab: B1, C1 Albersdorf-Prebuch: C1 Ilztal: B1, C1 Schäffern: A2 Anger: B1 Kaindorf: B1, B2 Sinabelkirchen: C1, C2 Bad Blumau: C2 Lafnitz: B2 Söchau: C2 Bad Waltersdorf: B2, C2 Loipersdorf bei Fürstenfeld: C2 St. Kathrein am Hauenstein: A1 Birkfeld: A1, B1 Ludersdorf-Wilfersdorf: C1 St. -

Ausgabe 22, Winter 2018/2019 Amtliche Mitteilung
Ausgabe 22, Winter 2018/2019 Amtliche Mitteilung. An einen Haushalt. Zugestellt durch Post.at GERSDORFER Gemeindeblatt’l NACHRICHTEN AUS DER GEMEINDE GERSDORF AN DER FREISTRITZ Vorzeigekindergarten eröffnet LH Hermann Schützenhöfer ist Automationstechnik Grübl 20 Jahre Schützenverein Ehrenbürger der Gemeinde kommt nach Gersdorf SV Feistritztal Gersdorfer Gemeindeblattl Ausgabe 22, Winter 2018/2019 Inhalt Wichtige Gemeinderatsbeschlüsse 4 Liebe Gemeindebürgerinnen Haushaltsvoranschlag 2019 12 Kindergarteneröffnung 14 Aus der Volksschule 17 und Gemeindebürger, Schuljahr 2017/2018 18 Baugeschehen 22 Falsche Abfalltrennung ist teuer! 26 liebe Jugendliche und Kinder! Fa. Grübl kommt nach Gersdorf 28 Firma TeLo 29 50 Jahre Firma Egger-Glas 30 neue Haus konnte rechtzeitig zum Be- 100 Jahre Elektro Schafler Gersdorf 32 Der neue Kindergarten, eine ginn des Kindergartenjahres in Betrieb FF-freundlicher Betrieb Loidl 33 Investition in die Zukunft genommen werden. Kirchliches 34 Gratulation an unsere leistungsstarken Pilgerwanderungen 38 Ich freue mich vor allem riesig darüber, heimischen Betriebe, die die Bauarbeiten Branddienstleistungsprüfung 39 dass heuer mit dem Zu- und Umbau des reibungslos und unfallfrei ausgeführt ha- Blackout-Vorsorge 40 Gersdorfer Gemeindekindergartens mit ben. Ein Dankeschön auch an die Nach- Botschafter aus der Slowakei 41 Kinderkrippe ein wichtiger Meilenstein barn für das Verständnis während der Bau- Nina Heyer beim Forum Alpbach 42 auf dem Gebiet der Bildungs- und Be- zeit. Besonders erfreulich ist zu erwähnen, Kernölprämierung 2018 42 treuungseinrichtungen in der Gemein- dass für den neuen Vorzeigekindergarten Kulmkelten 43 de rasch und kostengünstig umgesetzt durch die großzügige Unterstützung von Oberrettenbach 33 44 werden konnte. Ein sehr gelungenes Landeshauptmann Hermann Schützenhö- Dorffest 45 Bauwerk, ein Generationenprojekt, das fer hohe, nicht rückzahlbare Fördermittel Parkfest 2018 46 die Gemeinde familienfreundlicher, le- in Anspruch genommen und so das Ge- Schülertreffen in Gschmaier 47 benswerter und attraktiver macht. -

Geochemie Und Vererzung Im Kraubath-Massiv, Südöstlich Von Kraubath an Der Mur, Steiermark, Österreich 53-97 Joannea Min
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Joannea Mineralogie Jahr/Year: 2007 Band/Volume: 4 Autor(en)/Author(s): Kollegger Peter, Mogessie Aberra, Mali Heinrich Artikel/Article: Geochemie und Vererzung im Kraubath-Massiv, südöstlich von Kraubath an der Mur, Steiermark, Österreich 53-97 Joannea Min. 4: 53-97 (2007) Geochemie und Vererzung im Kraubath-Massiv, südöstlich von Kraubath an der Mur, Steiermark, Österreich Peter KOLLEGGER, Aberra MOGESSIE und Heinz MALI Mit 4 Kartenbeilagen Zusammenfassung: Im ersten Schritt der Untersuchungen am Kraubath-Massiv wurden die Vorkommen von Chrom, Nickel, Eisen und Mangan durch statistische Bearbeitung von Gesamtgesteinsanalysen evaluiert. Hierbei konnten ältere Arbeiten zur lokalen und regionalen Verbreitung der besprochenen Elemente relativiert werden. Zudem konnten durch die Ermittlung von etwaigen Korrelationen der analysierten Elemente und Oxide Zusammenhänge zwischen dem Auftreten der zu betrachtenden Metalle hergestellt werden. Durch den Vergleich der Obertage- Gesamtgesteinsanalysen mit Untertageproben einer Kernbohrung im Zentralteil des Massivs wurden die Einflüsse der Verwitterung und Alteration und weiterhin Konzentrationsschwankungen von Chrom, Nickel, Eisen und Mangan auf lokalem Maßstab ermittelt. Im zweiten Schritt wurde die Widerspiegelung der im Gestein anzutreffenden Metall-Elementkonzentrationen, mit besonderem Augenmerk auf das Auftreten von Chrom, in den Sedimenten von Fließgewässern