PDF Auf Zobodat.At
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Segones Jornades De Prospecció Biològica De Catalunya
Segones Jornades de Prospecció Biològica de Catalunya Espai natural protegit del Moianès i riera de Muntanyola 6, 7 i 8 de juny de 2012 Memòria descriptiva i resultats Índex MEMÒRIA Presentació ...................................................................................................... 5 Situació de l’àrea d’estudi ................................................................................ 7 Programa i participants .................................................................................... 9 Dades i resultats ............................................................................................ 11 Observacions dels investigadors ................................................................... 18 Activitats complementàries ............................................................................ 20 Recull d’imatges ............................................................................................ 22 Ressò mediàtic .............................................................................................. 26 ANNEXOS Fongs ............................................................................................................... 3 Líquens .......................................................................................................... 10 Briòfits ............................................................................................................ 18 Cormòfits ....................................................................................................... 22 Mol·luscs -

Gibraltar Nature Reserve Management Plan
Gibraltar Nature Reserve Management Plan Contents Introduction…………………………………………………...3 Management structure………….…………………………9 Upper Rock………….………………………………………..10 Northern Defences…………….…………………………..27 Great Eastside Sand Slopes……...……………………..35 Talus Slope…………….………………................................41 Mount Gardens.……………………………………………..45 Jacob’s ladder………….…………………………………….48 Windmill Hill Flats…………………………………………51 Europa Point Foreshore…………….…………………...56 Gibraltar’s Caves...………..………………………………...62 This document should be cited as: Thematic trails and general improvements….…..66 Gibraltar Nature Reserve Management Plan. Scientific Research and Monitoring....………………85 2019. Department of the Environment, Heritage and Climate Change. H.M. Management Plan Summary…………..….……………86 Government of Gibraltar. References……………………………………………………..88 Front cover: South view towards the Strait from Rock Gun, Upper rock Above: View of the Mediterranean Sea from the Middle Ridge, Upper Rock Back Cover: Jacob’s Ladder 2 Introduction Gibraltar is an Overseas Territory of the United Kingdom situated at the entrance to the Mediterranean, overlooking the Strait of Gibraltar. Its strategic location and prominence have attracted the attention of many civilisations, past and present, giving rise to the rich history and popularity of ‘The Rock’. In addition to its geographical importance, Gibraltar is just as impressive from a naturalist’s perspective. It boasts many terrestrial and marine species, most of which are protected under the Nature Protection Act 1991, Gibraltar’s pioneering nature conservation legislation. Gibraltar’s climate is Mediterranean, with mild, sometimes wet winters and warm, dry summers. Its terrain includes a narrow coastal lowland to the west, bordering the 426 metre high Rock of Gibraltar. With a terrestrial area of 6.53 km2 and territorial waters extending up to three nautical miles to the east and south and up to the median line in the Bay of Gibraltar, it is of no surprise that Gibraltar’s biological resources are inevitably limited. -

A.Ö.Koçak, 2004, Pyralidae Araştırmaları Hakkında (Lepidoptera)
Prof. Dr. Ahmet Ömer Koçak List of the Publications (795 items) (1975-2019) ! 1. Koçak,A.Ö., 1975, New Lepidoptera from Turkey-I. Atalanta 6 (1): 24-30, figs. 2. Koçak,A.Ö., 1975, A new species of genus Lysandra from Turkey (Lepidoptera, Lycaenidae). Atalanta 6 (1): 31-34, 6 figs. 3. Koçak,A.Ö., 1975, New Lepidoptera from Turkey-II. Atalanta 6 (1): 50-55, 10 figs. 4. Koçak,A.Ö., 1976, A new subspecies of Melanargia larissa from Turkey (Lepidoptera, Satyridae). Atalanta 7 (1): 40-41, 2 figs. 5. Koçak,A.Ö., 1976, A new subspecies of Myrmeleonidae (Neuroptera) from Turkey. NachrBl. bayer. Ent. 22 (5): 97- 100, 4 figs. 6. Koçak,A.Ö., 1977, Studies on the family Lycaenidae (Lep.) I. New taxa and records from East Turkey. Atalanta 8 (1): 41-62, 24 figs. 7. Koçak,A.Ö., 1977, New Lepidoptera from Turkey V. Atalanta 7 (2): 126-146, 47 Abb, 1 map. 8. Koçak,A.Ö., 1977, New Lepidoptera from Turkey IV. Description of a new subspecies of Archon apollinus (Herbst,1789) (Parnasiidae). NachrBl. bayer. Ent. 26 (3): 54-60, 7 figs. 9. Koçak,A.Ö., 1978, Pseudochazara mamurra Herrich-Schäffer aus dem Libanon mit Beschreibung einer neuen Unterart (Lep., Satyridae). Atalanta 9 (4a): 372-375, 4 Abb. 10. Koçak,A.Ö., 1979, Studies on the family Lycaenidae II. New Taxa and Records from Turkey. Atalanta 10 (4a): 309- 325, 37 figs. 11. Koçak,A.Ö., 1980, Studies on the family Lycaenidae III. A review of the subspecies of Agrodiaetus (Sublysandra) myrrhus (H.-S.,1852). -

Tiger-Moths of Iran 481-525 Atalanta (Dezember 2005) 36 (3/4): 481-525, Würzburg, ISSN 0171-0079
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Atalanta Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 36 Autor(en)/Author(s): Dubatolov Vladimir V., Zahiri Reza Artikel/Article: Tiger-moths of Iran 481-525 Atalanta (Dezember 2005) 36 (3/4): 481-525, Würzburg, ISSN 0171-0079 Tiger-moths o f Iran (Lepidoptera, Arctiidae: Arctiinae) by V l a d im ir V. D u b a t o l o v & R e z a Z a h ir i received 26.X.2005 Abstract: Based on the vast material from the collection of the Hayk Mirzayans Insect Museum (HMIM) and literature data, 28 species are recorded from Iran. Callimorpha dominula rossica K o l ., Axiopoena kareliniMtu., Utetheisa lotrixCr ., Watsonarctia deserta B a r t ., Diaphora mendica C l . are recorded from this country for the first time. Four new subspecies, Arctia caja mazandarana subspec. nov. from the Caspian Coast, Eucharia festiva hormozgana subspec. nov. from South Iran, Watsonarctia deserta elbursica subspec. nov. from the Alburz Mts., and Pbragmatobia placida mirzayansi subspec. nov. with a pale coloration, from the high mountains of the Albourz are described. The analysis of the Arctiinae fauna shows that the fauna of South-Eastern Iran is the Oriental, and not Palearctic. Zusammenfassung: Mit Hilfe des reichhaltigen Materials des Hayk Mirzayans Insect Museum (HMIM) und aufgrund von Literaturangaben können 28 Arten für den Iran angegeben werden. Callimorpha dominula rossica K o l ., Axiopoena kareliniM £ n ., Utetheisa lotrix C r ., Watsonarctia deserta B a r t ., Diaphora mendica C l . werden erstmals für dieses Land gemeldet. -

County Wildlife Site Survey Form (Ref. No
WILDLIFE IN COMMON County Wildlife Site Survey Form (Ref. No. 1429) Site Name: Howards Common Parish: Belton/Fritton & St Olaves Grid reference: TG472024 Area: 18ha (whole CWS) District: Great Yarmouth Survey date: Various dates in 2018 and 2019 Please note: This was part re-survey of the County Wildlife Site, see maps below for area surveyed. Map showing County Wildlife Site Boundary Map showing area surveyed during Wildlife in Common project 1 WILDLIFE IN COMMON Habitat description: An historic common and County Wildlife Site (CWS 1429), Howard’s Common is an area of sandy soils supporting acid grassland, stands of scrub, bracken (Pteridium aquilinum), and areas of wet and dry woodland. A wet ditch lies at the bottom of the wooded slope, linking the site to the marshes in the west. A footpath following the line of the old Great Eastern Railway makes up the east boundary of the site. Fadens Map of Norfolk, c.1797, shows present-day Howards Common to be part of the much larger, historic Belton Common extending to the north, south and east. The first Ordnance Survey maps, c.1884, show the old Howards Common following the present boundaries but also extending to the north (now the Wild Duck Caravan Site) and consisting of heather (Calluna vulgaris), rough pasture and gorse (Ulex europaeus) throughout. The map shows a couple of trees occur on the west boundary by the wet ditch. The Great Eastern Railway Line dominates, running north-east to south west along the present-day east boundary footpath. By the 1906 OS map, marsh is shown to the west of the wet ditch; by the mid-1920s, this marsh is dominated by trees, but Howards Common itself consists of mainly dry, heath habitat. -

New Tiger Moth Taxa from Eurasia (Lepidoptera, Arctiidae) by V Ladimir V
©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at Atalanta (Dezember 2007) 38 (3/4): 351-359, Würzburg, ISSN 0171-0079 New tiger moth taxa from Eurasia (Lepidoptera, Arctiidae) by V ladimir V. D ubatolov received 18. VI.2007 Abstract: Based on the structure of the cf genitalia and on wing pattern, several new subspecies of tiger-moths are described: Epicallia villica transimilica subspec. nov. from South Transuralia, Russia, Eucharia festiva k arabagh subspec. a nov. from the border between Armenia and Azerbaijan, Holocirctiapuengeleri irem elica subspec. nov. from the South Ural Mts., Russia, H. p. sib irica subspec. nov. from North-Eastern Siberia and Alaska, Grammia quenseli sau ra subspec. nov. from the Saur and Tarbagatai Mts. in Eastern Kazakhstan, Diacrisia sannio arm en iaca subspec. nov. from Armenia, Spilarctia lutea «r/z/i«r/casubspec. nov. from Western Georgia and Abkhazia, Lemyra m u rzin oru m spec. nov. from Sichuan, China, and Muvzinoria gracilis gen. et spec. nov. from Gansu, China. While studying geographical variability within the cf genitalia of tiger-moths, new subspecies of Epicallia villica (Linnaeus , 1758) and Diacrisia sannio (Linnaeus , 1758) were discovered from peripheral parts of their range. Moreover, new subspecies of Eucharia festiva (H ufnagel , 1766), Holoarctia puengeleri (O.Bang -H aas , 1927), and Spilarctia lutea (H ufnagel , 1766), were isolated from differences in their wing pattern. In addition, two new species were collected by Sergei V. M urzin (M oscow , Russia) in China. Descriptions of these new taxa of Eurasian tiger-moths are given below. The whereabouts of each holotype is also listed. -
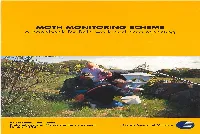
Moth Moniioring Scheme
MOTH MONIIORING SCHEME A handbook for field work and data reporting Environment Data Centre 1/1/1/ National Boord of Waters and the Environment Nordic Council of Ministers /////// Helsinki 1 994 Environmental Report 8 MOTH MONITORING SCHEME A handbook for field work and data reporting Environment Data Centre National Board of Waters and the Environment Helsinki 1994 Published by Environment Data Centre (EDC) National Board of Waters and the Environment P.O.BOX 250 FIN—001 01 Helsinki FINLAND Tel. +358—0—73 14 4211 Fax. +358—0—7314 4280 Internet address: [email protected] Edited by Guy Söderman, EDC Technical editng by Päivi Tahvanainen, EDC This handbook has been circulated for comments to the members of the project group for moth monitoring in the Nordic countries under the auspices of the Monitoring and Data Group of the Nordic Council of Ministers. Cover photo © Tarla Söderman Checking of installation of light trap at Vilsandi National Park in Estonia. Printed by Painotalo MIKTOR Ky, Helsinki 1 994 ISBN 951—47—9982—8 ISSN 0788—3765 CONTENTS .4 INTRODUCTION 5 PART 1: OBJECTIVES 7 1 Short term objectives 7 2 Medium-long term objectives 8 3 Additional objectives 8 4 Specific goals 9 5 Network design 9 5.1 Geographical coverage 9 5.2 Biotopes coverage 10 PART II: METRODOLOGY 11 1 Technical equipments and use 11 1.1 Structure of Iight traps 11 1.2 Field installation 13 1.3 Structure ofbait trap 14 1.4 Documentation of sites 15 1.5 Timing the light traps 15 1.6 Sampling procedures 15 2 Sample handling 16 2.1 Prestoring 16 2.2 Posting 16 -

Noctuoid Moths (Lepidoptera: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of North-East Kazakhstan (Pavlodar Region)
Ukrainian Journal of Ecology Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(2), 142–164, doi: 10.15421/2017_32 ORIGINAL ARTICLE UDC 595.786 Noctuoid moths (Lepidoptera: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of North-East Kazakhstan (Pavlodar Region) S.V. Titov1, A.V. Volynkin2,3, V.V. Dubatolov4, M. Černila5, S.M. Reznichenko6 & V.S. Bychkov7 1 The Research Centre for Environmental 'Monitoring', S. Toraighyrov Pavlodar State University, Lomova str. 64, KZ-140008, Pavlodar, Kazakhstan. E-mail: [email protected] 2 Altai State University, Lenina pr. 61, Barnaul, RF-656049, Russia. E-mail: [email protected] 3 Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology, Lenina pr. 36, RF-634050, Tomsk, Russia 4 Institute of Systematics and Ecology of Animals, SB RAS, Frunze str. 11, RF-630091, Novosibirsk, Russia E-mail: [email protected] 5 The Slovenian Museum of Natural History, Prešernova 20, SI-1001, Ljubljana, Slovenia. E-mail: [email protected] 6 Shcherbakty branch of the Republican methodical center of phytosanitary diagnostics and forecasts, Sovetov 44, KZ-141000, Sharbakty, Shcherbakty distr., Pavlodar Region. E-mail: [email protected] 7 Institute of Archaeology named after A. Kh. Margulan, 44 Avenue Dostyk, st. Shevchenko 28, KZ-050010, Almaty, Kazakhstan. E-mail: [email protected] Submitted: 02.04.2017. Accepted: 23.05.2017 The paper contains data on the fauna of the Lepidoptera families Erebidae, Nolidae and Noctuidae of Pavlodar Region (North-East Kazakhstan). The check list includes 480 species (100 species of Erebidae, 8 species of Nolidae and 372 species of Noctuidae), 393 species are reported for the region for the first time. The map of collecting localities and pictures of the main landscapes of the region are presented. -

Biolphilately Vol-64 No-3
152 Biophilately September 2017 Vol. 66 (3) ENTOMOLOGY Editor Donald P. Wright, Jr., BU243 and José Reis New Listings Scott# Denom Common Name/Scientific Name Family/Subfamily Code AUSTRALIA 2017 August 1 (Dragonflies) (Set/5, MS/5, Bklt/10, Bklt/20, Strip/2) Note: Odonata taxonomy is in flux. Each stamp also issued in gutter strips of ten. a $1 Scarlet Percher, Diplacodes haematodes Burmeister ♂ LIB, Sympetrinae A b $1 Arrowhead Rockmaster, Diphlebia nymphoides Tillyard ♂ Lestoideidae A (Amphypterigidae of some) c $1 Australian Tiger, Ictinogomphus australis Selys ♂ Lindeniidae A (Gomphidae of some) d $1 Jewel Flutterer, Rhyothemis resplendens Selys ♂ LIB, Trameinae A e $1 Beautiful Petaltail, Petalura pulcherrima Tillyard ♂ Petaluridae A Margin Top: Arrowhead Rockmaster, Diphlebia nymphoides Tillyard ♂ Lestoideidae Z Bklt/10 (2ea Sc#a–e) (s/a) Bklt/20 (10ea Sc#a–b) COSTA RICA 2017 July 20 (130th anniv. National Museum) (MS/4) a 420col Carneades superba Bates CER, Lamiinae A b 550col Red-bordered Stink Bug, Edessa rufomarginata DeGeer PEN, Edessinae A c 650col Chrysina aurigans Rothschild & Jordan SCA, Rutelinae A d 900col Golofa costaricensis Bates SCA, Dynastinae A ECUADOR 2017 March 31 (Ants of Ecuador) (2ea Bklt/8) a 25c Atta cephalotes L. FOR, Myrmicinae A b 25c Eciton hamatum Fabr. FOR, Dorylinae A c 50c Daceton armigerum Latreille FOR, Myrmicinae A d 50c Acanthoponera minor Forel FOR, Heteroponerinae A e 75c Hairy Ant, Ectatomma tuberculatum Olivier FOR, Ectatomminae A f 75c Gigantiops destructor Fabr. FOR, Formicinae A g $1 Hairy Panther Ant, Neoponera villosa Fabr. FOR, Ponerinae A h $1 Cephalotes atratus L. FOR, Myrmicinae A a 25c Cephalotes spinosus Mayr FOR, Myrmicinae A b 25c Odontomachus hastatus Fabr. -

Baptria 2012 Nro 2
Vol. 37 2012, nro 2 Suomen Perhostutkijain Seura ry Lepidopterologiska Sällskapet i Finland rf ISSN 0355-4791 Suomen Perhostutkijain Seura ry Lepidopterologiska Sällskapet i Finland rf TOIMISTO Suomen Perhostutkijain Seura ry:n toimisto avoinna tiistaisin klo 15.30–20.00 HUOM. Talvikaudella helmikuun loppuun asti vain parittomien viikkojen tiistaisin. • Osoite/Address: Suomen Perhostutkijain Seura ry, Lämmittäjänkatu 2 A, FI–00810 Helsinki • e-mail: [email protected], internet: http://www.perhostutkijainseura.fi Pankkiyhteys — Bankförbindelse: Sampo Pankki, IBAN: FI0680001900268583, BIC-koodi DABAFIHH HALLITUS — STYRELSE Taloudenhoitaja Lassi Jalonen, Isonmastontie 2 as 1, 00980 Helsinki. Puheenjohtaja — Ordförande Puh. 040 557 3000, e-mail: [email protected] Reima Leinonen, Rauhalantie 14 D 12, TOIMINNANJOHTAJA — 87830 Nakertaja. Puh. 040 529 6896, VERKSAMHETSLEDARE e-mail: [email protected] Jari Kaitila, Kannuskuja 8 D 37, 01200 Vantaa, Varapuheenjohtaja puh. 050 586 8531, Monet perhoslajit muuntelevat väri- Kimmo Silvonen, Pronssitie 28, 02750 Espoo. e-mail: [email protected] tykseltään. Tutut ja yleiset lajit ovat Puh. 040-709 0987, e-mail: [email protected] TOIMIKUNNAT — UTSKOTT tutkimustyössä usein oivallisia, koska Muut hallituksen jäsenet: Eettinen toimikunta: Vesa Lepistö (pj), aineistoa on helposti saatavilla. Maria Heikkilä, Otsolahdentie 7 A 7, 02110 Espoo Jyrki Lehto, Markus Lindberg, Karl-Erik Lundsten Kuvassa vaaleakeltayökkönen (Xanthia Puh. 040 502 2504, e-mail: [email protected] Suojelutoimikunta: Erkki Laasonen (pj), icteritia), josta voit lukea lisää lehden Mari Kekkonen, Peräniityntie 14 as 2, 05820 Hyvinkää Petri Hirvonen, Jari Kaitila, Hannu Koski (siht.), sivuilta 60–63. Kuva Timo Lehto Puh. 040 769 5330, e-mail: [email protected] Jaakko Kullberg, Reima Leinonen, Kari Nupponen, Jaakko Kullberg, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Juha Pöyry, Panu Välimäki Hyönteisosasto 00014 Helsinki. -

1Ersemestre 2013 SOMMAIRE
1er semestre 2013 SOMMAIRE ≥ Préambule [Christine Prat] ≥ P. 1 - Observer des insectes dans un jardin en pleine ville...un défi ? [Olivier Viet] ≥ P. 2 - Cédric a trouvé des chenilles dans le jardin... [Cédric et Marie-Laurence] ≥ P. 3 - Un crustacé : le Cloporte [Patrick Mulot-Sauvannet] ≥ P. 4-16 - Synthèse des observations de Lépidoptères au 1 er semestre 2013 en Essonne [Christine Prat - relecture Odile Clout] ≥ P. 17-18 - Bilan du 1er semestre 2013 [Christine Prat] ≥ P. 19-20 - Tableaux semestriels des Rhopalocères et des Hétérocères [Christine Prat] ≥ P. 21 - Vagabondages [Odile Clout] PREAMBULE La curiosité engendre la découverte et la découverte engendre la passion. Passion pour la Nature bien sûr et pour tout ce qu’Elle peut nous apporter d’authentique et de vrai. Au fil du temps, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à la minuscule faune qui nous entoure et c’est avec plaisir que nous recevons les données d’observa- teurs émerveillés et attentifs à leur environnement. Saluons Jocelyne et Michel LAPRAT qui se sont envolés vers un ciel plus clément. Obser- vateurs assidus ils ont largement contribué à enrichir les pages de notre revue et savou- rent à présent une région où les papillons se bousculent à leur porte : « C’est l’extase » disent-ils !... Qu’ils soient de jour ou de nuit les Lépidoptères sont toujours à l’honneur dans notre re- vue mais il ne tient qu’à vous, de montrer un intérêt particulier pour un nouvel Ordre d’insectes et une envie de partager, pour que s’ouvre une nouvelle rubrique pouvant élar- gir nos connaissances. -

Puglia in Spring
Puglia in Spring Naturetrek Tour Report 13 - 20 April 2019 Early Spider Orchid by Ron Brown Southern Festoon by Susan Wilsher Eurasian Hoopoe by Ron Brown Italian Pool Frog by Ron Brown Report compiled by Jessica Turner and Paul Harmes Images by Ron Brown & Susan Wilsher Naturetrek Wolf’s Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ England T: +44 (0)1962 733051 F: +44 (0)1962 736426 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Tour Report Puglia in Spring Tour Participants: Jessica Turner and Paul Harmes (leaders) with 15 Naturetrek clients Summary Our third Naturetrek visit to Puglia was very enjoyable. In terms of flowers, it was a later season, and there was less visible migration this year. However, we still saw a fair number of Marsh and Hen Harriers (the latter possibly all male), plus a couple of Montagu’s Harriers. We also had at least one dark-phase Booted Eagle and a Bonelli’s Eagle flying overhead. The Lesser Kestrels were a delight, as was the Lanner Falcon seen by Ron, and the more distant one out over the sea. The Hoopoes were rather elusive, but we had some good views, especially on the last afternoon. The sheer abundance, together with the range and diversity of orchids was breath-taking, and we also enjoyed a good range of other Mediterranean spring flowers, many localised to Puglia or with a peri -Adriatic distribution such as the maroon-flowered Figwort Scrophularia lucida and the blue spikes of the bellflower Asyneuma limonifolium by Capo d’Otranto. The Risso’s Dolphins and Audouin’s Gulls added interest, and we enjoyed too, the range of architecture from cave dwellings via trulli to cathedrals, with Matera being especially fascinating.