US 1.Fm.Ipl.EA2530 ID=43005
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching, 1994. SPONS AGENCY Society for Accelerative Learning and Teaching, Inc
DOCUMENT RESUME ED 386 019 FL 022 834 TITLE Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching, 1994. SPONS AGENCY Society for Accelerative Learning and Teaching, Inc. REPORT NO ISSN-0273-2459 PUB DATE 94 NOTE 444p. AVAILABLE FROM SALT Journal, Learning Forum, 1725 So. Hill St., Oceanside, CA, 92054. PUB TYPE Collected Works Serials (022) JOURNAL CIT Journal of the Society for Accelerative Learning and Teaching; v19 n1-4 1994 EDRS PRICE MF01/PC18 Plus Postage. DESCRIPTORS *Acceleration (Education); Cultural Influences; Learning Processes; *Neurolinguistics; Second Language Learning; *Semiotics; *Suggestopedia; Teacher Education; Technical Institutes; Two Year Colleges ABSTRACT Two issues of this serial include the following articles: "Editorial Note for Semiotics Issue" (Pedro Portes); "Qualitative Postmodernism and the Nature of Teaching and Learning" (Gary Shank); "Instructional Prescriptions Can Be Hazardous to Your Pedagogy!" (Donald J. Cunningham, Bruce Allen Knight, and Kathy K. Watson); "Toward a Mutual Interplay Between Psychology and Semiotics" (Alfred Lang); "Semiotics and the Deconstruction of Conceptual Learning" (J. L. Lemke); "Effectiveness of Accederated Learning as a Tool to Facilitate a Maintenance Paradigm Shift" (Aaron B. Clevenson); "The Effectiveness of Suggestive Accelerative Learning Techniques Applied in Teaching Underprepared College Freshmen at a Two-Year Technical School" (Vera Ann Confer-Owens); "Video-Taped Instrue.ion Creates Listening and Visual Memory Integration for Higher Reading and Math Scores" -
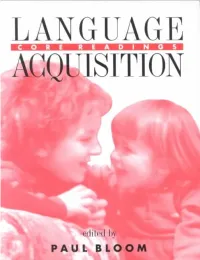
Language Acquisition Core Readings
Language Acquisition Core Readings Paul Bloom The MIT Press Cambridge, Massachusetts Second printing, 1996 First MIT Press edition, 1994 © 1993 Harvester Wheatsheaf All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher. Printed and bound in the United States of America. Library of Congress Catalogingin Publication Data Language acquisition : core readings / edited by Paul Bloom. p. cm. Includes bibliographical references (p.). ISBN 0262023725.—ISBN 0262521873 (pbk.) 1. Language acquisition. I. Bloom, Paul. 1963– P118.L2536 1994 401'.93—dc20 9327417 CIP Page v Contents Acknowledgments vii Preface: Language acquisitions 1 Paul Bloom Overview: Controversies in language acquisition 5 Paul Bloom Part 1: The onset of language development 49 1.1 Human maternal vocalizations to infants as biologically relevant signals: An evolutionary perspective 51 Anne Fernald 1.2 Modularity and constraints in early lexical acquisition: Evidence from children's early language and gesture 95 Laura Ann Petitto Part 2: Word learning 127 2.1 Infant contributions to the achievement of joint reference 129 Dare A. Baldwin 2.2 Constraints children place on word meanings 154 Ellen M. Markman 2.3 The structural sources of verb meanings 174 Lila Gleitman Page vi 2.4 Early word meanings: The case of object names 222 Janellen Huttenlocher and Patricia Smiley Part 3: Syntax and semantics 249 3.1 The notion of source in language acquisition 251 Eve V. Clark and Kathie L. -

Alexander L. Francis
Alexander L. Francis Curriculum Vitae Spring, 2020 Work Home Speech, Language & Hearing Sciences 3008 Covington St. Purdue University West Lafayette, IN 47906 Lyles-Porder Hall USA 715 Clinic Drive phone +1 765.463.6776 West Lafayette, IN 47907 USA phone +1 765 494 3815 fax +1 765 494 0771 [email protected] EDUCATION Ph.D. in Linguistics and in Psychology (with Distinction), The University of Chicago, 1999 Dissertation Title: “Perceptual Learning, Attention, and Phonetic Categorization” Committee: Howard C. Nusbaum, Karen L. Landahl (co-supervisors), David McNeill, Terry Regier, Janellen Huttenlocher (reader) M.A. in Linguistics, The University of Chicago, June, 1993 B.A. in Linguistics (with Honors), University of Illinois at Urbana-Champaign, 1991 ACADEMIC EMPLOYMENT Associate Professor, Dept. of Speech, Language & Hearing Sciences, Purdue University, August 2008–present Assistant Professor, Dept. of Speech, Language & Hearing Sciences, Purdue University, August 2002–2008 Post-doctoral Fellow, Dept. of Speech and Hearing, University of Hong Kong, August, 1999– July, 2002 Research Assistant (Part-time), Dept. of Psychology, University of Chicago, 1995–1999 Graduate Research Assistant, C-3 Group (Computer Research and Applications), Los Alamos National Laboratories, Summer 1993 FUNDED RESEARCH NIH New R01 Program Award: Does effortful listening induce physiological stress? PI. Purdue University Office of Research and Partnerships and Office of the Provost. $29,928. December 1, 2015-June 30, 2017. Provost’s Fellowship for Study in a Second Discipline: Psychophysiology of Listening Effort. PI. Purdue University. $7,000. August 15, 2014 – May 15, 2015. Alexander L. Francis, p. 2 FUNDED RESEARCH (continued) Do older adults attend to speech differently than younger adults? PI (with Joshua Alexander). -

US 1.Fm.Ipl.EA2530 ID=43005
SPATIAL COGNITION IN HUMANS JANELLEN HUTTENLOCHER Janellen Huttenlocher was born in 1932 in Buffalo, New York. She received her B.A. at the University of Buffalo, and her M.A. and Ph.D. at Harvard University. She has been teaching at the University of Chicago since 1974. Current position: William S. Gray Pro- fessor of Psychology and Chairperson, Committee on Developmental Psychology, University of Chicago. Her research concerns various aspects of cognitive development: quantitative development, the development of spatial understanding, and the development of language. She is particularly interested in the role of the child’s environment in the development of cognitive skills. In addition, her work includes research on conceptual representation and memory. Recommended Reading: Huttenlocher, J., L. V. Hedges, and J. L. Vevea. „Why Do Categories Affect Stimulus Judgment?” Journal of Experimental Psychology: General 129 (2000). Huttenlocher, J., S. Duffy, and S. Levine. “Infants and Toddlers Discriminate Amount: Are They Measuring?” Psychological Science 13 (2002). Huttenlocher, J., M. Vas- ilyeva, E. Cymerman, and S. Levine. “Language Input and Child Syntax.” Cognitive Psy- chology 45, 3 (2002). – Address: Department of Psychology, University of Chicago, 5848 South University Avenue, Chicago, IL 60637, USA. I worked on several projects as part of the spatial cognition group. I have been invited to contribute a chapter on the development of spatial cognition to the next revision of the main reference text in developmental psychology, Handbook of Child Psychology, which is very widely used in the field. The chapter includes various topics not covered in my book and reorganizes the material. I recently obtained important new findings, with broad im- plications for spatial development, that people code specific locations (e. -

University of Chicago Psychology Department Newsletter
Share this: December 2016 The State of the Department Rebecca Anne Boylan Professor in Education and Society and Psychology Department Chair Susan C. Levine highlights some of the department's most important news- from a new faculty hire to news about our newest group of graduate students. She also shares sad news and memories about the recent passing of Janellen Huttenlocher. Full Story» Getting High and Memory Distortion As the movement to legalize marijuana marches across the US, more people are wondering how this mind-altering drug affects memory and cognition. According to David Gallo, cannabis is known to cause forgetting in laboratory studies, but surprisingly few studies have investigated the drug’s effect on memory distortion. Full Story» The Department Welcomes Daniel Yurovsky The Department of Psychology welcomes new assistant professor Daniel Yurovsky. Yurovsky studies how we learn from the people around us, and especially how children learn language. Full Story» Collaborative Teaching at Chicago When are two teachers better than one? Faculty in the psychology department have brought team science into the classroom by offering innovative courses that draw from the expertise of faculty in different areas. Full Story» Sabbatical Stories Every few years, faculty in the Department of Psychology have the opportunity to take a sabbatical, allowing them additional time to focus on their scholarly interests without the usual responsibilities of teaching and service. Here we highlight the accomplishments of Jean Decety and Leslie Kay during their 2015-2016 sabbatical year. Full Story» Friends and Alumni Support the Department Several gifts to the Psychology Department have allowed us to continue to offer an alumni lecture series, support graduate student research and conference travel, and support undergraduate research during the summer quarter. -

Similarity Space Theories and the Problem of Concept Acquisition
Similarity Space Theories and the Problem of Concept Acquisition This page intentionally left blank SIMILARITY SPACE THEORIES AND THE PROBLEM OF CONCEPT ACQUISITION PhD Thesis in Philosophy 2019 José Vicente Hernández Conde University of the Basque Country Supervisor Professor Agustín Vicente Benito (cc)2019 JOSE VICENTE HERNANDEZ CONDE (cc by-nc-nd 4.0) This page intentionally left blank For Julia and Julia This page intentionally left blank Declaration I hereby declare that this dissertation is my own original work and that, to the best of my knowledge and belief, it contains no material previously published or written by another person, except where due acknowledgement is made in the text. I also declare that no part of this thesis has been previously submitted, either in the same or different form, for the award of any other degree at this or any other university. José Vicente Hernández Conde This page intentionally left blank Summary Abstract One of the main problems of concept empiricism is to explain the acquisition of the most basic constituents of concepts, without resorting to preexisting innate elements. The aim of this thesis is to show that the best nativist arguments against the acquisition of (primitive) concepts rest on the assumption that the constituents of concepts should be available beforehand, as an input of the acquisition process. However, I will claim that there is no obligation to accept such a (precedence) assumption. In fact, I will describe a model where the constituents of a concept result from the same learning process by vir- tue of which that concept is acquired. -

How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition
THE NATIONAL ACADEMIES PRESS This PDF is available at http://nap.edu/9853 SHARE How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition DETAILS 384 pages | 7 x 10 | PAPERBACK ISBN 978-0-309-07036-2 | DOI 10.17226/9853 AUTHORS BUY THIS BOOK Committee on Developments in the Science of Learning with additional material from the Committee on Learning Research and Educational Practice, National Research Council FIND RELATED TITLES Visit the National Academies Press at NAP.edu and login or register to get: – Access to free PDF downloads of thousands of scientific reports – 10% off the price of print titles – Email or social media notifications of new titles related to your interests – Special offers and discounts Distribution, posting, or copying of this PDF is strictly prohibited without written permission of the National Academies Press. (Request Permission) Unless otherwise indicated, all materials in this PDF are copyrighted by the National Academy of Sciences. Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved. How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition Copyright National Academy of Sciences. All rights reserved. How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition Expanded Edition How People Learn Brain, Mind, Experience, and School Committee on Developments in the Science of Learning John D. Bransford, Ann L. Brown, and Rodney R. Cocking, editors with additional material from the Committee on Learning Research and Educational Practice M. Suzanne Donovan, John D. Bransford, and James W. Pellegrino, editors Commission on Behavioral and Social Sciences and Education National Research Council NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, D.C. Copyright National Academy of Sciences. -
Huttenlocher Hedges
Journal of Experimental Psychology: General Copyright 2000 by the American Psychological Association, Inc. 2000, Vbl. 129, No. 2, 220-241 0096-3445/M/$5.0Q DOT: 10.1Q37//0096-3445.129.2320 Why Do Categories Affect Stimulus Judgment? Janellen Huttenlocher, Larry V. Hedges, and Jack L. Vevea University of Chicago The authors tested a model of category effects on stimulus judgment. The model holds that the goal of stimulus judgment is to achieve high accuracy. For this reason, people place inexactly represented stimuli in the context of prior information, captured in categories, combining inexact fine-grain stimulus values with prior (category) information. This process can be likened to a Bayesian statistical procedure designed to maximize the average accuracy of estimation. If people follow the proposed procedure to maximize accuracy, their estimates should be affected by the distribution of instances in a category. In the present experiments, participants reproduced one-dimensional stimuli. Different prior distributions were presented. The experiments verified that people's stimulus estimates are affected by variations in a prior distribution in such a manner as to increase the accuracy of their stimulus reproductions. It is well known that categorization affects stimulus judgment in which people use prior information, in the form judgment. Two stimuli that are actually equidistant may be of categories, to adjust inexactly represented stimuli; this judged as more similar or may be harder to discriminate if gives rise to bias but improves accuracy by reducing the they are from a common category than if they are from variability of estimates. Indeed, if the goal of stimulus different categories, and an individual stimulus from a judgment is to maximize average accuracy, it would be particular category may be judged closer to the center of that irrational for the cognitive system not to produce biased category than it actually is. -

Curriculum Vitae
KELLY S. MIX ADDRESS: 3304 Benjamin Building University of Maryland College Park, MD 27042 EMAIL: [email protected] PHONE: (301) 405-5914 (office) (301) 405-1632 (lab) EDUCATION: Ph.D., Developmental Psychology, 1995, University of Chicago, Chicago, IL Dissertation: “Preschoolers’ Recognition of Cardinal Equivalence” M.A., Developmental Psychology, 1993, University of Chicago, Chicago, IL B.A., Elementary Education, 1987, Western Michigan University, Kalamazoo, MI Senior Honors Thesis: “Learning Styles and Underachievement in Gifted Children” EMPLOYMENT: Department of Human Development and Quantitative Methodology College of Education University of Maryland College Park, MD Full Professor, 2016 – present Chairperson, 2016- present Department of Counseling, Educational Psychology, and Special Education College of Education Michigan State University East Lansing, MI Full Professor, 2010-2016 Associate Professor, 2005-2010 Department of Psychology Indiana University Bloomington, IN Associate Professor, 2003-2005 Assistant Professor, 1996-2003 Livermore Valley Unified School District Livermore, CA Elementary Teacher, 1987-1990 1 HONORS Irving B. Harris Fellow, University of Chicago, 1991-1995. Boyd McCandless Award (American Psychological Association, Division 7, Early Career Award), 2002. MAJOR RESEARCH GRANTS, AWARDS, AND FELLOWSHIPS: Place Value as a System of Mappings, $1,800,000, National Science Foundation, 2016-2021 (Role; Lead PI, Collaborative Research Project with Linda Smith, Indiana University) SL - CN: A Research-Practice Collaboration to Improve Math Learning in Young Children, $749,998, National Science Foundation, 2015-2018, (Role: Group Leader; PIs are Susan Levine, Sian Beilock, & Jennifer Kubota, Univ. of Chicago). Is Spatial Ability a Malleable Factor for Math Learning?, $1,500,000, Institute of Education Sciences, 2012-17, (Role: Lead PI; Co-PI was Susan Levine, Univ. -

How Children Change Their Minds: Strategy Change Can Be Gradual Or Abrupt
Developmental Psychology Copyright 1999 by the American Psychological Association, Inc. 1999, Vol. 35, No. 1, 127-145 0012-1649/99/$3.00 How Children Change Their Minds: Strategy Change Can Be Gradual or Abrupt Martha Wagner Alibali Carnegie Mellon University This study investigated patterns of change in children's strategies for solving mathematical equivalence problems. The strategies children expressed in speech and in gesture were assessed both before and after an instructional intervention. In the intervention, children received either no input, accuracy feedback, or feedback plus instruction about a principle, an analogy, or a procedure. From pretest to posttest, many children changed both the variability of their strategy use and the content of their strategy repertoires. Patterns of change depended on type of instruction and on children's initial level of variability. Children who received instruction were especially likely to generate new strategies, and children with high variability were especially likely to abandon prior strategies. Gradual change was most common; however, many children modified their repertoires abruptly. Abrupt strategy change was especially prevalent among children who received procedure-based instruction and among children with low initial variability. Developmental researchers typically seek to identify common- Nevertheless, many theoretical accounts of developmental alities in children's behavior. The implicit goal is to identify change accord variability a central explanatory role. Indeed, a consistent patterns that hold across children and across contexts, in variety of theoretical formulations, including Piagetian, neo- an effort to characterize children's predominant way of thinking or Piagetian, information-processing, connectionist, and dynamic behaving at a given age. From this perspective, the "signal" of systems frameworks, posit variability as either a prerequisite for or interest in developmental data must be discerned from the "noise" an indicator of developmental change. -

Handbook of Child Psychology Sixth Edition
HANDBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY SIXTH EDITION Volume Two: Cognition, Perception, and Language Volume Editors DEANNA KUHN and ROBERT SIEGLER Editors-in-Chief WILLIAM DAMON and RICHARD M. LERNER John Wiley & Sons, Inc. HANDBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY HANDBOOK OF CHILD PSYCHOLOGY SIXTH EDITION Volume Two: Cognition, Perception, and Language Volume Editors DEANNA KUHN and ROBERT SIEGLER Editors-in-Chief WILLIAM DAMON and RICHARD M. LERNER John Wiley & Sons, Inc. Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as permitted under Section 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without either the prior written permission of the Publisher, or authorization through payment of the appropriate per-copy fee to the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, (978) 750-8400, fax (978) 646-8600, or on the web at www.copyright.com. Requests to the Publisher for permission should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011, fax (201) 748-6008. Limit of Liability/Disclaimer of Warranty: While the publisher and author have used their best efforts in preparing this book, they make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and specifically disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. -

School Readiness: Closing Racial and Ethnic Gaps
The Future of Children PRINCETON - BROOKINGS School Readiness: Closing Racial and Ethnic Gaps VOLUME 15 NUMBER 1 SPRING 2005 3 Preface 5 Introducing the Issue 15 Assessment Issues in the Testing of Children at School Entry 35 Can Family Socioeconomic Resources Account for Racial and Ethnic Test Score Gaps? 55 Genetic Differences and School Readiness 71 Neuroscience Perspectives on Disparities in School Readiness and Cognitive Achievement 91 Low Birth Weight and School Readiness 117 Health Disparities and Gaps in School Readiness 139 The Contribution of Parenting to Ethnic and Racial Gaps in School Readiness 169 Early Childhood Care and Education: Effects on Ethnic and Racial Gaps in School Readiness A PUBLICATION OF THE WOODROW WILSON SCHOOL OF PUBLIC AND INTERNATIONAL AFFAIRS AT PRINCETON UNIVERSITY AND THE BROOKINGS INSTITUTION The Future of Children seeks to translate high-level research into information that is useful to policymakers, practitioners, and the media. The Future of Children is a publication of the Woodrow Wilson School of Public and Interna- tional Affairs at Princeton University and the Brookings Institution. Senior Editorial Staff Journal Staff Sara McLanahan Elisabeth Hirschhorn Donahue Editor-in-Chief Associate Editor Princeton University Princeton University Director of the Center for Research on Brenda Szittya Child Wellbeing and Professor of Sociology Managing Editor and Public Affairs Brookings Institution Ron Haskins Margy Waller Senior Editor Outreach Director Brookings Institution Brookings Institution Senior