Dossier Nr. 118
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Year 6 English Teacher's Guide 1
Nguzu Nguzu English Teacher’s Guide 1 Standard 6 First Edition 2005 Published in 2005 by the Curriculum Development Centre P.O. Box G27 Honiara Solomon Islands Copyright © Ministry of Education and Human Resources Development 2005 All rights reserved. Any parts of the book may be copied, reproduced or adapted to meet the local needs without permission from the authors, provided that parts reproduced are distributed free, for educational purposes only. Written permission must be obtained from the Curriculum Development Centre if any part of this book is to be reproduced for profit. ISBN 978-982-371-099-0 The development of this Teacher’s Guide was funded by the Solomon Islands Government, with assistance from the New Zealand Agency for International Development, the European Union and the U.K. Department for International Development. Printing and production was completed with assistance from the New Zealand Agency for International Development. Foreword This Standard 6 English Teacher’s Guide has been developed to make English teaching and learning more natural and more relevant to the needs of Solomon Islands’ pupils and teachers. Through exposure to the English Language, pupils learn its vocabulary, grammatical rules and pronunciation. Fluency and understanding are developed through practice in speaking and listening activities and literacy is promoted through reading and writing activities. The emphasis in the upper years of primary is on functional literacy; reading and writing for a range of specific purposes and audiences. Reading for meaning is central to the objectives. Reading to research factual information and reading for pleasure and enjoyment are emphasised through the inclusion of a range of factual and fiction texts. -

Foreigners.Pdf
Cover (front and back): Wild Africans Tamed by His Name ca. 1895 Title inscribed verso 151 by 199 mm. Gelatin silver print Right British School English Camel Corps, Sudan 1884/5 Title inscribed verso 305 by 390 mm (shown cropped) MICHAEL GRAHAM-STEWART Pencil, watercolour 2 0 1 1 1/ 2/ L. Chagny Henry James Pidding (1797-1864) Les Rois en Exil. Presentations Royales. The Fair Penitent Amis, tous amis 1830 Title and signature imprinted. Verso with Signed lower right. Title taken from the L. Chagny, dessin-edit., 44, r. Michelet, Alger, mezzotint by William Giller after Pidding postal stamps and inscribed with address 305 by 255 mm and message Oil on panel 95 by 138 mm Seen in isolation this image of an African Lithograph, postcard suffering a medieval punishment in the This apparently charming postcard, mailed English countryside appears to be a within Algeria in 1906, is a reminder of an harmless oddity. However, the same intense period of French colonial expansion. model is shown in the companion painting The three monarchs shown had all been by Pidding, entitled Massa out, Sambo forcibly exiled to villas in or around Algiers. werry dry, in which a servant is liberally They all died there. partaking of his absent master’s liquor. The group on the left includes the Both paintings were exhibited in the annual distinctively hatted figure of Behanzin Society of British Artists show at Suffolk (1841-1906), King of Dahomey. After a long Street (in 1830 and 1828) and both were campaign he had surrendered to a French engraved, thus reaching a wide audience. -

Year 5 English Pupil's Book 4
Nguzu Nguzu English Pupil’s Book 4 Standard 5 First Edition 2005 Published in 2005 by the Curriculum Development Centre P.O. Box G27 Honiara Solomon Islands Copyright © Ministry of Education and Human Resource Development 2005 All rights reserved. Any parts of the book may be copied, reproduced or adapted to meet the local needs without permission from the authors, provided that parts reproduced are distributed free, for educational purposes only. Written permission must be obtained from the Curriculum Development Centre if any part of this book is to be reproduced for profit. ISBN 982-371-088-0 The development of this Pupil’s Book was funded by the Solomon Islands Government with assistance from the New Zealand Agency for International Development, the European Union and the UK Department for International Development. Printing and production of this Pupil’s Book was completed with assistance from the New Zealand Agency for International Development. Nguzu Nguzu English Standard 5 Pupil’s Book 4 A Note to the Pupils This book has been written to help you to understand, speak, read and write English. You will find that the reading texts and activities are about things which you know about already. There are stories and recounts about everyday life in Solomon Islands and around the Pacific Region. There are factual reports, instructions and explanations about things that you see around you every day. There are exposition texts in which people express their opinions about issues that affect your lives. This should help you to learn to use English with confidence. To talk and write about your own experiences and ideas, wherever you live in Solomon Islands. -

Development of Market Information System for Solomon Island Timbers
DRAFT European Union Secretariat of the Pacific Community Facilitating Agricultural Commodity Trade Project (FACT) Development of a Market Information System for Solomon Islands Timbers March 2009 Secretariat of the Pacific Community Suva, Fiji Prepared by: Salwood Asia Pacific Pty Ltd Canberra, Australia Authors: Stephen Midgley Richard Laity Contributors: Eugenia Katsigiris Peter J. Eddowes Alan Brown DRAFT ©The authors 2009 Cover photograph: Hardwood logs arriving at Honiara port DISCLAIMER Qualifications Salwood Asia Pacific Pty Ltd ACN 108 926 656 is a registered business name with the Registrar General’s Office of the Government of the Australian Capital Territory. The person responsible for the preparation of this document is Mr Stephen Midgley, RPF, who was assisted by Profes- sional Intern, Mr Richard Laity. Mr Midgley has had substantial experience in the forest industry and has formal qualifications from the Australian Na- tional University. He has worked in the forestry sector in Australia and overseas for CSIRO, Government agencies and private companies. His work has been recognised internationally and he is a member of the Institute of Foresters of Australia and a Registered Professional Forester (RPF). Mr Laity is a graduate forester from the ANU with experience as an Australian Youth Ambassador in the Solomon Islands. Declaration This report has been prepared at the request of Dr Lex Thomson, Project Team Leader, SPC Facilitating Agricultural Commodity Trade Project, and the Responsible Officer for the Project. Disclaimer The statements and opinions contained in the document are given in good faith, but in the preparation of this document, Stephen Midgley, has relied, in part, on information supplied from other sources. -

Spirits and Headhunters: Art of the Pacific Islands
Spirits and Headhunters: Art of the Pacific Islands February 13, 2010 and ongoing Guest Curator – Chris Rainier Amulet (Hei Tiki), 18th century Māori people, New Zealand, Polynesia Greenstone and wax; 2 ¾” x 1 3/4 “ Bowers Museum Docent Tour Development Materials Prepared by Mary Jane Schrader Approved by Nancy Warzer-Brady, Vice President of Education Peggy Hannawell, Docent Guild Education Chairman January 2010 Sacred Figure, 20th century Tolai People, West New Britain Province Papua New Guinea, Melanesia Wood, paint and fiber TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 3 WALL COPY FOR EXHIBITION Introductory Label 4 Pacific Migration 4 Stone Tools 5 Polynesia 5 Micronesia 5 Melanesia 6 New Guinea: Land of the Headhunter 6 Sepik River Men’s House 6 The Art of Warfare 6 The Art of the Asmat: Land of the Bis Pole 7 Ritual and Magic 7 The Art of Adornment 7 The Art of Feasting 7 The Price of a Bride 8 Where Masks Still Dance 8 Baining Fire Dance 8 Epilogue 8 FEATURED EXHIBITION ARTIFACTS 9 EXTRA REFERENCES Useful Information for Tour Development 17 Glossary 18 Supplementary Enrichment 22 Bowers Museum Docent Tour Development Materials - 1/14/2010 MJS 2 INTRODUCTION Orator’s Stool (Teket), 20th century Iatmul people; Middle Sepik River region, East Sepik Province, Papua New Guinea, Melanesia Wood; 36 3/8 x 18 1/8 x 19 1/2 in. Photographer Chris Rainier guest curates this exhibition of art from the South Pacific. Spanning the geographic region collectively referred to as Oceania, this comprehensive exhibition highlights masterworks from the three cultural regions of Micronesia, Melanesia, and Polynesia. -
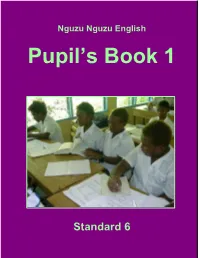
Pupil's Book 1
Nguzu Nguzu English Pupil’s Book 1 Standard 6 1 First Edition 2005 Published in 2005 by the Curriculum Development Centre P.O. Box G27 Honiara Solomon Islands Copyright © Ministry of Education and Human Resources Development 2005 All rights reserved. Any parts of the book may be copied, reproduced or adapted to meet the local needs without permission from the authors, provided that parts reproduced are distributed free, for educational purposes only. Written permission must be obtained from the Curriculum Development Centre if any part of this book is to be reproduced for profit. ISBN 978-982-371-103-4 The development of this Pupil’s Book was funded by the Solomon Islands Government, with assistance from the New Zealand Agency for International Development, the European Union and the U.K. Department for International Development. Printing and production was completed with assistance from the New Zealand Agency for International Development. 2 Nguzu Nguzu English Standard 6 Pupil’s Book 1 A Note to the Pupils This book has been written to help you to understand, speak, read and write English. You will find that the reading texts and activities are about things which you know about already. There are stories and recounts about everyday life in Solomon Islands, around the Pacific region and in the wider world. There are factual reports, instructions and explanations about things that you see around you every day and there are exposition texts in which people express their opinions about issues that affect your lives. This should help you to learn to use English with confidence and to talk and write about your own experiences and ideas, wherever you live in Solomon Islands. -

Teachers and Education in the Pacific (TEP): a Desk Study Report
Teachers and Education in the Pacific (TEP): A desk study report Commissioned by AusAID- ADB as Phase I – Laying the Foundation of a Three-phased regional Pacific project, 2007 - 2009 by Seu’ula Johansson Fua, PhD (Principal Researcher) Kabini F Sanga, PhD (Project Director/Team Leader) Implemented by the Institute of Education in collaboration with Pacific communities December 2007 ACKNOWLEDGEMENTS This study could not have been done without the support of numerous organisations and people, including the following: AusAID and ADB as the donors, with AusAID funding phase 1 of the project. National Departments, Ministries of Education and Teachers‟ Colleges of participating countries Members of the Advisory board of this study such as: Dr „Ana Taufe‟ulungaki – Pro VC Research and Graduate Affairs, USP Professor Konai Thaman – UNESCO Chair for Teacher and Culture, USP Aileen Savu - Office for Development and Planning, USP Dr Akhila Sharma – Head of School of Education, USP Dr Akaniki Kedrayate, A/Dean Faculty of Arts and Law, USP Helen Tavola – Forum Secretariat Richard Wah – SPBEA Ana Raivoce – SPBEA Govinda Singh –COPE Dr Priscilla Puamau – PATE Ministry of Education Fiji James Agigo (PNG) and Eperesa Esera (Samoa) who were subcontracted conduct desk review of their respective countries. Colleagues of the IOE; including Henry Elder, Frances Pene, Cherry Rota, Cherry Kaake, Marlie Rota and Anjula Devi, who have supported the study team throughout the study. 2 CONTENTS ABBREVIATIONS ................................................................................................................................................................. -

Jack London Exposition Temporaire
Musée d’Aquitaine EXPOSITION TEMPORAIRE JACK LONDON DANS LES MERS DU SUD 29 mai - 2 décembre 2018 PREMIER DEGRÉ Exposition temporaire AIDE À LA VISITE À LA VISITE AIDE DOSSIER PÉDAGOGIQUE DOSSIER SOMMAIRE L’exposition au musée d’Aquitaine 5 > Jack London et le voyage du Snark 9 > Hawaï 12 > Archipel des Marquises 14 > Îles de la Société 17 > Archipel des Samoa 18 > Les îles Fidji 21 > Nouvelles Hébrides 22 > Îles Salomon 25 > Fin du voyage Pour une exploitation pédagogique 27 > Repères dans les programmes 28 > PEAC Pré-requis à la visite de l’exposition Ateliers proposés au musée 29 > Prolongements de la visite en classe Bibliographie 38 > Bibliographie, documentation et sites Ce dossier a été réalisé à partir du catalogue de l'expostion : L'ODYSSÉE DU SNARK - 1907-1908. JACK LONDON DANS LES MERS DU SUD. Michel Viotte et Marianne Pourtal-Sourrieu Éd. La Martinière, 2017 L’exposition au musée d’Aquitaine [... J’aimerais mieux être un météore superbe, et que chacun de mes atomes brille d’un magnifique éclat, plutôt qu’une planète endormie. La fonction propre de l’homme est de vivre, non d’exister. Je ne perdrai pas mes jours à essayer de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps...] Jack London 1. Jack London et le voyage du Snark Jack London (1876-1916) Il est l’écrivain américain le plus célèbre de son temps. Il a connu une enfance pauvre dans la baie de San Francisco, puis a été tour à tour vagabond, chercheur d’or dans les étendues sauvages du grand Nord canadien, marin explorateur des archipels des mers du Sud ; mais aussi rancher, militant socialiste passionné, photo-reporter de guerre en Corée et au Mexique. -
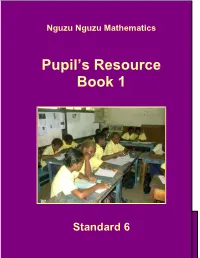
Pupil's Resource Book 1
Nguzu Nguzu Mathematics Pupil’s Resource Book 1 Standard 6 1 First Edition 2005 Published in 2005 by the Curriculum Development Centre P.O. Box G27 Honiara Solomon Islands Copyright © Ministry of Education and Human Resources Development 2005 All rights reserved. Any parts of the book may be copied, reproduced or adapted to meet the local needs without permission from the authors, provided that parts reproduced are distributed free, for educational purposes only. Written permission must be obtained from the Curriculum Development Centre if any part of this book is to be reproduced for profit. ISBN 978-982-371-113-3 The development of this Pupil’s Resource Book was funded by the Solomon Islands Government, with assistance from the New Zealand Agency for International Development, the European Union and the U.K. Department for International Development. Printing and production was completed with assistance from the New Zealand Agency for International Development. 2 Nguzu Nguzu Mathematics Standard 6 Pupil’s Resource Book 1 3 Acknowledgements The Ministry of Education and Human Resources Development would like to thank the following people whose work has led to the development of the Standard 6 Nguzu Nguzu Mathematics programme. Curriculum Development Centre Team Franco Rodi, Director CDC Jacob Zikuli, PEDP Curriculum Officer Linda Puia, PEDP Curriculum Officer David Sokaika, PEDP Curriculum Officer Ellen Wairiu, PEDP Curriculum Officer Lionel Damola, PEDP Curriculum Officer Alison Blaylock, PEDP Adviser Ewa Czernuszewicz, Consultant Adviser Illustrators Jackson Onahikeni, PEDP Graphic Artist Paul Maesala Luke Douglas Rae Desk Top Publisher Alison Blaylock Funding Agencies New Zealand Agency for International Development (NZAID) European Union (EU) UK Department for International Development (DFID) Important Note This Pupil’s Resource Book belongs to the school. -

Huellas SOBRE EL CAMINO 7
(…) Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar… Comienza una nueva etapa. La aventura se transforma en conquista y asentamiento permanente; la arribada de navegantes sedientos en procesos de dominación e interacción cultural; las misiones en nuevas formas de pensar y sentir; la búsqueda de riquezas en intercambios comerciales. 7.HUELLAS SOBRE Dos siglos y medio de un camino y unos barcos llenos de productos, armas y monedas, pero también de hombres, palabras e ideas que arraigan en sus EL CAMINO destinos y crean lazos de unión que aun hoy perviven. El tiempo traerá nuevos rumbos e inquietudes, pero las finas estelas que un día unieron dos océanos y tres continentes aún permanecen como ventanas en el espacio, recordándonos que un camino de ida y vuelta sobre la mar nos convirtió, a pesar de las distancias, en lo que hoy somos. Entre LA conquista, LA explotación Y EL respeto Antonio Sánchez de Mora, Archivo General de Indias, Sevilla La dura realidad de la conquista transformó las sociedades americanas y asiáticas e impuso un dominio que hirió las almas y acabó con la vida de muchos naturales, pero no vino sola. Algunas autoridades civiles y eclesiásticas alzaron sus voces contra los abusos y en pro de los derechos indígenas, a quienes se les consideraba hombres libres y súbditos de la Corona. Las denominadas Leyes de Burgos son el primer eslabón que, desde la oficialidad de la corte, sentaba las bases de un largo camino hacia la plenitud de derechos del hombre, hacia el respeto de unos y otros. -

Trophies, Relics and Curios?
& Wingfield (eds) & Wingfield Knowles Jacobs, Trophies, Relics and Trophies, Curios? The British Missionary movement, which began in earnest in the early Trophies, Relics and Curios? Relics and Trophies, Relics and 19th century, was one of the most extraordinary movements of the last two centuries, radically transforming the lives of people in large parts of the globe, including in Europe itself. By exploring a range of artefacts, photographs and archival documents that Curios? have survived, or emerged from, these transformations, this volume sheds an oblique light on the histories of British Missionaries in Africa and the Pacific, and the ways in which their work is remembered in different parts of the Missionary Heritage from world today. Africa and the Pacific Short contributions describing the histories of particular items, accompanied by rich visual imagery, showcase the extraordinary l items that were caught up in histories of conversion, and are still controversial for many today. By focusing on the varied forms of missionary heritage, this volume aims to question the often used categories of trophies, relics or curios, and highlight the complexity involved in the missionary encounter. This volume is the result of a research networking project bringing together specialists of missionary collections, i.e. artefacts, photographs or archival documents. These specialists are academics of various disciplines, museum curators and indigenous stakeholders who aim to show to a wide audience what missionary heritage constitutes and how varied it is. The heritage in focus is based in museums, archives, churches and archaeological sites in Britain, the Pacific and Africa. With contributions by Ben Burt of the British Museum, Sagale Buadromo of the Fiji Museum, Ghanaian artist, art historian and curator Atta Kwami, Jack Thompson of the University of Edinburgh, Steven Hooper of the Sainsbury Research Unit, Joshua Bell of the Smithsonian Institute, Samoan artist Greg Semu and many more. -
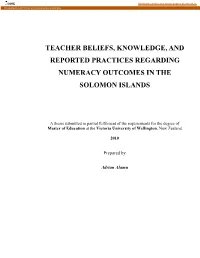
Teacher Beliefs, Knowledge, and Reported Practices Regarding Numeracy Outcomes in the Solomon Islands
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by ResearchArchive at Victoria University of Wellington TEACHER BELIEFS, KNOWLEDGE, AND REPORTED PRACTICES REGARDING NUMERACY OUTCOMES IN THE SOLOMON ISLANDS A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Education at the Victoria University of Wellington, New Zealand 2010 Prepared by Adrian Alamu ABSTRACT The low level of basic numeracy achievement in the Solomon Islands education system is a growing concern to key stakeholders. Apart from monitoring numeracy standards, no attempt has been made to explore how Solomon Islands teachers structure mathematics teaching and learning, or the quality and effectiveness of teaching and learning in schools. It has been widely recognised that teachers’ beliefs, knowledge, and practices are major influences in teaching and learning mathematics in classroom situations. Therefore, the purpose of this study is to explore Solomon Islands primary school teachers’ beliefs, knowledge, reported practices, and professional learning experiences that enhance numeracy outcomes. The review of literature thus focuses on teacher beliefs about mathematics, its teaching, and learning; teacher pedagogical content knowledge; and professional development. Sixteen mainly urban based primary school teachers were interviewed to explore teachers’ beliefs, pedagogical content knowledge, and professional learning experiences. A phenomenological approach to qualitative methodology was adopted to explore the phenomenon. A methodological triangulation of data collection was used involving a Belief Cards exercise and a semi-structured interview protocol. The combination of these methods helped to provide a coherent picture of teacher beliefs, knowledge, and practices. The results were analysed using interpretative phenomenological analysis. The findings of the Belief Cards exercise showed that individual teachers held disparate and inconsistent views and beliefs about mathematics, its teaching, and learning.