Das Hochmittelalterliche Seefernhandelszentrum Von Hormoz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Household Knowledge and Practices Concerning Malaria and Indoor
Madani et al. Parasites & Vectors (2017) 10:600 DOI 10.1186/s13071-017-2548-z RESEARCH Open Access Household knowledge and practices concerning malaria and indoor residual spraying in an endemic area earmarked for malaria elimination in Iran Abdoulhossain Madani1, Moussa Soleimani-Ahmadi1,2*, Sayed Hossein Davoodi3, Alireza Sanei-Dehkordi2, Seyed Aghil Jaberhashemi4, Mehdi Zare5 and Teamur Aghamolaei1 Abstract Background: Indoor residual spraying of insecticide (IRS) is a key intervention for reducing the burden of malaria infection. Effectiveness and success of this strategy are to a considerable extent dependent on knowledge and practice of the target community regarding the IRS. Iran has entered the malaria elimination phase, and IRS has been considered as the main strategy for malaria vector control. Therefore, this study was conducted to determine the household knowledge and practices about malaria and IRS in Bashagard County, one of the malaria-endemic areas in the southeast of Iran. Methods: A community-based cross-sectional survey was conducted among 420 households in Bashagard County. The participants who were selected using a two-stage randomized cluster sampling procedure were subjected to a tested structured questionnaire. During the survey, direct observations were made concerning the use of IRS as well as housing conditions. The data were coded and analysed using SPSS version 19. Results: Knowledge levels about malaria as a disease and the mosquito as its vector were high and of equal magnitude (85.5% and 85.4%, respectively), while knowledge levels of IRS were even higher (91.6%). The main source of households’ information about malaria and IRS was primarily community health workers (73.3%). -
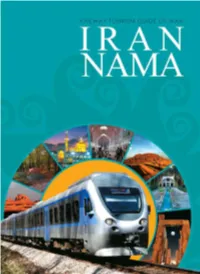
See the Document
IN THE NAME OF GOD IRAN NAMA RAILWAY TOURISM GUIDE OF IRAN List of Content Preamble ....................................................................... 6 History ............................................................................. 7 Tehran Station ................................................................ 8 Tehran - Mashhad Route .............................................. 12 IRAN NRAILWAYAMA TOURISM GUIDE OF IRAN Tehran - Jolfa Route ..................................................... 32 Collection and Edition: Public Relations (RAI) Tourism Content Collection: Abdollah Abbaszadeh Design and Graphics: Reza Hozzar Moghaddam Photos: Siamak Iman Pour, Benyamin Tehran - Bandarabbas Route 48 Khodadadi, Hatef Homaei, Saeed Mahmoodi Aznaveh, javad Najaf ...................................... Alizadeh, Caspian Makak, Ocean Zakarian, Davood Vakilzadeh, Arash Simaei, Abbas Jafari, Mohammadreza Baharnaz, Homayoun Amir yeganeh, Kianush Jafari Producer: Public Relations (RAI) Tehran - Goragn Route 64 Translation: Seyed Ebrahim Fazli Zenooz - ................................................ International Affairs Bureau (RAI) Address: Public Relations, Central Building of Railways, Africa Blvd., Argentina Sq., Tehran- Iran. www.rai.ir Tehran - Shiraz Route................................................... 80 First Edition January 2016 All rights reserved. Tehran - Khorramshahr Route .................................... 96 Tehran - Kerman Route .............................................114 Islamic Republic of Iran The Railways -
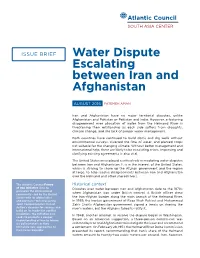
Water Dispute Escalating Between Iran and Afghanistan
Atlantic Council SOUTH ASIA CENTER ISSUE BRIEF Water Dispute Escalating between Iran and Afghanistan AUGUST 2016 FATEMEH AMAN Iran and Afghanistan have no major territorial disputes, unlike Afghanistan and Pakistan or Pakistan and India. However, a festering disagreement over allocation of water from the Helmand River is threatening their relationship as each side suffers from droughts, climate change, and the lack of proper water management. Both countries have continued to build dams and dig wells without environmental surveys, diverted the flow of water, and planted crops not suitable for the changing climate. Without better management and international help, there are likely to be escalating crises. Improving and clarifying existing agreements is also vital. The United States once played a critical role in mediating water disputes between Iran and Afghanistan. It is in the interest of the United States, which is striving to shore up the Afghan government and the region at large, to help resolve disagreements between Iran and Afghanistan over the Helmand and other shared rivers. The Atlantic Council Future Historical context of Iran Initiative aims to Disputes over water between Iran and Afghanistan date to the 1870s galvanize the international when Afghanistan was under British control. A British officer drew community—led by the United States with its global allies the Iran-Afghan border along the main branch of the Helmand River. and partners—to increase the In 1939, the Iranian government of Reza Shah Pahlavi and Mohammad Joint Comprehensive Plan of Zahir Shah’s Afghanistan government signed a treaty on sharing the Action’s chances for success and river’s waters, but the Afghans failed to ratify it. -

Federal Register/Vol. 85, No. 11/Thursday, January 16, 2020
2814 Federal Register / Vol. 85, No. 11 / Thursday, January 16, 2020 / Notices SPECIAL PERMITS DATA—Continued Application Regulation(s) Number Applicant affected Nature of the special permits thereof 20988–N ....... I-k-i Manufacturing Co., Inc ..... 173.306(a)(5) ........................... To authorize the transportation in commerce of inner recep- tacles containing flammable gas that are eligible for the lim- ited quantity exception in 49 CFR 173.306(a)(5). (modes 1, 2, 3, 4, 5). 20990–N ....... Psc Custom Lp ........................ 172.101(i)(3) ............................ To authorize the transportation in commerce of methane gas in nurse tanks. (mode 1). 20991–N ....... Veolia ES Technical Solutions 173.51, 173.54(a), 173.56(b), To authorize the one-time, one-way transportation of unap- LLC. 173.21(b). proved cartridges for tools for the purpose of disposal. (mode 1). 20992–N ....... Daicel Safety Systems Amer- 173.302a(a)(1), 178.65(c)(3) ... To authorize the manufacture, marking, sale, and use of non- icas, Inc. DOT specification cylinders (pressure vessels) for use as components of automobile vehicle safety systems. These pressure vessels may be charged with non-toxic, non-lique- fied gases or mixtures thereof. (modes 1, 2, 3, 4, 5). [FR Doc. 2020–00604 Filed 1–15–20; 8:45 am] interests in property subject to U.S. 6. PEREZ LINARES, Conrado Antonio, BILLING CODE 4909–60–P jurisdiction of the following persons are Trujillo, Venezuela; DOB 24 May 1982; blocked under the relevant sanctions Gender Male; Cedula No. V–15584063 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA]. authorities listed below. Designated pursuant to section 1(a)(ii)(C) of DEPARTMENT OF THE TREASURY Individuals: E.O. -

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Studia Iranica Upsaliensia 13
ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Studia Iranica Upsaliensia 13 Koroshi A Corpus-based Grammatical Description Maryam Nourzaei, Carina Jahani, Erik Anonby, and Abbas Ali Ahangar Abstract Nourzaei, M., Jahani, C., Anonby, E., and Ahangar, A. A., 2015. Koroshi. A Corpus-based Grammatical Description. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Iranica Upsaliensia 13. 315 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-9267-0. The Korosh people are scattered across large areas of southern Iran, from Hormozgan all the way to Khuzestan, and onto the Iranian plateau. This group, which numbers over 10,000 people, is found in significant concentrations near Bandar Abbas in Hormozgan Province, in north-western Fars Province around Shiraz, and across the southern part of Fars Province. Although oral accounts situate the provenance of the Korosh in Balochistan, and their language is closely related to southern varieties of Balochi, they have a distinct identity. Some affirm a his- torical and ethnic connection to the Baloch, but others view themselves as an autonomous tribe; in north-western Fars Province, members of the group maintain an affiliation with the larger Qašqā’i tribal confederacy. The present work contributes to the study of the Korosh through the lens of their language, Koroshi. The corpus for this study has been gathered among speakers of the dialect of Koroshi spoken around Shiraz. The book opens with a brief overview of the Korosh people and their culture. The main part of the study consists of an in-depth, corpus-based description of the pho- nology and morphosyntax of the Koroshi language; a corpus of seven glossed and translated texts of different genres; and a glossary of more than 1200 items. -

Unclaimed Deposits
UNCLAIMED DEPOSITS Sr NAME ADDRESS No 1 CHANDRAKAN SWAMI NARAYAN WADI,GROUND FLOOR, 399/405,V. P. T R ROAD,MUMBAI,MAHARASHTRA,IN,400004 SURYAWANSHI 2 NEERAJ I 132, KIRTI NAGAR,NEW DELHI,DELHI,IN,110015 MEDIRATTA 3 NIKHIL JAIN K 112, WESTERN AVENUE,SAINIK FARMS,NEW DELHI,DELHI,IN,110062 4 SUDHANVA 692, SRI NIKETAN COLONY,ROAD NO. 3,BANJARA HILLS,HYDERABAD,ANDHRA SUNDARARAM PRADESH,IN,500034 AN 5 HIREN FLAT NO.52, PEARL BUILDING, OFF.JUHU LANE, NEAR KHOJA SANGHVI JAMATKHANA,ANDHERI C.H.S., ANDHERI (WEST)MUMBAI,MAHARASHTRA,IN,400058 6 AMANDEEP 43, ADVENT,GENERAL J R B SINGH CHAHAL MARG,MANTRALAYA,MUMBAI,MAHARASHTRA,IN,400021 7 ANITA AL SORRENTO ETHIRAJA RESIDENCY,54, BESANT AVENUE ROAD,OPP. ADAYAR TRIPATHY POST OFFICE, ADAYAR,CHENNAI,TAMIL NADU,IN,600020 8 ANEISH THE BANK OF NEWYORK,12TH FLOOR EXPRESS TOWERS,NARIMAN KUMAR POINT,MUMBAI,MAHARASHTRA,IN,400021 9 DHARMENDRA 28,C/O KAPIL MATCHING CENTRE,THIRD FLOOR,GODOWN STREET,CHENNAI,TAMIL KUMAR NADU,IN,600001 SOODA 10 GOVIND A 1 / 147, 2 ND FLOOR,PASCHIM VIHAR,NEW DELHI,DELHI,IN,110063 PANDEY 11 GOYAL MG A 38, FIRST FLOORMOHAN CO OPERATIVE INDL ESTATEMAIN MATHURA ROADNEW GASES PVT LTD DELHI,DELHI,IN,110044 RIF ESCROW A/C 12 GAURAV FIRST FLOOR, B 50,MALKA GANJ,NEW DELHI,DELHI,IN,110007 AHUJA 13 RAVI SIDHOO NEHRU CENTRE, 9th FLOORDISCOVERY OF INDIADR A.B. ROAD, WORLIMUMBAI,MAHARASHTRA,IN,400018 14 MITHUN 9 / 4, PRABHU STREET,VETRINAGAR,CHENNAI,TAMIL NADU,IN,600082 DUTTA 15 VRUSHALI ROOM NO 215,SHYAM WADI,GOKHALE ROAD (S),SAITAN STANLEY CHOWKI,DADARMUMBAI,MAHARASHTRA,IN,400028 DSOUZA 16 HIMMATLAL 8, JAGANNATH PARK,NR. -

As Sanctions “Snap-Back” Approaches, Fincen Advisory Emphasizes Risks to the U.S
As Sanctions “Snap-Back” Approaches, FinCEN Advisory Emphasizes Risks to the U.S. and International Financial Systems Posed by Iran By John B. Reynolds, Jeanine P. McGuinness, Will Schisa & Britt Mosman on October 15, 2018 POSTED IN ANTI-MONEY LAUNDERING, ECONOMIC SANCTIONS, GUIDANCE & FAQS On October 11, 2018, the Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”) issued a lengthy “Advisory on the Iranian Regime’s Illicit and Malign Activities and Attempts to Exploit the Financial System,” (the “Iran Advisory”), which provides examples and typologies of the Iranian regime’s exploitation of financial institutions worldwide, and identifies a number of “red flags” intended to assist financial institutions in identifying malign Iranian activity. According to FinCEN, the Iran Advisory is intended to assist financial institutions in light of the United States’ withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (“JCPOA”) and the re-imposition of U.S. sanctions previously lifted under the JCPOA, while also reminding financial institutions of regulatory obligations under the Bank Secrecy Act and the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010. As the November 5, 2018 date for full re-imposition of secondary sanctions waived under the JCPOA grows near, the publication of the Iran Advisory is a further signal that the U.S. Government is moving aggressively to isolate Iran financially and economically. In stark terms, the Iran Advisory warns both U.S. and non-U.S. financial institutions to be conscious of their obligations under sanctions administered by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) to prevent any use (both direct and indirect) of their U.S. -

Settlement Agreement Parties Apparent Violations
DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C. 20220 SETTLEMENT AGREEMENT This settk:ment agreement (the "Agreement') is made by and between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Coitrol (OF AC) and UniCredt Bank Austria AG ("Banlc Austria"). I. PARTIES I. OFAC admiiisters and enforces economic sanctions against targeted foreign countries, regimes, terrorists, international narcotics traffickers, and protiferators of weapons of mass destruction, among others. OFAC acts under Presidential national emergency authorities, as wen as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze assets under U.S . juisdiction. 2. Banlc ,Austria is the Austrian subsidiary of UniCredt S.p.A., the parent company ofth: UniCredit Group headquartered ii Mian, Italy. Banlc Austria is headquartered in Vienna, Austria. II. APPARENT VIOLATIONS 3. OF AC conducted an investigation of Bank Austria in connection wlh more than 120 transactions processed to or through the Unted States or involving U.S. fmnc ial institutions in apparent violation of various OF AC sanctions programs. 4. OF AC detennined that Banlc Austria did not voluntarily self-disclose the Apparent Violations, the Apparent Violations identified below i1 Paragraph 15 constlute a non egregious case, and the Apparent Violations identified below i1 Paragraphs 16-20 corntitute an egregious case. DI. FAcrtJAL STATEMENT 5. For a nurooer of years, up to and including 2012, Banlc Austria processed transactions tlv'ough U.S. fiiancial ilstitutions that involved countries, entities, or individuals subject to the sanctions programs administered by OF AC. Banlc Austria appears to have engaged in conduct that removed, omitted, or did not reveal references to, or the interest or involvement o~ sanctioned parties in U.S. -

Iran Last Updated: July 16, 2021 Overview Iran Holds Some of the World’S Largest Proved Crude Oil Reserves and Natural Gas Reserves
Background Reference: Iran Last Updated: July 16, 2021 Overview Iran holds some of the world’s largest proved crude oil reserves and natural gas reserves. Despite Iran’s abundant reserves, crude oil production stagnated and even declined between 2012 and 2016 as a result of nuclear-related international sanctions that targeted Iran’s oil exports and limited investment in Iran's energy sector. At the end of 2011, in response to Iran’s nuclear activities, the United States and the European Union (EU) imposed sanctions, which took effect in mid-2012. These sanctions targeted Iran’s energy sector and impeded Iran’s ability to sell oil, resulting in a nearly 1.0 million barrel-per-day (b/d) drop in crude oil and condensate exports in 2012 compared with the previous year.1 After the oil sector and banking sanctions eased, as outlined in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in January 2016, Iran’s crude oil and condensate production and exports rose to pre-2012 levels. However, Iran's crude oil exports and production again declined following the May 2018 announcement that the United States would withdraw from the JCPOA. The United States reinstated sanctions against purchasers of Iran’s oil in November 2018, but eight countries that are large importers of Iran’s oil received six-month exemptions. In May 2019, these waivers expired, and Iran’s crude oil and condensate exports fell below 500,000 b/d for the remainder of 2019 and most of 2020. According to the International Monetary Fund (IMF), Iran’s oil and natural gas export revenue was $26.9 billion in FY 2015–2016, decreasing more than 50% from $55.4 billion in FY 2014–2015. -

Ecology of Anopheles Dthali Patton in Bandar Abbas District, Hormozgan Province, Southern Iran
Iranian J Arthropod-Borne Dis, (2007), 1(1): 21-27 H Vatandoost et al.: Ecology of Anopheles… Original Article Ecology of Anopheles dthali Patton in Bandar Abbas District, Hormozgan Province, Southern Iran *H Vatandoost, M Shahi, AA Hanafi-Bojd, MR Abai, MA Oshaghi, F Rafii Dept. of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health and Institute of Public Health Research, Medical Sciences/Tehran University, Iran (Received 9 Oct 2006; accepted 19 Feb 2007) ABSTRACT Ecology of Anopheles dthali was studied in Bandar Abbas County, where there is indigenous malaria. Anopheles dthali plays as a secondary malaria vector in the region. It is active throughout the year in mountainous area with two peaks of activity, whereas in coastal area it has one peak. There is no report of hibernation or aestivation for this species in the re- gion. Precipitin tests on specimens from different parts showed that 15.6-20.8% were positive for human blood. This species usually rests outdoors. It has different larval habitats. Insecticides susceptibility tests on adult females exhibited susceptibil- ity to all insecticides recommended by WHO. LT50 for the currently used insecticide, lambda-cyhalothrin, is measured less than one minute. The irritability tests to pyrethroid insecticides, showed that permethrin and lambda-cyhalothrin had more irritancy compared to deltamethrin and cyfluthrin. Larval bioassay using malathion, chlorpyrifos, temephos and fenithrothion did not show any sing of resistance to these larvicides at the diagnostic dose. It is recommended that all the decision makers should consider the results of our study for any vector control measures in the region. -

COUNTRY SECTION Iran (Islamic Republic Of) Fishery Products
Validity date from COUNTRY Iran (Islamic Republic Of) 10/08/2007 00131 SECTION Fishery products Date of publication 18/02/2019 List in force Approval number Name City Regions Activities Remark Date of request 1007 Food Arts Company Bahman Gostar Tabarestan Kordkuy Golestan PP Aq 16/02/2021 1011 Iran Protein Co.(Shilton) Karaj Alborz PP 16/02/2021 1013 Abzian Marjan Bidou Coral Co. Bandar Deylam Boushehr PP Aq 25/09/2020 1015 Pars Abzian Rasoul(Bandar Abbas Branch) Bandarabas Hormozgan PP Aq 25/09/2020 1017 Imen Sarmasazan Jonub Co. Boushehr Boushehr PP Aq 16/02/2021 1019 Cimaye Chabahar Food Industries Chahbahar Sistan and Baluchestan PP Aq 16/02/2021 1021 Khosh Khorak Food Products Company Savojbolagh Alborz PP 16/02/2021 1023 Factory Processing & Packing Fish & Shrimp Ali Bahrani Minab Hormozgan PP Aq 16/02/2021 1025 Iman Poultry Cooperative Co. BANDAR LENGEH Hormozgan PP Aq 25/09/2020 1027 Safar Asadi Refrigerator And Fishery Product BANDAR LENGEH Hormozgan PP Aq 25/09/2020 1029 Tose Padide Fanoos Makran .Co Bandarabas Hormozgan PP Aq 25/09/2020 1031 Aquaculture Cooperative Fars South Zagros Co. Shiraz Fars PP 25/09/2020 1035 Morvarid-e- Ghorogh Of Talesh Caviar Fish Farm Coop. Co Talesh Gilan PP 52, Aq 16/02/2021 1039 Tolou Abi Anamis Bandarabas Hormozgan PP Aq 12/04/2021 1041 Lian Shil Minab Hormozgan PP Aq 15/08/2021 1 / 6 List in force Approval number Name City Regions Activities Remark Date of request 600 Ashoradeh cold store Golestan Golestan PP 602 Anzali sturgeon store Gilan Gilan PP 603 Babolsar cold store Mazandaran Mazandaran -

The Prelude Mission #1 the Initial Mission #2
The Prelude Mission #1 Situation When the President agreed with the Joint Chiefs of Staff on their recommendationto invade IRAN, he made one requirement before approval. Send in a rescue team to bring out of IRAN the CIA operative and top senior nuclear spy. With knowledge of the Iranian nuclear project’s most vital secrets, it was crucial he be extracted before the invasion. Tracked and located in Bandar-e Lergeh this mission must succeed. Task Destroy all threats in vicinity of the CIA operative's location to allow the landing of the rescue copter for extraction. Loss of the copter will be a loss of the mission and the President 's planned invasion will be delayed. Be alert to possible Mig activity Fly Waypoint to Target Ship TACAN 74X Initial BRC 117 degrees ICLS Button7 AWACS 251.0 The Initial Mission #2 Strike on Hormoud power facility. With the rescue of the CIA operative versed in Iranian nuclear secrets during The Prelude mission, the President has given the go ahead for the invasion. To begin the initial phase, the Hormoud power facility and its surrounding equipment and resources have been targeted to reduce available electric power generated for coastal emplacements. Task Use waypoints to navigate to target area. Strike the facility and its surrounding buildings. Destroy any moving vehicles and be aware of airborne threats. Case 3 operations for recovery. CVN-74 Tacan 74X ICLS Button 7 127.5 AM Button 15 Com1 Expect Final Bearing 109 A-10's get to target quickly RTB Tunb Island AFB The Resolute Mission #3 Situation Despite suffering some loses in the beginning missions (The Prelude and The Initial), the Allied Forces are ramping up their attack plans.