H. N. Werkman. Vortrag Von Wolfgang Gl-366Ckner
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Oog in Oog Met Kunst
Werk van Rodin, De Ploeg, glaskunstenaar Dale Chihuly, het gaat allemaal door haar handen. Kunsthistorica Suzanne Rus (28) heeft een droombaan bij het Groninger Museum. Ze wil iets loswoelen bij de bezoekers. JURGEN TIEKSTRA WWW.GRONINGERMUSEUM.NL LOOPBAAN WWW.RUG.NL/MASTERS/CURATORIAL-STUDIES Oog in oog met kunst egin maart dit jaar vloog rond. In Taipei was die expositie tot een einde Suzanne Rus (28) samen met een gekomen en moesten Rus en haar collega collega naar Taipei. Daar in de toezien op de afbouw: een scherpe blik op B hoofdstad van Taiwan was ze een de conditie van de objecten, instrueren van paar dagen lang de engelenbewaarder van de het Taiwanese inpakteam, voor de verzeke- keramieken werken van de Spaanse kunste- raar foto’s maken van de voorwerpen in hun naar Jaime Hayón. Een door het Groninger kisten en zorgen voor containervervoer naar Museum samengestelde tentoonstelling van het volgende museum. Naar Shanghai dit Hayóns werk reist twee jaar lang de wereld keer. Junior conservator Het is een van de taken die Rus, oud-student kunstgeschiedenis, heeft bij het Groninger Museum, waar ze nu anderhalf jaar in vaste Jan Altink, De rode boerderij, 1926 dienst is. Ze kwam bij het museum terecht door als allereerste trainee het nieuwe talent- De museumwereld is klein en gesloten. ontwikkelingstraject te doorlopen. Deze post- Afgestudeerd in 2013 solliciteerde Rus zich graduate functie als junior conservator had tevergeefs een slag in de rondte. ‘Iedereen het Museum samen met de RUG opgezet. blijft zitten waar hij zit,’ vertelt ze. ‘Als je net Inmiddels werkt Rus in het museum als begint heb je geen werkervaring en kom je ‘registrar’, beheerder van de eigen collec- dus nergens binnen. -
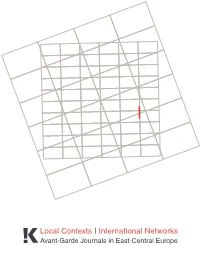
Local Contexts | International Networks
Local Contexts | International Networks Avant-Garde Journals in East-Central Europe Local Contexts / International Networks Avant-Garde Journals in East-Central Europe Edited by Gábor Dobó and Merse Pál Szeredi Petőfi Literary Museum – Kassák Museum Kassák Foundation Budapest, 2018 THE AVANT-GARDE AND ITS JOURNALS 2 Proceedings of the International Conference “Local Contexts / International Networks – Avant-Garde Magazines in Central Europe (1910–1935)” held in the Kassák Museum, 17–19 September 2015 kassakmuzeum.hu/en/index.php?p=kutatas&id=104 Editors Gábor Dobó, Merse Pál Szeredi Assistant Editor Sára Bagdi Proofreading Alan Campbell Cover design Klára Rudas Prepress Bence György Pálinkás DigiPhil Coordination Zsófia Fellegi, Gábor Palkó Publisher Petőfi Literary Museum–Kassák Museum Kassák Foundation Responsible Publisher Gergely Prőhle, Edit Sasvári ISBN 978-963-12-5972-8 © Essays: the authors and editors © Design: Klára Rudas and Bence György Pálinkás © Reproductions: the heirs of the authors CC BY-NC-SA 2.5 Published under the Creative Commons Licence Attribution-NonCommercial- ShareAlike 2.5 Generic (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5). The publication was published as part of the research project of the Petőfi Literary Museum – Kassák Museum ‘The Avant-Garde Journals of Lajos Kassák from an Interdisciplinary Perspective’ (NKFI-K 120779). PB 2 Contents 5 Gábor Dobó – Merse Pál Szeredi Introduction 7 Eszter Balázs Artist and/or Public Intellectual? Hungarian Avant-Garde Polemics on ‘New Art’ and the Writer’s Role and Responsibilities -

The Influence of Interpersonal Relationships on the Functioning of the Constructivist Network
The Influence of Interpersonal Relationships on the Functioning of the Constructivist Network. A Case Study of Poland and the Low Countries De invloed van intermenselijke relaties op het functioneren van het constructivistische netwerk. Een case study van Polen en de Lage Landen Michał Wenderski, Adam Mickiewicz University, Poznań Abstract: This case study explores the entangled history of the constructivist network in the course of the 1920s and 1930s in light of the interpersonal relationships between some of its representatives. In order to analyse the evolution and influence of such relationships on the functioning of the network, I present data and details of two seemingly distant areas, namely Poland and the Low Countries, and of the dynamics between chosen members of Polish, Dutch and Belgian avant-garde formations such as Zwrotnica, Blok, Praesens, De Stijl, Het Overzicht and Cercle et Carré. Based on tangible traces of direct and indirect relationships left in avant-garde magazines and private correspondence between the artists, I describe how particular ties were formed, maintained and terminated, and how they influenced the exchange between the analysed nodes. This analysis is partially based on Granovetter’s renown theory of ‘strong and weak ties’, which examined the nature of interpersonal connections within and between given circles of individuals, with specific focus on the so-called ‘marginal’ individuals, particularly relevant for the description of avant-garde artists and their formations. Keywords: Avant-Garde, Constructivism, -

Het Clandestiene Boek 1940-1945
Lisette Lewin Het clandestiene boek 1940-4945 Van Gennep Amsterdam Het clandestiene boek 1940-1945 Lisette Lewin Het clandestiene boek 1940-1945 Van Gennep Amsterdam 1983 Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door financiele steun van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Omslagfoto: De `schippers' van clandestiene uitgeverij de Blauwe Schuit bij de drukpers van Hendrik Werkman. V.1.n.r. Ate Zuithoff, August Henkels, Hendrik Werkman en Adri Bruning. ©1983 Uitgeverij en boekhandel Van Gennep b y, Nes 128, 1012 KE Amsterdam, Omslagfoto's: Stedelijk Museum Amsterdam (voorkant) en Joop Souverein (achterkant) Boekverzorging: Jacques Janssen Zetwerk: Fototekst by, Almere Druk: Drukkerij Ten Brink Meppel by, Meppel Bindwerk: Kramer Boekbinders by, Apeldoorn CIP-gegevens Lewin, Lisette Het clandestiene boek : 1940-1945 / Lisette Lewin. - Amsterdam : Van Gennep Met reg. SISO 856.7 UDC 82 UGI 510 Trefw. : literatuurgeschiedenis / illegale pers. ISBN 90-6012-550-9 Inhoud Inleiding 7 1 Het K-nummer 13 2 Verzamelingen 20 3 Culturele voorgeschiedenis 29 4 De Nederlandse Kultuurkamer 45 5 Het Letterengilde van binnen 95 6 De Bezige Bij 107 7 Een verspreider 129 8 Een schrijver 133 9 De Blauwe Schuit 139 10 In Agris Occupatis 151 11 Ankie is jarig 158 12 A.A.M. Stols 172 13 De Vijf Ponden Pers 187 14 Het Zwarte Schaap 199 15 Chr. Leeflang 208 16 De Mansarde Pers 215 17 Castrum Peregrini 227 18 De Bayard Pers 241 19 De Molenpers 250 20 De Schildpad-reeks 257 21 Astra Nigra 265 22 De literaire tijdschriften 269 23 Literair proza, poezie en de pers 283 24 Drukkerijen 321 25 Twee drukkers 335 Noten 355 Bibliografie 361 Register 365 Inleiding In Bolsward stond in 1567 een zeventienjarige jongen terecht. -
Graphic D E S I G N 2 0 1 7 C a T a L
modernism101.com rare design books GRAPHIC DESIGN 2017 CATALOG THE MAIL SLOT FOR THE BROWNSTONE ON EAST 70TH STREET featured a sign that simply stated: No Menus. The typography was simple, direct and elegant—and signaled I was indeed at the right address. I nervously adjusted the knot on my tie, squared my blazer, and looked down at the new shoes pinching my toes. My wife had cajoled me into purchasing a wardrobe for this moment. Back then I was used to operating in the shadows and cared little about my appearance. This was different. Molly insisted I look sharp. I rang the buzzer and during the next few seconds reflected on all the roads traveled and all the choices made that funneled me from the hard- scrabble oilfields of West Texas to this sidewalk on the Upper East Side. The heavy door clicked open. It was time to meet Elaine Lustig Cohen. Elaine had introduced herself via email a couple of years before when she contacted me needing some material for the Alvin Lustig monograph she was writing with Steven Heller. She always ended her correspondence with an invitation to visit the next time I was in New York City. I looked forward to her emails and her interest in my affairs made me proud. I was doing something right if the co-founder of Ex-Libris gave her approval. “Come on up Randall,” a disembodied voice invited me from the stairwell to the left. I climbed up into the type of clean, well-lighted space that had only previously existed in my imagination. -

Stedelijk Museum Amsterdam Annual Report 2013
Stedelijk Museum Amsterdam Annual Report 2013 1 Contents Message from the Directors 4 Report from the Supervisory Board 7 Annual Review 9 Exhibitions 11 Collection Purchases and gifts 19 Art Handling 21 Conservation 23 Research and Publications 24 Library and Archive 26 Photography Department 27 Public Program 28 Education and Visitor Services 29 Stedelijk Museum Bureau Amsterdam 31 Marketing and Communication Marketing 34 Press 38 Website and Social Media 40 Development Overview 41 Founders, Sponsors, Donors 46 Stedelijk Museum Business Club (SMBC) 49 Friends of the Stedelijk Museum Amsterdam 51 2 Events and bookings Booking Office 52 Organizational Structure Mission 53 Supervisory Board 55 Credits 57 Supplements: Overviews Collection: Acquisitions, Loans, Conservation Public Program Activities Educational Activities Program Stedelijk Museum Bureau Amsterdam Staff Supplemental activities Financial Statements Annual Director’s Report Financial Report Photo building: John Lewis Marshall 3 Foreword After years of closure, what is it like to be an open, fully functioning museum again? There’s only one word to describe it—exhilarating! After reopening in September 2012, this was our first full year in our wonderful new building. It was a tremendous twelve months in all respects. I was deeply touched by the response of so many people who expressed their delight at having the Stedelijk Museum back in their lives. Our commitment to providing a great visitor experience was richly rewarded with record-level attendance. With 700,000 visitors, 2013 was the most successful year in the museum’s history. Shortly before the new year, we were thrilled to welcome our one millionth visitor since the reopening. -

Contemporary Art
CONTEMPORARY ART The Library of Coosje van Bruggen / Claes Oldenburg projected to be circa 2,500 volumes Partial catalogue June 8, 2018 The Library of Coosje van Bruggen and Claes Oldenburg A towering figure in postwar American art, whose influence, from the start of Pop Art to the present day, has been profound, and whose unmistakable style is instantly recognizable around the world, Claes Oldenburg needs no introduction. His wife and collaborator, the Dutch-American scholar and artist Coosje van Bruggen (1942-2009) had a distinguished career as both a critic and curator of contemporary art, and a widely admired sculptor. Working together over the course of three decades, Oldenburg and van Bruggen produced a series of monumental sculptures, which she termed "Large-Scale Projects," that are among the most iconic of recent years. Their library is a perfect reflection of their work and their interests, with extensive resources on the movements of modern and contemporary art, from Pop and Happenings, Fluxus, Arte Povera, Minimal Art, Conceptual Art, and Land Art, to the developments of the new millenium. In addition to its depth in reference books, the library includes rare historic exhibition catalogues and books of early Minimal and Conceptual art (the publications of Seth Siegelaub, and exceedingly scarce publications from Vancouver and Oberlin, as well as the landmark shows of the 1960s and 1970s), rare periodicals ("Interfunktionen"), and classic source works inscribed by the authors, together with a rich selection of valuable original artists' books, by Carl Andre, John Baldessari, Stanley Brouwn, Hanne Darboven, Peter Downsbrough, Jenny Holzer, Rebecca Horn, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Richard Long, Gerhard Richter, Carolee Schneemann, Emmett Williams, and numerous others. -

Het Idool Hendrik Nicolaas Werkman, Saskia Monshouwer 2015
Het idool H.N. Werkman Gepubliceerd in Raam #3, 2015 Een inleiding In de maanden dat ik als curator werkzaam was en me bezighield met de voorbereidingen van de VOG-Werkmantentoonstelling VRIJHEID VAN GEEST werd bevestigd wat ik eigenlijk al wist: Hendrik Nicolaas Werkman is een iconische figuur en wordt in de wereld van de grafische kunsten ten zeerste bewonderd. Typografen, drukkers, beeldend kunstenaars en taalkunstenaars maken regelmatig van zijn atypische, eenvoudige werkmethoden gebruik. Zijn humor wordt bezongen, zijn kleurgebruik en vakmanschap geroemd. Werkman is een kunstenaar, een heer en humanist. En dat alles en meer komt in de tentoonstelling naar voren. Overigens zijn er, waarschijnlijk juist vanwége de idolatrie die iconen vaak ten deel valt, ook kunstenaars die helemaal niets van zijn werk moeten hebben en scheel van de dansende lettertjes zien, daar is niets aan te doen. Heel bijzonder dus, die artistieke mens en dat unieke oeuvre, maar niet in alle opzichten gemakkelijk te interpreteren. Juist vanwege de vele verschillende kwaliteiten van Werkmans oeuvre, kost het moeite om er achter te komen wát zijn werk nou precies zo bijzonder maakt. Zijn het de letters? Is het de melodieuze manier waarop hij met typografie omgaat? Zou het dat eigenwijze handwerk kunnen zijn? Zonder Werkman in een vakje te willen stoppen, zonder de magie van de som-der-delen te ontkennen, wil ik in dit artikel zijn werk aan de hand van vier opmerkelijke ‘kwaliteiten’ bespreken. Het gaat om vier aspecten van zijn manier van werken die vaak genoemd worden, maar minder vast omschreven zijn dan in eerste instantie lijkt. -
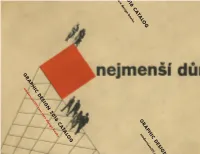
G R a P Hic D Es Ig N
GRAPHIC DESIGN 2016 CATALOG modernism101.com rare design books GRAPHIC DESIGN 2016 CATALOG modernism101.com rare design books GRAPHIC DESIGN 2016 CATALOG modernism101.com rare design books THE PARASITICAL DEPENDENCE ON RITUAL In his 1936 essay “The Work of Art in the Age of Me- chanical Reproduction” Walter Benjamin used the word “aura” to refer to the sense of awe and rever- ence one presumably experienced in the presence of unique works of art. According to Benjamin, this aura inheres not in the object itself but rather in external attributes such as its known line of ownership, its restricted exhibition, its pub- licized authenticity, or its cultural value. Aura is thus indica- tive of art’s traditional association with primitive, feudal, or bourgeois structures of power and its further association with magic and—religious or secular—ritual. With the advent of art’s mechanical reproducibility, and the development of art forms—such as film—in which there is no actual original, the experience of art could be freed from place and ritual and instead brought under the gaze and control of a mass audience, leading to a shattering of the aura. “For the first time in world history,” Benjamin wrote, “mechanical reproduction emancipates the work of art from its parasitical depen- dence on ritual.” Thirty-six years later John Berger carried Benjamin’s ideas further in “Ways of See- ing,”—first in essay form, then a four-part BBC television series, and finally a book— when he explicitly stated that the modern means of production have destroyed the author- ity of art: “For the first time ever, images of art have become ephemeral, ubiquitous, insubstantial, avail- able, valueless, free.” Berger’s early seventies epiphany both predicted and damned our current digital culture by decades. -

Jaarverslag 2010
JAARVERSLAG 2010 5 Voorwoord 10 Presentaties 11 Mendini 0 en 1 15 Ploegpaviljoen 18 Overige expositieruimten 19 Externe locaties 22 Afdeling Collecties 23 Aanwinsten hedendaagse kunst, mode en design 29 Aanwinsten De Ploeg en context 34 Aanwinsten Archeologie, Geschiedenis En Regionale Kunst(Nijverheid) 41 Educatie en Publieksinformatie 49 Informatiecentrum 51 Communicatie/pr/marketing 54 Publieksactiviteiten 57 Commerciële Activiteiten 60 Personeel en Organisatie 63 Publicaties 66 Rekening Groninger Museum 68 Vereniging Van Vrienden Van Het Groninger Museum 71 Subsidiegevers, Begunstigers En Sponsors VOORWOORD Het jaar 2010 stond vooral in het teken van de grootscheepse revitalisatie van het gebouw van het Groninger Museum. De directe aanleiding hiervoor werd gevormd door een vochtprobleem in de vloeren van de hele benedenverdieping. Deze moesten allemaal worden vervangen, wat betekende dat het museum genoodzaakt was enkele maanden te sluiten. Deze gedwongen sluiting werd aangegrepen om een aantal andere zaken aan het gebouw te vernieuwen of te verbeteren. Zo is onder meer de hele buitenkant onder handen genomen. Sommige paviljoens zijn aan de buitenkant grondig gereinigd en waar dat noodzakelijk was zijn de materialen van een nieuwe coating voorzien. De gekleurde panelen van de ‘gouden toren’ en het Mendini Paviljoen waren in de loop der jaren sterk verbleekt en zijn vervangen door meer duurzame materialen die over een veel langere periode kleurecht blijven. Aan de binnenkant zijn onder meer alle publieksruimtes onder handen genomen. Toen het gebouw in 1994 werd geopend, ging men uit van 90.000 bezoekers per jaar; gemiddeld genomen heeft het nieuwe Groninger Museum sinds de opening echter 250.000 bezoekers per jaar gehad. -

50 Years - 50 Books
50 YEARS - 50 BOOKS List of contents 01 Otto Eckmann, Peter Behrens 02 Walter Crane 03 William Morris 04 Aubrey Beardsley 05 Oskar Kokoschka 06 Thomas J. Cobden-Sanderson 07 Marcus Behmer 08 Ernst Barlach 09 Rudolf Koch 10 Rudo Spemann 11 Filippo Tommaso Marinetti 12 El Lissitzky 13 El Lissitzky 14 Ernst Ludwig Kirchner 15 Kurt Schwitters, Käte Steinitz, Theo van Doesburg 16 Vladimir Lebedev 17 Georges Rouault 18 Käte Steinitz 19 Hendrik Nicolaas Werkman 20 Aristide Maillol 21 André Derain 22 Pablo Picasso 23 Jean Dubuffet 24 Joan Miró 25 Jean Lurçat 26 Henri Matisse 27 Gerhard Marcks 28 Henri Laurens 29 Antoni Clavé 30 Georges Braque 31 Hommage à Werkman 32 Imre Reiner 33 Adrian Frutiger 34 Bayrle & Jäger 35 Max Ernst 36 HAP Grieshaber 37 Ray Johnson 38 Horst Antes 39 Guillaume Apollinaire, Ossip Zadkine 40 Diter Rot 41 Günther Uecker 42 Patrick Caulfield 43 Valerio Adami 44 Jasper Johns 45 Wilhelm Neufeld 46 Hamish Fulton 47 Warja Honegger-Lavater 48 Dieter Wagner 49 Rupprecht Geiger 50 John Gerard, Uwe Warnke 51 Bibliography Peter Behrens, Otto Eckmann Peter Behrens, script and decoration Rudhard’sche foundry in Offenbach am Main, 1902 Brochure, grey-brown spotted cover, title sign, 80 pages, typographic printing, 27 x 21 cm. Klingspor-Collection Eckmann, script and ornament material Rudhard’sche foundry in Offenbach am Main, 1902 Brochure, yellow-brown spotted cover, two-coloured printed, 24 pages, typographic printing 28 x 22.5 cm. Present of Reinhard Klingspor, 2003 In the 10th year of their conduction by Karl Klingspor the foundry published two specimen, which prove Klingspor’s cultural and economical success with dealing with central personalities of new script art. -

University of Groningen the Life and Death of the Avant-Garde on the Battlefield of Rhetoric
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Groningen University of Groningen The Life and Death of the Avant-garde on the Battlefield of Rhetoric - and Beyond van den Berg, Hubert Published in: Forum. The University of Edinburgh Postgraduate Journal of Culture and the Arts IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Publication date: 2005 Link to publication in University of Groningen/UMCG research database Citation for published version (APA): van den Berg, H. (2005). The Life and Death of the Avant-garde on the Battlefield of Rhetoric - and Beyond. Forum. The University of Edinburgh Postgraduate Journal of Culture and the Arts, 1(1). Copyright Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Take-down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum. Download date: 12-11-2019 University of Edinburgh Postgraduate Journal of Culture and the Arts Issue 01 | Autumn 2005 Title The Life and Death of the Avant-garde on the Battlefield of Rhetoric – and Beyond Author Dr.