DIE BÖHMISCHEN GENEALOGEN UND IHRE RBE Eine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Surnames in Europe
DOI: http://dx.doi.org./10.17651/ONOMAST.61.1.9 JUSTYNA B. WALKOWIAK Onomastica LXI/1, 2017 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PL ISSN 0078-4648 [email protected] FUNCTION WORDS IN SURNAMES — “ALIEN BODIES” IN ANTHROPONYMY (WITH PARTICULAR REFERENCE TO POLAND) K e y w o r d s: multipart surnames, compound surnames, complex surnames, nobiliary particles, function words in surnames INTRODUCTION Surnames in Europe (and in those countries outside Europe whose surnaming patterns have been influenced by European traditions) are mostly conceptualised as single entities, genetically nominal or adjectival. Even if a person bears two or more surnames, they are treated on a par, which may be further emphasized by hyphenation, yielding the phenomenon known as double-barrelled (or even multi-barrelled) surnames. However, this single-entity approach, visible e.g. in official forms, is largely an oversimplification. This becomes more obvious when one remembers such household names as Ludwig van Beethoven, Alexander von Humboldt, Oscar de la Renta, or Olivia de Havilland. Contemporary surnames resulted from long and complicated historical processes. Consequently, certain surnames contain also function words — “alien bodies” in the realm of proper names, in a manner of speaking. Among these words one can distinguish: — prepositions, such as the Portuguese de; Swedish von, af; Dutch bij, onder, ten, ter, van; Italian d’, de, di; German von, zu, etc.; — articles, e.g. Dutch de, het, ’t; Italian l’, la, le, lo — they will interest us here only when used in combination with another category, such as prepositions; — combinations of prepositions and articles/conjunctions, or the contracted forms that evolved from such combinations, such as the Italian del, dello, del- la, dell’, dei, degli, delle; Dutch van de, van der, von der; German von und zu; Portuguese do, dos, da, das; — conjunctions, e.g. -
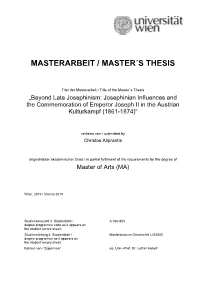
Masterarbeit / Master´S Thesis
MASTERARBEIT / MASTER´S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master´s Thesis „Beyond Late Josephinism: Josephinian Influences and the Commemoration of Emperor Joseph II in the Austrian Kulturkampf (1861-1874)“ verfasst von / submitted by Christos Aliprantis angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2015 / Vienna 2015 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 803 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Masterstudium Geschichte UG2002 degree programme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: ao. Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt For my parents and brother 1 TABLE OF CONTENTS ___________ ACKNOWLEDGMENTS (4) PROLOGUE: I. The Academic Interest on Josephinism: Strenghtenes and Lacunas of the Existing Literature (6) II. Conceptual Issues, Aims, Temporal and Spatial Limits of the Current Study (10) CHAPTER 1: Josephinism and the Afterlife of Joseph II in the early Kulturkampf Era (1861-1863) I. The Afterlife of Joseph II and Josephinism in 1848: Liberal, Conservative and Cleri- cal Interpretations. (15) II. The Downfall of Ecclesiastical Josephinism in Neoabsolutism: the Concordat and the Suppressed pro-Josephinian Reaction against it. (19) III. 1861: The Dawn of a New Era and the Intensified Public Criticism against the Con- cordat. (23) IV. From the 1781 Patent of Tolerance to the 1861 Protestant Patent: The Perception of the Josephinian Policy of Confessional Tolerance. (24) V. History Wars and Josephinism: Political Pamphelts, Popular Apologists and Acade- mic Historiography on Joseph II (1862-1863). (27) CHAPTER 2: Josephinism and the Afterlife of Joseph II during the Struggle for the Confessional Legislation of May 1868 I. -

Higher Education in America and Europe Around 1900
THE COLLEGE OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO HIGHER EDUCATION IN AMERICA AND EUROPE AROUND 1900 SOME PERSPECTIVES ON OUR SHARED HISTORY AND ITS RELEVANCE FOR OUR TIME —— JOHN W. BOYER OCCASIONAL PAPERS ON HIGHER EDUCATION XXIII HIGHER EDUCATION IN AMERICA AND EUROPE AROUND 1900 Some Perspectives on Our Shared History and Its Relevance for Our Time INTRODUCTION he new academic year has begun splendidly, with a number of achievements that would have seemed highly T unlikely just twenty years ago. The incremental work that we rightly celebrate each year culminated in the recent announcement that the College has risen to third in the 2016 U.S. News & World Report national college rankings, up from a ranking of fifteenth on the same list in 2006. These rankings depend on a wide variety of measures. Among these are selectivity, financial resources, class size, graduation and retention rates, alumni giving, and reputation among high-school counselors. We are now in worthy company with our top peers, and while we do not manage the College for the sake of these rankings, we can allow ourselves to be gratified to see the University of Chicago publicly acknowledged in this way. Chicago also fared well in the newest international research rankings organized by ShanghaiRank- ing and the London Times, ranking ten and ten respectively out of many hundreds of institutions. The international rankings are less interested in undergraduate admissions or in undergraduate education, focusing This essay was originally presented as the Annual Report to the Faculty of the College on October 18, 2016. John W. Boyer is the Martin A. -

ANHALT (Haus Askanien) Evangelischer Konfession. Wappen
ANHALT (Haus Askanien) Evangelischer Konfession. Wappen (Stammwappen Askanien):- Gespalten, rechts in Silber ein golden- bewehrt rot Adler am Spalt, links von Schwarz und Gold neunmal geteilt, belegt mit schrägrechts Rautenkranz. Auf dem Helm mit schwarz-golden Decken zwei natürlich Pfauenfederbüsche an nach innen abgebogenen und verschränkten, von Schwarz und Gold geviert Stäben (die Pfauenfederbüsche werden später von 2 von Schwarz und Gold geviert verschränkten Armen gehalten). Die Nachgeborenen und deren Gemahlinnen führen den Titel und Namen Prinz beziehungsweise Prinzessin von Anhalt (Hoheit). Die Prinzer führen auch den Titel Herzog von Sachsen, Graf zu Ascanien. EDUARD Julius Ernst August Erdmann, HERZOG VON ANHALT, Herzog von Sachsen, Engern und Westfalen, Graf zu Ascanien, Herr zu Zerbst, Bernburg und Gröbzig, usw., geb. Schloß Ballenstedt 3. Dez. 1941, Sohn des Herzogs Joachim Ernst (geb. 11. Januar 1901; W 18. Febr. 1947; Succ. Sein Vater unter der Regentschaft seines Onkels Albert, der in seinem Namen abdankte12. Nov. 1918) und Edda Marwitz von Stephani (geb. 20. Aug. 1905; W 22. Febr. 1986); verm. München 21 Juli 1980 (standesamtl.) und St. Scharl, Schweiz 7. Juni 1986 (kirchl.), Corinna (geb. Würzburg 19. Aug. 1961), Tochter des Günther Krönlein und Anneliese geb. Benz. [Jagdschloß Röhrkopf, D-06493, Ballenstedt; Unterdiessen D-86944]. Töchter 1. Prinzessin Julia Katharina, geb. Bad Tölz 14. Dez. 1980. 2. Prinzessin Julia Eilika Nicole, geb. München 3. Januar 1985. 3. Prinzessin Julia Felicitas Leopoldine Friederike Franziska, geb. München 14. Mai 1993. Geschwister 1. Prinzessin Marie Antoinette Elisabeth Alexandra Irmgard Edda Charlotte, geb. Schloß Ballenstedt 14. Juli 1930, W Memmingen 22. März 1993; verm. I. Lahr 24. -

The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860
The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860 Conception – Implementation – Aftermath Edited by Christof Aichner and Brigitte Mazohl VERÖFFENTLICHUNGEN DER KOMMISSION FÜR NEUERE GESCHICHTE ÖSTERREICHS Band 115 Kommission für Neuere Geschichte Österreichs Vorsitzende: em. Univ.-Prof. Dr. Brigitte Mazohl Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stauber Mitglieder: Dr. Franz Adlgasser Univ.-Prof. Dr. Peter Becker Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Bruckmüller Univ.-Prof. Dr. Laurence Cole Univ.-Prof. Dr. Margret Friedrich Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Garms-Cornides Univ.-Prof. Dr. Michael Gehler Univ.-Doz. Mag. Dr. Andreas Gottsmann Univ.-Prof. Dr. Margarete Grandner em. Univ.-Prof. Dr. Hanns Haas Univ.-Prof. i. R. Dr. Wolfgang Häusler Univ.-Prof. i. R. Dr. Ernst Hanisch Univ.-Prof. Dr. Gabriele Haug-Moritz Dr. Michael Hochedlinger Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt Mag. Thomas Just Univ.-Prof. i. R. Dr. Grete Klingenstein em. Univ.-Prof. Dr. Alfred Kohler Univ.-Prof. Dr. Christopher Laferl Gen. Dir. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner Dr. Stefan Malfèr Gen. Dir. i. R. H.-Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky Dr. Gernot Obersteiner Dr. Hans Petschar em. Univ.-Prof. Dr. Helmut Rumpler Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Scheutz em. Univ.-Prof. Dr. Gerald Stourzh Univ.-Prof. Dr. Arno Strohmeyer Univ.-Prof. i. R. Dr. Arnold Suppan Univ.-Doz. Dr. Werner Telesko Univ.-Prof. Dr. Thomas Winkelbauer Sekretär: Dr. Christof Aichner The Thun-Hohenstein University Reforms 1849–1860 Conception – Implementation – Aftermath Edited by Christof Aichner and Brigitte Mazohl Published with the support from the Austrian Science Fund (FWF): PUB 397-G28 Open access: Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License. -

The Austrian Imperial-Royal Army
Enrico Acerbi The Austrian Imperial-Royal Army 1805-1809 Placed on the Napoleon Series: February-September 2010 Oberoesterreicher Regimente: IR 3 - IR 4 - IR 14 - IR 45 - IR 49 - IR 59 - Garnison - Inner Oesterreicher Regiment IR 43 Inner Oersterreicher Regiment IR 13 - IR 16 - IR 26 - IR 27 - IR 43 Mahren un Schlesische Regiment IR 1 - IR 7 - IR 8 - IR 10 Mahren und Schlesischge Regiment IR 12 - IR 15 - IR 20 - IR 22 Mahren und Schlesische Regiment IR 29 - IR 40 - IR 56 - IR 57 Galician Regiments IR 9 - IR 23 - IR 24 - IR 30 Galician Regiments IR 38 - IR 41 - IR 44 - IR 46 Galician Regiments IR 50 - IR 55 - IR 58 - IR 63 Bohmisches IR 11 - IR 54 - IR 21 - IR 28 Bohmisches IR 17 - IR 18 - IR 36 - IR 42 Bohmisches IR 35 - IR 25 - IR 47 Austrian Cavalry - Cuirassiers in 1809 Dragoner - Chevauxlégers 1809 K.K. Stabs-Dragoner abteilungen, 1-5 DR, 1-6 Chevauxlégers Vienna Buergerkorps The Austrian Imperial-Royal Army (Kaiserliche-Königliche Heer) 1805 – 1809: Introduction By Enrico Acerbi The following table explains why the year 1809 (Anno Neun in Austria) was chosen in order to present one of the most powerful armies of the Napoleonic Era. In that disgraceful year (for Austria) the Habsburg Empire launched a campaign with the greatest military contingent, of about 630.000 men. This powerful army, however, was stopped by one of the more brilliant and hazardous campaign of Napoléon, was battered and weakened till the following years. Year Emperor Event Contingent (men) 1650 Thirty Years War 150000 1673 60000 Leopold I 1690 97000 1706 Joseph -

Peter Harrington London
Summer Miscellany Peter Harrington london 136 We are exhibiting at these fairs: 8–10 September 2017 brooklyn Brooklyn Antiquarian Book Fair Brooklyn Expo Center 79 Franklin St, Greenpoint, Brooklyn, NY www.brooklynbookfair.com 7–8 October pasadena Antiquarian Book, Print, Photo & Paper Fair Pasadena Center, Pasadena, CA www.bustamante-shows.com/book/index-book.asp 14–15 October seattle Seattle Antiquarian Book Fair Seattle Center Exhibition Hall www.seattlebookfair.com 3–5 November chelsea Chelsea Old Town Hall Kings Road, London SW3 www.chelseabookfair.com 10–12 November boston Boston International Antiquarian Book Fair Hynes Convention Center bostonbookfair.com 17–19 November hong kong China in Print Hong Kong Maritime Museum www.chinainprint.com VAT no. gb 701 5578 50 Front cover illustration by John Minton from Elizabeth David’s A Book of Mediterranean Food, item 68 Peter Harrington Limited. Registered office: WSM Services Limited, Connect House, Illustration above of Bullock’s Museum from John B. Papworth’s Select Views of London, item 162 133–137 Alexandra Road, Wimbledon, London SW19 7JY. Design: Nigel Bents; Photography Ruth Segarra Registered in England and Wales No: 3609982 Peter Harrington london catalogue 136 Summer Miscellany All items from this catalogue are on exhibition at Dover Street mayfair chelsea Peter Harrington Peter Harrington 43 Dover Street 100 Fulham Road London w1s 4ff London sw3 6hs uk 020 3763 3220 uk 020 7591 0220 eu 00 44 20 3763 3220 eu 00 44 7591 0220 usa 011 44 20 3763 3220 usa 011 44 7591 0220 Dover St opening hours: 10am–7pm Monday–Friday; 10am–6pm Saturday www.peterharrington.co.uk 1 1 ACKERMANN, Rudolph (publ.) The Mi- crocosm of London; or, London in Min- iature. -

ES Institucijų Vertimo Į Lietuvų Kalbą Vadovas
Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas Interinstitutional Style Guide for Translators in the Lithuanian Language Community Liuksemburgas, 2014 TURINYS PRATARMĖ .................................................................................................................................. 5 ĮVADAS ......................................................................................................................................... 6 A. SKIRIAMIEJI ŽENKLAI IR JŲ VARTOJIMAS ............................................................. 8 A.1. Taškas .................................................................................................................................. 8 A.2. Kabliataškis ........................................................................................................................ 11 A.3. Dvitaškis ............................................................................................................................ 11 A.4. Brūkšnys ............................................................................................................................ 13 A.4.1. Brūkšnys kaip skyrybos ženklas (su tarpais) ............................................................ 13 A.4.2. Brūkšnys kaip rašybos ženklas (be tarpų) ................................................................ 13 A.5. Minuso ir pliuso ženklai ..................................................................................................... 15 A.6. Brūkšnelis ......................................................................................................................... -

The Fall of an Imperial Ambassador: Count Georg Adam Von Martinitz and His Recall from Rome
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Repository of the Academy's Library 247 Béla Vilmos MIHALIK The Fall of an Imperial Ambassador: Count Georg Adam von Martinitz and His Recall from Rome Abstract: The paper discusses the changes in the diplomatic relations between Rome and Vienna during the embassy tenure of Count Georg Adam von Martinitz (1696–1700). The series of his conflicts with the Holy See (e.g., the scandal at the Corpus Christi procession, the affairs of the imperial feuds in Italy and finally a poisoning attempt) deteriorated his situation at the Roman Curia. That resulted in his being denied Papal audiences and the recall of Martinitz from Rome. But it should have been anticipated by his relatives in Vienna. Martinitz received another Imperial Court posting, although he was not satisfied with it. Although he inherited most of these conflicts, he was not able to dissolve them; in fact, he made some of them worse. His successor, Count Leopold Joseph von Lamberg, arrived to Rome with the task “to put water on the fire”. But it was not an easy task, especially on the eve of the War of the Spanish Succession. Keywords: Habsburg – diplomacy – Rome – Papal Court – Martinitz he last two decades of the seventeenth century were marked by three popes. Innocent XI is the best known of them: he symbolized the organization of the Holy League and the beginnings of the Great Turkish War (1683–1699). His papacy Tis still one of the most researched from the post-Westphalia period.1 The relationship between Innocent XI and the Habsburg Court in Vienna was examined by Vilmos Fraknói, whose work is still required reading for the period, mostly in regard to the Great Turkish War. -
Otto Von Bismarck
Otto von Bismarck For other uses, see Bismarck (disambiguation). port, against the advice of his wife and his heir. While Germany’s parliament was elected by universal male suf- frage, it did not have real control of the government. Bis- Otto Eduard Leopold, Prince of Bismarck, Duke of Lauenburg (1 April 1815 – 30 July 1898), known as marck distrusted democracy and ruled through a strong, well-trained bureaucracy with power in the hands of a tra- Otto von Bismarck, was a conservative Prussian states- man who dominated German and European affairs from ditional Junker elite that comprised the landed nobility of the 1860s until 1890. In the 1860s he engineered a se- the east. Under Wilhelm I, Bismarck largely controlled ries of wars that unified the German states (excluding domestic and foreign affairs, until he was removed by Austria) into a powerful German Empire under Prussian young Kaiser Wilhelm II in 1890. leadership. With that accomplished by 1871 he skillfully Bismarck, an aristocratic Junker himself, had an ex- used balance of power diplomacy to preserve German tremely aggressive and domineering personality. He dis- hegemony in a Europe which, despite many disputes and played a violent temper and kept his power by threat- war scares, remained at peace. For historian Eric Hobs- ening to resign time and again. He possessed not only bawm, it was Bismarck, who “remained undisputed world a long-term national and international vision, but also champion at the game of multilateral diplomatic chess for the short-term ability to juggle many complex develop- almost twenty years after 1871, [and] devoted himself ex- ments simultaneously. -

Spicilegium Historicum
Annus 66 2018 Fasc. 1 SPICILEGIUM HISTORICUM Congregationis SSmi Redemptoris Congregationis Ssmi Redemptoris Ssmi Congregationis I S T O R I CU M H PICILEGIUM S Collegium S. Alfonsi de Urbe Annus LXVI 2018 Fasc. 1 Collegium S. Alfonsi de Urbe SPICILEGIUM HISTORICUM Congregationis SSmi Redemptoris Annus XLVI 2018 Fasc. 1 Collegium S. Alfonsi de Urbe La Rivista SPICILEGIUM HISTORICUM Congregationis SSmi Redemptoris è una pubblicazione dell’Istituto Storico della Congregazione del Santissimo Redentore DIRETTORE Adam Owczarski SEGRETARIO DI REDAZIONE Emilio Lage CONSIGLIO DI REDAZIONE Alfonso V. Amarante, Álvaro Córdoba Chaves, Emilio Lage, Martin Macko, Adam Owczarski DIRETTORE RESPONSABILE Alfonso V. Amarante SEDE Via Merulana, 31, C.P. 2458 I-00185 ROMA Tel. [39] 06 494901 e-mail: [email protected]; [email protected] Con approvazione ecclesiastica Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 310 del 14 giugno 1985 Ogni collaboratore si assume la responsabilità di ciò che scrive. SIGLE E ABBREVIAZIONI AGHR Archivum Generale Historicum Redemptoristarum, Roma APNR Archivio della Provincia Napoletana CSSR, Pagani (SA) ASV Archivio Segreto Vaticano BAV Bibliotheca Apostolica Vaticana Bibl. Hist. Bibliotheca Historica CSSR, edita dall’Istituto Storico CSSR, Roma 1955 ss. Acta integra = Acta integra capitulorum generalium CSSR ab anno 1749 usque ad annum 1894 celebratorum, Romae 1899 Analecta = «Analecta CSSR», 1 (Roma 1922) – BOLAND = Samuel J. BOLAND, A Dictionary of the Redemptorists, Roma 1987 CARTEGGIO = S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Carteggio, I, a cura di G. Orlandi, Roma 2004; Carteggio, II, a cura di G. Orlandi, Roma 2018 Codex regularum = Codex regularum et constitutionum CSSR..., Romae 1896 DE MEULEMEESTER, Bibliographie = Maurice DE MEULEMEESTER, Bibliographie générale des écrivains rédemptoristes, 3 voll., Louvain 1933-1939 DE MEULEMEESTER, Histoire = Maurice DE MEULEMEESTER, Histoire sommaire de la Con- grégation du Très-Saint Rédempteur, Louvain 1958 DE MEULEMEESTER, Origines = Maurice DE MEULEMEESTER, Origines de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur. -

Alojz Peterle
INSIDE EU aid to the most deprived Brexit Inter-institutional relations POLITICS, POLICY AND PEOPLE Issue 383 3 February 2014 follow us on @Parlimag ROCK AND TOLL Spain-Gibraltar border dispute rumbles on CCS Chris Davies says Europe must look beyond ‘short-term xes’ CASHING OUT? EU raises stakes in ght against money laundering and terrorist nancing FEATURE ALOJZ PETERLE ... says world cancer day aims to ‘debunk myths’ surrounding the disease 01 PM.indd 1 30/01/2014 18:31:28 ALL EU CONTACTS AT YOUR FINGERTIPS EUROPEAN UNION AND PUBLIC AFFAIRS DIRECTORY The essential guide to the institutions and public affairs community in Brussels NEW EDITION INCLUDES: • Fully updated contact details for all EU institutions • Brand new Policy Index introduced in our comprehensive public affairs section • Contact information for all key representatives of new member state Croatia ORDER YOUR COPY TODAY For 240€ or get it for free for every subscription to our online database Dods People EU. Request an online demo today! email: [email protected] | visit: www.dodsshop.co.uk #climate4growth is a forum for all relevant and interested parties involved in formulating and thinking about climate and energy policy in the European Union. It was launched by the Ministry of Foreign Aairs of Poland in September 2013 and engages stakeholders in a discussion about the best and most eective methods for pursuing the future climate and energy policy, in a way that protects EU The forthcoming #climate4growth event, The core objective of #climate4growth is and Member States’ competitiveness and a high-level Stakeholder Roundtable to to promote collaborative and constructive creates sustainable economic growth.