Dossier Nr. 85
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fiji's Road to Military Coup, 20061
2. 'Anxiety, uncertainty and fear in our land': Fiji's road to military coup, 20061 Brij V. Lal Introduction If civilization is to survive, one is driven to radical views. I do not mean driven to violence. Violence always compromises or ruins the cause it means to serve: it produces as much wrong as it tries to remedy. The State, for example, is always with us. Overthrow it and it will come back in another form, quite possibly worse. It's a necessary evilÐa monster that continually has to be tamed, so that it serves us rather than devours us. We can't do without it, neither can we ever trust it.2 Fiji experienced the whole gamut of emotions over the course of a fateful 2006. The year ended on an unsettled note, as it had begun. Fiji was yet again caught in a political quagmire of its own making, hobbled by manufactured tensions, refusing to heed the lessons of its recent tumultuous past, and reeling from the effects of the coup. Ironies abound. A Fijian army confronted a Fijian government, fuelling the indigenous community's worst fears about a Fijian army spilling Fijian blood on Fijian soil. The military overthrow took place 19 years to the day after frustrated coup-maker of 1987 Sitiveni Rabuka had handed power back to Fiji's civilian leaders, Ratu Sir Penaia Ganilau and Ratu Sir Kamisese Mara, paving the way for the eventual return to parliamentary democracy. The 2006 coup, like the previous ones, deposed a democratically elected government. Perhaps more importantly, it peremptorily sidelined the once powerful cultural and social institutions of the indigenous community, notably the Methodist Church and the Great Council of Chiefs (GCC)3 ± severing with a startling abruptness the overarching influence they had exercised in national life. -

The Case of Fiji
University of Michigan Journal of Law Reform Volume 25 Issues 3&4 1992 Democracy and Respect for Difference: The Case of Fiji Joseph H. Carens University of Toronto Follow this and additional works at: https://repository.law.umich.edu/mjlr Part of the Comparative and Foreign Law Commons, Cultural Heritage Law Commons, Indian and Aboriginal Law Commons, and the Rule of Law Commons Recommended Citation Joseph H. Carens, Democracy and Respect for Difference: The Case of Fiji, 25 U. MICH. J. L. REFORM 547 (1992). Available at: https://repository.law.umich.edu/mjlr/vol25/iss3/3 This Article is brought to you for free and open access by the University of Michigan Journal of Law Reform at University of Michigan Law School Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in University of Michigan Journal of Law Reform by an authorized editor of University of Michigan Law School Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. DEMOCRACY AND RESPECT FOR DIFFERENCE: THE CASE OF FIJI Joseph H. Carens* TABLE OF CONTENTS Introduction ................................. 549 I. A Short History of Fiji ................. .... 554 A. Native Fijians and the Colonial Regime .... 554 B. Fijian Indians .................. ....... 560 C. Group Relations ................ ....... 563 D. Colonial Politics ....................... 564 E. Transition to Independence ........ ....... 567 F. The 1970 Constitution ........... ....... 568 G. The 1987 Election and the Coup .... ....... 572 II. The Morality of Cultural Preservation: The Lessons of Fiji ................. ....... 574 III. Who Is Entitled to Equal Citizenship? ... ....... 577 A. The Citizenship of the Fijian Indians ....... 577 B. Moral Limits to Historical Appeals: The Deed of Cession ............. ....... 580 * Associate Professor of Political Science, University of Toronto. -

C:\Users\User\Desktop\Dr Hasan Colgis\Kertas Kerja\MOHD FO'ad
Politics of Accommodation, Power Sharing and Consociational Democracy Dr. Mohd Foad Sakdan Dr. Oemar Hamdan Political of Accommodation The concept of accommodation refers to pragmatic solution to divisive conflicts by abandoning the principles of unilateral majority decisions and including representatives of the main group in the organs of government and decision marking. The political of accommodation is based mainly on a recognition of the need for political stability, and not necessarily on a recognition in principle of the right of all group in society to participation, representation and equal status. Therefore, the more societal and political a particular group has, the more willingness there will be to consider it as a partner to the politics of accommodation.1 The political potential of a group is not determined exclusively or even mainly by its electoral achievements or even its coalition bargaining position. Other important factors are recognition of the legitimacy of the value and interests represented by group and acceptance of the group as part of the social and cultural consensus. Meanwhile, political stability in the country has been attributed to the political system that could be called `an elite accommodation model' or `consociational model' in which each ethnic community is unified under a leadership that can authoritatively bargain for the interests of that community. The leaders of each community, in turn, have the capacity to secure compliance and legitimacy for the bargains that are reached by elite negotiations. Under such circumstances, there exists sufficient trust and empathy among the elite to be sensitive to the most vital concerns of other ethnic communities. -

Reflections on the First Anniversary of Fiji's 2006 Coup
30. One hand clapping: Reflections on the first anniversary of Fiji’s 2006 coup Brij V. Lal The tyranny of a prince in an oligarchy is not so dangerous to the public welfare as the apathy of a citizen in a democracy. Montesquieu Acquiescence is the friend of illegality. Justice Roger Coventry The first anniversary of Fiji's December 2006 coup passed uneventfully, without any rallies, protest marches or vigils ± merely an exhausted, scarcely audible mutter from the populace hankering for some semblance of normality. A Fijian political activist once likened Fiji to a swimming duck: All calm on the surface but furiously churning underneath. Just how much turbulence there was among indigenous Fijians is difficult to gauge, but its existence was beyond doubt. To forestall any organized opposition, the interim administration slapped on several states of emergency. Overall, 2007 remained a depressing and miasmic year, with much movement but little change. The military's much heralded `clean-up' campaign, the principal reason for the coup, was stalled, mired in controversy about its legal validity and true purpose. No one was successfully prosecuted for the misdemeanours for which they had been unceremoniously sacked from office. The judiciary, to everyone's disappointment, remained as divided and demoralized as ever. The constitution remained intact, but often `ignored or bypassed as deemed necessary'.1 International vigilance, manifested in travel bans on members of the interim administration, remained despite official pleas for sympathetic understanding and assistance. Fundamental changes to the electoral system were mooted, including a common non-racial electoral roll, a common name for all citizens, and reform of important institutions of indigenous governance, but there was reservation among many who were already distrusting of the interim administration's motives and its counterproductive confrontational approach to sensitive issues. -

Elections and Politics in Contemporary Fiji
Chiefs and Indians: Elections and Politics in Contemporary Fiji Brij V. Lal 1he Republic of Fiji went to the polls in May 1992, its first election since the military coups of 1987 and the sixth since 1970, when the islands became independent from Great Britain. For many people in Fiji and out side, the elections were welcome, marking as they did the republic's first tentative steps toward restoring parliamentary democracy and interna tional respectability, and replacing rule by decree with rule by constitu tionallaw. The elections were a significant event. Yet, hope mingles eerily with apprehension; the journey back to genuine representative democracy is fraught with difficulties that everyone acknowledges but few know how to resolve. The elections were held under a constitution rejected by half of the pop ulation and severely criticized by the international community for its racially discriminatory, antidemocratic provisions. Indigenous Fijian po litical solidarity, assiduously promoted since the coups, disintegrated in the face of the election-related tensions within Fijian society. A chief-spon sored political party won 30 of the 37 seats in the 7o-seat House of Repre sentatives, and was able to form a government only in coalition with other parties. Sitiveni Rabuka, the reluctant politician, became prime minister after gaining the support of the Fiji Labour Party, which he had over thrown in 1987, and despite the opposition of his predecessor and para mount chief of Lau, Ratu Sir Kamisese Mara. In a further irony, a consti tutional system designed to entrench the interests of Fijian chiefs placed a commoner at the national helm. -

The Role of Overseas Missions in the Foreign Policy of Fiji
THE ROLE OF OVERSEAS MISSIONS IN THE FOREIGN POLICY OF FIJI: AN ANALYSIS OF THE DIPLOMACY OF A SMALL ISLAND DEVELOPING STATE. By MILIKA WAQAINABETE A thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Masters of Arts in Politics and International Affairs. Copyright © 2012 by Milika Waqainabete School of Government, Development and International Affairs, Faculty of Business and Economics University of the South Pacific Dedication I dedicate this thesis to our Lord Jesus Christ whose guidance and wisdom enabled me to persevere, husband Mosese and children Jone, Vika and Alena for their unwavering support and encouragement for its completion. Acknowledgement I wish to acknowledge with sincere gratitude the guidance and direction given to me by my supervisor, Dr Sandra Tarte, the staff of the National Archives and Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation for their assistance, the I-Taukei Affairs Scholarships Unit for funding this research, as well as the interviewees listed below who gave valuable information for the compilation and completion of this thesis. Mr Solo Mara Mrs Mere Mr Winston Falemaka Thompson Mr Isikeli Mataitoga Mrs Mere Tora Mr Berenado Vunibobo Mr Kaliopate Ms Taufa Vakatale Tavola Mr Filipe Bole Ms Tupou Raturaga Mr Emitai Mr Lote Buinimasi Boladuadua Ms Yolinda Chan Mr Jesoni Mr Robin Yarrow Dr Roman Vitusagavulu Grynberg Mr Sekove Mrs Litia Mawi Naqiolevu Mr Peter Donigi Mr Naipote Mr Amena Yauvoli Mr Jeremaia Katonitabua Waqanisau Mr Jone Mr Anare Jale Draunimasi Mr Akuila Waradi Ms Tupou Vere Mr Jone Mr Ross Ligairi Vukikomoala Mr Isikia Savua Mr Pio Tabaiwalu Mr Jioji Mr Tuiloma Neroni Kotobalavu Slade Mr Filimoni Jitoko 1 Abstract Small Island Developing States (SIDS) in international relations are generally viewed to be weak, vulnerable and marginalised in world affairs. -

The Experiences of Indo-Fijian Immigrant Women in California
LOOKING BACKWARD, MOVING FORWARD: THE EXPERIENCES OF INDO-FIJIAN IMMIGRANT WOMEN IN CALIFORNIA A Thesis Presented to The Faculty of the Department of Anthropology San José State University In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Master of Arts by Ambrita Nand December 2015 © 2015 Ambrita Nand ALL RIGHTS RESERVED The designated Thesis Committee Approves the Thesis Titled LOOKING BACKWARD, MOVING FORWARD: THE EXPERIENCES OF INDO-FIJIAN IMMIGRANT WOMEN IN CALIFORNIA by Ambrita Nand APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY December 2015 Dr. Chuck Darrah Department of Anthropology Dr. James Freeman Department of Anthropology Dr. Roberto Gonzalez Department of Anthropology ABSTRACT LOOKING BACKWARD, MOVING FORWARD: THE EXPERIENCES OF INDO- FIJIAN IMMIGRANT WOMEN IN CALIFORNIA This study helps address gaps in knowledge concerning the lives of Indo-Fijian immigrant women in California and offers a space for their voices to be heard. The subsequent chapters investigate the lives of five Indo-Fijian immigrant women and their experiences upon migrating to Modesto, California. Using a qualitative research approach, data were collected through participant-observations, semi-structured in-depth interviews and informal conversations. The data are presented as anthropological silhouettes, a form of life-writing (the recording of events and experiences of a life), which explores each individual woman’s experience with life in Fiji to her eventual migration and transition to life in California. The study reveals heterogeneity amongst the women’s experiences and perspectives as well as commonalities that arise in their collective experiences as Indo-Fijian immigrant women residing in the city of Modesto. Overall, the anthropological silhouettes reveal that migration has led to shifts in the women’s identities and their prescribed gender roles. -
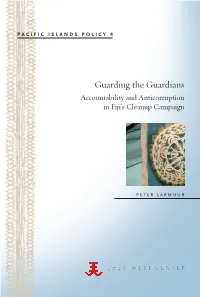
Accountability and Anticorruption in Fiji's Cleanup Campaign
PACIFIC ISLANDS POLICY 4 Guarding the Guardians Accountability and Anticorruption in Fiji’s Cleanup Campaign PETER LARMOUR THE EAST-WEST CENTER is an education and research organization established by the U.S. Congress in 1960 to strengthen relations and understanding among the peoples and nations of Asia, the Pacific, and the United States. The Center contributes to a peaceful, prosperous, and just Asia Pacific community by serving as a vigorous hub for cooperative research, education, and dialogue on critical issues of common concern to the Asia Pacific region and the United States. Funding for the Center comes from the U.S. government, with additional support provided by private agencies, individuals, foundations, corporations, and the governments of the region. THE PACIFIC ISLANDS DEVELOPMENT PROGRAM (PIDP) was established in 1980 as the research and training arm for the Pacific Islands Conference of Leaders—a forum through which heads of government discuss critical policy issues with a wide range of interested countries, donors, nongovernmental organizations, and private sector representatives. PIDP activities are designed to assist Pacific Island leaders in advancing their collective efforts to achieve and sustain equitable social and economic development. As a regional organization working across the Pacific, the PIDP supports five major activity areas: (1) Secretariat of the Pacific Islands Conference of Leaders, (2) Policy Research, (3) Education and Training, (4) Secretariat of the United States/Pacific Island Nations Joint Commercial Commis- sion, and (5) Pacific Islands Report (pireport.org). In support of the East-West Center’s mission to help build a peaceful and prosperous Asia Pacific community, the PIDP serves as a catalyst for development and a link between the Pacific, the United States, and other countries. -

Thursday 4Th December 2014
THURSDAY, 4TH DECEMBER, 2014 The Parliament resumed at 9.40 a.m. pursuant to adjournment. MADAM SPEAKER took the Chair and read the Prayer. PRESENT All honourable Members were present, except the honourable Prime Minister and Minister for iTaukei Affairs and Sugar and the honourable Leader of the Opposition. MINUTES HON. LEADER OF THE GOVERNMENT IN PARLIAMENT.- Madam Speaker, I beg to move: That the Minutes of the sitting of Parliament held on Wednesday, 3rd December, 2014, as previously circulated, be taken as read and be confirmed. HON. CDR. S.T. KOROILAVESAU.- Madam Speaker, I beg to second the motion. Question put. Motion agreed to. COMMUNICATION FROM THE CHAIR Accuracy of Speeches MADAM SPEAKER.- Honourable Members, yesterday a point of order was raised about the accuracy of another Member’s speech. At the time, I ruled that Members should be mindful that their comments made in Parliament, as it should be factual and not misleading. I take this opportunity to remind honourable Members that it is not the Speaker’s role to monitor the accuracy or otherwise of honourable Members’ speeches in Parliament. If an honourable Member disagrees with what another honourable Member has said, they can put their side of the argument on record when it is their turn to speak. Finally, may I remind honourable Members that it may be considered a contempt of this Parliament to deliberately mislead Parliament. Honourable Members should take care to ensure that they do not deliberately mislead the Chamber and make accusations at another honourable Member. Speaker - Leave of Absence I also advise honourable Members that I will not be attending tomorrow’s sitting, as I will be attending a conference in Nadi. -

Melanesia in Review: Issues and Events, I998
Melanesia in Review: Issues and Events, I998 Reviews of Irian Jaya and Vanuatu dollar was to be expected. Investment are not included in this issue. was sluggish, consumer spending was low, and there was moderate infla tion. The Fiji dollar had also strength FIJI ened against those of its major trad Sociopolitical and economic conse ing partners, Australia and New quences of the 1987 coups in Fiji Zealand (Review, Feb 1998, 2). A were still unfolding by January 1998. local economist argued, with refer The year began with a 20 percent ence to a popular international rugby devaluation of the Fiji dollar by event, that devaluation is a short-term Finance Minister James Ah Koy. solution to an economic crisis and Apart from the external negative that "even the 20 per cent devalua impact of the economic turmoil in tion is too low. Someone has to pay Southeast Asia, there have been major for things like the Hong Kong 7S holi internal contributions to the down day" (Review, Feb 1998), let alone turn of Fiji's economy since the coups. the National Bank's F$220 million in Politico-economic instability after bad debts and the regular overseas the coups has been compounded by trips of members of Parliament. deliberate economic disasters such as The governor of the Reserve Bank the F$220 million loss by the of Fiji stated that the devaluation National Bank of Fiji due to bad would, among other things, increase debts. Furthermore, there is still the competitiveness of Fiji's exports, uncertainty surrounding the renewal make locally produced goods cheaper, of leases under the Agriculture encourage overseas investment in Fiji, Landlords and Tenants Act and the increase demand for locally produced relocation of tenants whose leases goods, and prop up employment and have not and will not be renewed. -

The People Have Spoken the 2014 Elections in Fiji
THE PEOPLE HAVE SPOKEN THE 2014 ELECTIONS IN FIJI THE PEOPLE HAVE SPOKEN THE 2014 ELECTIONS IN FIJI EDITED BY STEVEN RATUVA AND STEPHANIE LAWSON PACIFIC SERIES Published by ANU Press The Australian National University Acton ACT 2601, Australia Email: [email protected] This title is also available online at press.anu.edu.au National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry Title: The people have spoken : the 2014 elections in Fiji / editors: Steven Ratuva, Stephanie Lawson. ISBN: 9781760460013 (paperback) 9781760460020 (ebook) Subjects: Elections--Fiji Election law--Fiji. Fiji--Ethnic relations--Political aspects. Fiji--Politics and government. Other Creators/Contributors: Ratuva, Steven, editor. Lawson, Stephanie, editor. Dewey Number: 324.99611 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the publisher. Cover design and layout by ANU Press. Cover photograph: ‘The Government Buildings in Suva Fiji’ by Stemoc. This edition © 2016 ANU Press Contents 1. ‘The People Have Spoken …’ ...........................1 Steven Ratuva and Stephanie Lawson 2. Shifting democracy: Electoral changes in Fiji. .17 Steven Ratuva 3. Chiefly leadership in Fiji after the 2014 elections .............41 Stephanie Lawson 4. Fiji Indians and the Fiji general elections of 2014: Between a rock and a hard place and a few other spots in between ....................................59 Brij V Lal 5. ‘Unfree and unfair’?: Media intimidation in Fiji’s 2014 elections ...83 David Robie 6. From the land to the sea: Christianity, community and state in Fiji—and the 2014 elections .................109 Lynda Newland 7. -

Melanesia in Review: Issues and Events, 2007
Melanesia in Review: Issues and Events, 2007 Reviews of Papua New Guinea and head of state. A month earlier, Ratu West Papua are not included in this Josefa had been removed from that issue. offi ce because he had disassociated himself from the coup, on the advice Fiji of Roko Tui Bau and Vice President Fiji in 2007 was marked by cycles Ratu Joni Madraiwiwi. Bainimarama of conciliation and repression that had, at that time, said he was only echoed like seismic aftershocks from temporarily “stepping into the shoes the December 2006 coup. Steps were of the President” (Bainimarama 2006). taken by the new military-backed Now restored to offi ce, the eighty- government to reconfi gure the estab- six-year-old president lamented that lished order, by purges at the top of cultural reasons had prevented him the public service and throughout the from “fully performing [his] duties” boards of the state-owned corpora- on 5 December 2006, referring to the tions; by reconstruction of the Great anti-coup pressure from his sacked Council of Chiefs; and by reform of high-ranking deputy. But he said that the Fijian Affairs Board, the Native he “would have done exactly what the Land Trust Board, and the Fiji Devel- Commander of the rfmf, Commo- opment Bank. Although there was dore Josaia Voreqe Bainimarama did diplomatic disapproval for the over- since it was necessary to do so at the throw of Fiji’s elected government, the time” (Iloilo 2007). Read from a script new regime’s reformist credentials, as prepared by military offi cers who had, well as its anticorruption and antira- over the previous month, kept him cist platform, won it a fair number of virtually secluded from public contact, overseas admirers and some domes- the speech was carefully contrived to tic supporters.