Pierre Ceresole, "Das Höchste Gewissen Der Schweiz"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Honor Roll for 1940
IJ a^u ary^, 1941 THE ' h e a.cop^ D l W I T ESS ROELIF H. BROOKS “ Rise Up and Build a New Order” HONOR ROLL FOR 1940 Copyright 2020. Archives of the Episcopal Church / DFMS. Permission required for reuse and publication. SCHOOLS CLERGY NOTES SCHOOLS ACOSTA,, WILLIAM C., now rector of St. Mary’s, South Cleveland, was ordained priest by Bishop Beverley Tucker on De Wqt (Herteral ©ideological cember 18th at Trinity Cathedral, Cleveland. AUTEN, RALPH W., has resigned as rector KEMPER HÄLL J^emmarg of Trinity, Alliance, Ohio, to accept the rectorship of St. John’s, Donora, Penna. KENOSHA, WISC. Three-year undergraduate CARY, HUNSDON, JR., now rector of St. Leading Church school for girls in the Middle course of prescribed and elective Matthews, Toledo, was ordained priest by study. Bishop Beverley Tucker on December 18th West. Preparatory to all colleges. Also gen at Trinity Cathedral, Cleveland. eral courses. Unusual opportunities in Art Fourth-year course for gradu CHALMERS, ALAN R., formerly associate and Music. Complete sports program. Accred ates, offering larger opportunity rector of St. James-the-Less, Scarsdale, New York, is now on the staff of St. George’s, ited. Well organized junior school. for specialization. New York. Under direction of the Sisters of St. Mary. Provision for more advanced CONDIT, R. Y „ has resigned as rector of St. Catalog on request. Address Box WT. John’s, Brooklyn, to become the rector of work, leading to degrees of S.T.M. St. Gabriel’s, Hollis, Long Island. and D.Th. CRANDALL, ROBERT L.. is now the canon of the Cathedral of St. -

Short Review of SCI's Historical Development 1920 - 1990
Bibliothéque de la Ville Coordinator: Philipp Rodriguez Rue du Progrès 33 Th.Kocher-Strasse 3 CH-2305 La Chaux-de-Fonds CH-2502 Biel/Bienne www.sciint.org/archives [email protected] Short review of SCI's historical development 1920 - 1990 1920 Pierre Ceresole and Hubert Parris organize and carry out with a small international team a reconstruction service in the war devastated village Esnes near Verdun in France. 1924 First international voluntary work camp in Switzerland to clear rubble after avalanche. 1928 710 volunteers from 28 countries clear the Rhine valley in Liechtenstein after heavy floods. 1930 Second international voluntary work camp in France (Lagarde) to clear up after flood devastation. 1931 During the economic crisis in England a work camp is organized to restore self- confidence in a distressed mining town. Volunteers with unemployed men build a swimming pool and layout a public park. 1934 First service in India: re-building of an earthquake stricken village in the area of Bihar. 1936 First voluntary work camp in Sweden. 1937 Assistance to civilians during the Civil War in Spain: evacuation of refugees and other transport services; setting up a maternity and feeding programmes for children and old people in Madrid; installation of homes for evacuated boys and girls. First work camp in Norway. 1939 IVS-SCI service is recognized in Great Britain as alternative to military service. 1940 Long-term re-forestation service in Britain for Conscientious objectors. First work camp in the Netherlands at school of Kees Boeke. 1944 Relief work in Palestine, Egypt and Greece. 1945 Relief and reconstruction work by international voluntary work camps in France, Germany, Italy and the Netherlands. -
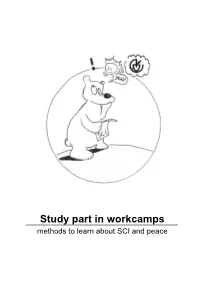
Study Part in Workcamps Methods to Learn About SCI and Peace Impressum
Study part in workcamps methods to learn about SCI and peace Impressum Impressum Publisher: One World Association – SCI Poland XO.UDVLĔVNLHJR$ 60-3R]QDĔ32/$1' [email protected] Author: Christa Knobloch Co-authors: (OĪELHWDĩyUDZVND Iza Czerniejewska Drawings: Mauro Carta ']LĊNXMHP\EDUG]R thank you very much to all people supporting us with their feedback, correction and computer knowledge! 2 One World Association – SCI Poland index Index Introduction What is ‘study part’? .....................................................................................p. 4 SCI Info: history of SCI ....................................................................................... p. 8 Info: Vision of SCI ........................................................................................p. 14 Info: ‘Amitié’ ................................................................................................. p. 15 Three slogans ..............................................................................................p. 16 SCI timeline ................................................................................................. p. 18 SCI-quiz ...................................................................................................... p. 20 SCI-theater .................................................................................................. p. 26 TV-show ...................................................................................................... p. 27 SCI-museum .............................................................................................. -

Pierre Ceresole a Lifetime Serving Peace
Pierre Ceresole A lifetime serving Peace Bibliothèque de la Ville La Chaux-de-Fonds Service Civil International Pierre Ceresole (1879-1945) La Chaux-de-Fonds Bibliothèque de la ville, 25.9.2010-15.1.2011 The La Chaux-de-Fonds Municipal Library has joined forc- es with Service Civil International to put together an ex- hibition devoted to Pierre Ceresole, a pacifist personality who is nowadays little-known to the public at large. From the First World War on he worked unstintingly to try to set up a civilian service for conscientious objectors, going as far as to launch a Federal campaign (in Switzerland) in 1922/1923. We have to wait more than seventy years before a public service is set up which replaces military duties for people who officially declare themselves to be conscientious objectors. As a matter of fact, up until 1996 the latter are tried by Military Tribunal and sentenced to prison. We can now appreciate how far we have come since then. As part of SCI’s 90th anniversary, in ten display panels, the exhibition takes us through the main phases in the life of the militant pacifist. It also refers to a number of histori- cal landmarks in the development of conscientious objec- tion and non-violence. The personal accounts of volun- teers who have taken part in international voluntary work camps highlight Ceresole’s heritage. This brochure contains the content of the exhibition with additional information about Service Civil international and the La Chaux-de-Fonds Public Library. It includes as well a short biography of Pierre Ceresole, which shows his evolution to a radical pacifist. -
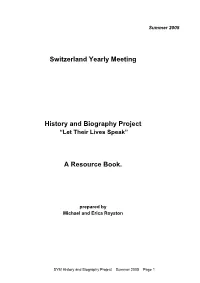
Switzerland Yearly Meeting History and Biography Project a Resource
Summer 2005 Switzerland Yearly Meeting History and Biography Project “Let Their Lives Speak” A Resource Book. prepared by Michael and Erica Royston SYM History and Biography Project Summer 2005 Page 1 SYM History and Biography Project Summer 2005 Page 2 Table of contents Abbreviations 8 Introduction 9 Why the Project? ________________________________________________________ 9 What does it mean “Letting Their Lives Speak”? _____________________________ 9 Who is in the list?________________________________________________________ 9 This is a resource book. __________________________________________________ 10 Thanks. ______________________________________________________________ 10 Section 1. Concerning People. 11 Allen, William__________________________________________________________ 11 Ansermoz, Félix and Violette._____________________________________________ 11 Ashford, Oliver and Lilias________________________________________________ 11 Ayusawa, Iwao and Tomiko.______________________________________________ 12 Balch, Emily Greene.____________________________________________________ 12 Béguin, Max-Henri. _____________________________________________________ 12 Bell, Colin and Elaine. ___________________________________________________ 12 Berg, Lisa and Wolf. ____________________________________________________ 12 Bieri, Sigrid____________________________________________________________ 13 Bietenholz, Alfred. ______________________________________________________ 13 Bohny, August and Friedel . ______________________________________________ -

1920 - 1970 the First Fifty Years of Service Civil International
Bibliothéque de la Ville Contact Philipp Rodriguez Rue du Progrès 33 : Th.Kocher-Strasse 3 CH-2305 La Chaux-de-Fonds CH-2502 Biel/Bienne [email protected] 19. March 2001 1920 - 1970 The first fifty years of Service Civil International by Etienne Reclus, Paris Origins Since the beginning of this century men and women had been wondering about that rise in violence and asking themselves which action to take upon in order to avoid that such a wave would develop which would bring about total war. This is how some men and women especially in Great Britain, tried to create a chain of resistance and came in contact with pacifists from Germany, the USA etc... A rather important group was set up in Cambridge, Great Britain: some of its members, particularly in Britain, objected to their call-up-order. In 1919 the various groups met up again at Bilthoven in Holland, an estate which belonged to one of their friends, and that is where the International Movement for Reconciliation (IMR) was officially set up. Pierre Ceresole had been invited and there were his first contacts with the Quakers who had carried out many relief actions for the victims during and after the war. For him that meeting meant a decisive step in his life. As a Swiss citizen he had constantly been arguing against that war and feeling Indignant about the passivity of the Christian churches; he became a total pacifist which led him to spend many months in prison in Switzerland in order to demonstrate publicly the horror of that war. -

SCI's HISTORICAL BACKGROUND and DEVELOPMENT
Bibliothéque de la Ville Coordinator: Philipp Rodriguez Rue du Progrès 33 Th.Kocher-Strasse 3 CH-2305 La Chaux-de-Fonds CH-2502 Biel/Bienne www.service-civil-international.org [email protected] SCI's HISTORICAL BACKGROUND AND DEVELOPMENT (Working paper from the report of the seminar: DEVELOPING DEVELOPMENT EDUCATION: SOLIDARITY WORK AND VOLUNTEER EXCHANGE". held in Bemburg - Northern Ireland - from 5 till 9 April 1987) (NB: A number of Ralph's significative comments have been added to the working paper.) Introduction This is a modest attempt to review SCI's history, its principles and its, in so many ways fascinating adaptation of practical activities to "needs of the time". It may be helpful to first throw a glimpse at the situation as it prevailed in Europe in the twenties: in the year after World-War-1st. All countries were in economic crisis, had shattered currencies and went through considerable political and cultural unrest. There was a widespread craze for speculations of all kind, leading in October 1929 to a crash at the New York stock exchange, followed by a general economic collapse with an unemployment rate of hitherto unknown dimensions: at that time without any State unemployment compensation. This meant horrible hardship for millions of workers, employees, workshop owners and shopkeepers. It also meant frantic attempts towards national self-sufficiency, full of hatred for anything so- called foreign, although exactly such chauvinistic attitudes had 15 years earlier let to the First World War and its consequences and with all its misery! As usual in such situations, a majority of people in nearly all-European countries was frustrated. -

Download Complete Issue
THE JOURNAL of the UNITED REFORMED CHURCH HISTORY SOCIETY (incorporating the Congregational Historical Society, founded in 1899, and the Presbyterian Historical Society of England, founded in 1913). EDITOR: Dr. CLYDE BINFIELD, M.A. Volume 3 No.9 October 1986 CONTENTS Editorial 367 A Protestant Aesthetic? A Conversation with Donald Davie by Daniel T Jenkins, MA., B.D., D.D. 368 Nonconformist Poetics: A Response to Daniel Jenkins by Donald Davie, MA., Ph.D. 376 Abney and the Queen of Crime: A Note by Clyde Binjield, MA .. Ph.D. 386 William Baines in Leicester Gaol: A Note by David G. Cornick, B.D .. Ph.D .. A.K.C. 388 The Fellowship of Reconciliation: A Personal Retrospect by John Ferguson, MA .. B.D .. F.I.A.L.. F.R.S.A. 392 Reviews and Notes 400 EDITORIAL Of our contributors Dr. Jenkins is minister-in-charge at Paddington Chapel, Dr. Cornick is chaplain at Robinson College, Cambridge. Professor Ferguson was until recently President of the Selly Oak Colleges and Professor Davie is at Vanderbilt University, Tennessee. Dr. Jenkins, Dr. Cornick and Professor Ferguson are contributing articles for the first time. The conversation between Dr. Jenkins and Professor Davie, which moves from Protestant aesthetics to Nonconformist poetics, introduces a tone new to the Journal, to which pure historians might object. It is to be hoped that the conversation will continue, perhaps on architecture, or music, or indeed that vanishing art-form, the sermon. Professor Ferguson also introduces a new note: that of reminiscence. His stance is in a firm tradition, not too far removed from that of William Baines. -

Quaker Lives Series 1 & 2
Quaker Lives These short biographies of Quakers were compiled by David Purnell (Canberra Regional Meeting) and either recorded for broadcast on Dove Talk and/or published in the Canberra Quakers Newsletter James Backhouse ................................................................................................................................................................................... 1 Elise Boulding ......................................................................................................................................................................................... 3 George Cadbury ..................................................................................................................................................................................... 4 Pierre Ceresole ....................................................................................................................................................................................... 5 Adam Curle .............................................................................................................................................................................................. 6 Margaret Fell ........................................................................................................................................................................................... 8 Elfrida Vipont Foulds ......................................................................................................................................................................... -

030619 Workcamp Study Part.Sxw
Service Civil International Branche Suisse ◦ Monbijoustrasse 32 ◦ CP 7855 ◦ 3001 Berne Tél: 031 381 46 20 ◦ Fax: 031 381 46 25 ◦ e-mail: [email protected] ◦ www.scich.org Study pack on SCI for workcamps by Philipp Rodriguez SCI International Archives, [email protected], http://www.sciint.org/sciia Version 2, June 2003 Introduction This study pack shall help camp co-ordinators to organise a study part on SCI for worcamp participants. The study pack is designed, so that it can be used for different purposes adapted to the volunteers : presentations, discussion, working in groups and self study. Aim of the study pack The idea is, that the campleader organise e.g. a evening on SCI during the workcamp in order to speak up to 2 hours. The study pack shall be help to organise it. The volunteers shall understand, that SCI has long tradition of organising workcamps and other activities. The sense and use of workcamps and international volunteering shall be analysed and a discussion on the idea of SCI shall be started. The approach of this study pack bases mainly on the history of SCI and refers therefore often to workcamps or activities in the past. On one hand the basic ideas of SCI will be explained. On the other hand workcamp participants are asked to compare the situation of the past with the workcamp and its activities today. At the same time the pack shows the wide field of SCI activities. This study pack doesn’t go deeply to specific special subjects of SCI activities like long term volunteering, North-South exchange etc. -

SCI Service in Safien 1932SCI Service in Safien 1932
Service Civil International SCISCI serviceservice inin SafienSafien 19321932 Philipp Rodriguez SCI Switzerland Autumn Festival October 26th 2008 Service Civil International Safien Village in Safien Valley District Surselva, Grison 1350 m altitude Around 450 inhabitants Service Civil International Tuesday, July 12th 1932 Heavy rain during the night From Piz Radun rock, gravel and sand brought down the torrent Avalanche entered lower parts of the village One house destroyed, no people hurt Lot of agricultural land is covered by stones, gravels and sand Service Civil International Thursday July 14th 1932 The village Safien calls SCI for urgent help Service Civil International Saturday, July 16th 1932 Call for volunteers Begin of service July 18th Minimum 2 week work Reclaiming devastated agricultural land Working material provided by government Donation for Food and money requested Service Civil International th Monday, July 18 1932 Start of work Usually 9 hours work per day Service Civil International Removing stones & gravel Service Civil International Service Civil International Tuesday, July 19th 1932 Problems came up with provided working material Swiss minister of Defence asks for a guarantees, that any kind of anti militaristic propaganda should be avoided. Bern, den 19.Juli 1932 Herrn Pierre Ceresole ... Sobald diese Bedingung erfüllt ist, sind wir vollständig geneigt, Ihr Untnernehmen in Safien zu unterstützen ... Eidg.Militärdepartement gez. R.Minger Service Civil International Pierre Ceresole at work Service Civil International -

Living in the Light: Some Quaker Pioneers of the 20Th Century
LIVING IN THE LIGHT SOME QUAKER PIONEERS OF THE 20th CENTURY Volume II - In the Wider World LEONARD S. KENWORTHY, Editor F'ruENns GENERAL CoNFERENCE and QUAKER PuJ3LICATIONS Box 726 Kennett Square, Pa. 19348 Copyright © 1985 Leonard S. Kenworthy Library of Congress Number: 85-081053 Table of Contents PAGES Introduction to Volumes I and II 1 1. Pierre Ceresole: Pick and Shovel Peacemaker, by Leonard S. Kenworthy 6 2. Arthur S. Eddington: "Our Most Distinguished Astrophysicist," by S. Jocelyn Burnell 22 3. Emilia Fogelklou: Swedish Mystic and Friend, by Howard T. Lutz . 36 4. Sok-Hon Ham: "A Wandering Albatross," by Yoon-Gu Lee . 52 5. Fred Haslam: "Mr. Canadian Friend," by Dorothy Muma 70 6. Henry T. Hodgkin: Statesman of the World Church, by John Ormerod Greenhood 85 7. John Somervell Hoyland: Joyful Giant, by L. Hugh Doncaster 100 8. Margarethe Lachmund: Radiant Friend and Reconciler, by Leonard S. Kenworthy 113 9. Kathleen Lonsdale: Eminent Scientist and Concerned Quaker, by Leonard S. Kenworthy . 129 10. Sigrid Lund: Portrait of a Norwegian Friend, by Margaret S. Gibbins 145 11. Thomas G. Lung'aho: East Africa Quaker Educator and Administrator, by Harold V. Smuck 160 12. Inazo Nitobe: A Bridge Across the Pacific, by Tadashi Yuasa .. 174 13. Philip Noel-Baker: Prophet of Peace and Disarmament, by Kenneth Lee 190 14. Heberto Sein: International Interpreter, by Suzanne Fehr Sein . 206 15. Suzanne Stephen: South African Friend of Prisoners, by W. Scarnell Lean 222 16. Will Warren: An Instrument of Peace, by John Lampcn 236 17. Margaret Watts: An Australian Friend in Action, by Eileen Barnard-Kettle 2.5.'3 Biographical Sketches of the Authors 269 iii Introduction to Volumes I and II The Background for These Books In the more than 300 years of its history, the Religious Society of Friends has helped to develop or has attracted an unusually large number of prominent people, many of them pioneers in one or more significant movements or causes.