Linzer Kulturstadtteile Heute
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
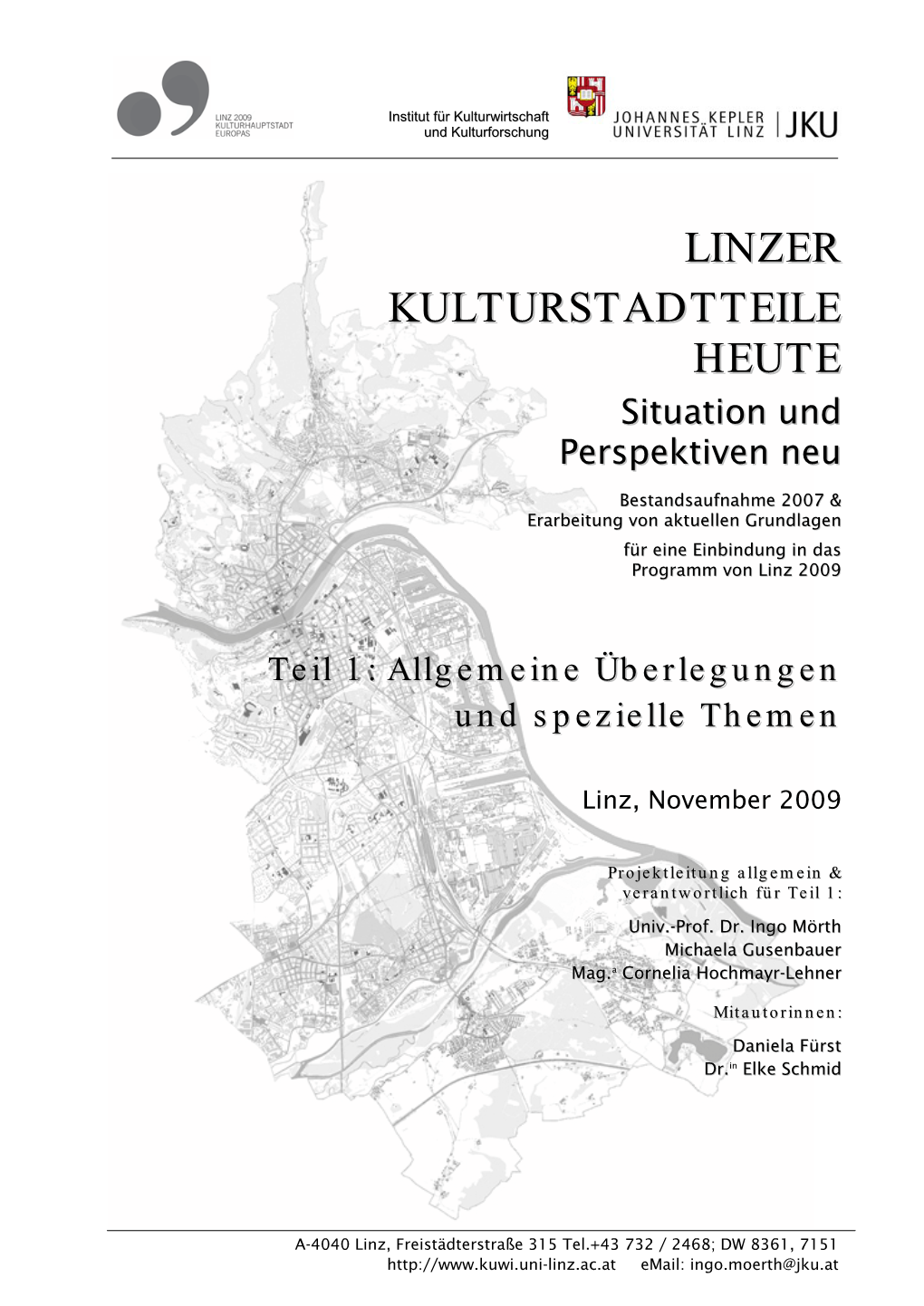
Load more
Recommended publications
-

WG Sebald and Outsider
Writing from the Periphery: W. G. Sebald and Outsider Art by Melissa Starr Etzler A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in German and the Designated Emphasis in Film Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Winfried Kudszus, Chair Professor Anton Kaes Professor Anne Nesbet Spring 2014 Abstract Writing from the Periphery: W. G. Sebald and Outsider Art by Melissa Starr Etzler Doctor of Philosophy in German and the Designated Emphasis in Film Studies University of California, Berkeley Professor Winfried Kudszus, Chair This study focuses on a major aspect of literature and culture in the later twentieth century: the intersection of psychiatry, madness and art. As the antipsychiatry movement became an international intervention, W. G. Sebald’s fascination with psychopathology rapidly developed. While Sebald collected many materials on Outsider Artists and has several annotated books on psychiatry in his personal library, I examine how Sebald’s thought and writings, both academic and literary, were particularly influenced by Ernst Herbeck’s poems. Herbeck, a diagnosed schizophrenic, spent decades under the care of Dr. Leo Navratil at the psychiatric institute in Maria Gugging. Sebald became familiar with Herbeck via the book, Schizophrenie und Sprache (1966), in which Navratil analyzed his patients’ creative writings in order to illustrate commonalities between pathological artistic productions and canonical German literature, thereby blurring the lines between genius and madness. In 1980, Sebald travelled to Vienna to meet Ernst Herbeck and this experience inspired him to compose two academic essays on Herbeck and the semi-fictionalized account of their encounter in his novel Vertigo (1990). -

The Inverted Dragon Sciences
Epidemiology and Psychiatric The inverted dragon Sciences Hannah Rieger cambridge.org/eps Vienna, Austria Drawing is Laila Bachtiar’s driving force and main purpose in life. It was in 1975, aged four, Contemporary Outsider Art that she began to draw regularly. At that stage she did not speak at all. Her mother, a cellist, liked to take her along to orchestral rehearsals in Vienna, where she would lie on the floor for This Section of Epidemiology and Psychiatric hours, drawing. In later life there were phases when in the social institutions where she lived, Sciences appears in each issue of the Journal she was forbidden to draw. Her reaction was immediate, startling and physical. and is dedicated to all forms of creative ’ production born of an intimate and individual Laila Bachtiar s creative work depicts two different worlds (Feilacher, Ansperger, 2018), a urge, often secretive, unbound from the colourful one and a grey one, because she uses either coloured or black pencils. The two worlds conventional art system rules. Through short are linked in origin, since they result from the same specific technique developed by the artist. descriptions of the Outsider art work of She uses strong pencil strokes to outline her chosen subject swiftly and assertively. Her main prominent artists and new protagonists often hosted in community mental health services, theme is the organic universe. this Section intends to investigate the latest Laila Bachtiar then adds a net-like structure, a kind of framework formed of lines and developments of the contemporary art scene, spaces. She uses dynamic strokes to form shapes and sections, building up the subject in where the distances between the edge and the this way. -

Inventaire Du Fonds ALFRED BADER
Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique Bibliothèque d’histoire de la médecine et d’éthique médicale Inventaire du Fonds ALFRED BADER CHUV | Bibliothèque d’histoire de la médecine et d’éthique médicale Inventaire du fonds Alfred Bader Réalisé sour la direction de Daniela Vaj DV IUHM, Lausanne, 2013 IUHM - Fonds Alfred Bader 1 Bibliothèque d’histoire de la médecine et d’éthique médicale Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique Avenue de Provence 82, CH-1007 Lausanne Tél. 021 314 70 52 / mailto : [email protected] Site : www.chuv.ch/iuhmsp/bibliothèque Equipe : Daniela Vaj, responsable de la bibliothèque Marie-Dominique Casse, bibliothécaire assistante Caroline Hofer, bibliothécaire assistante IUHM - Fonds Alfred Bader 2 Présentation Note biographique Alfred Bader (1919-2009) Alfred Bader est né le 7 juillet 1919 à Schaffhouse. Il y passe les dix premières années de sa vie, avant que sa famille ne s’installe à Bâle. Après l’obtention dans cette ville de son diplôme de médecine en 1944, il effectue sa première année d’assistanat auprès d’Hans Steck, psychiatre à la Clinique psychiatrique universitaire de Lausanne de Cery. Grâce aux travaux d’Aloïse Corbaz et à la lecture des livres de Prinzhorn, Walter Morgenthaler et Adolf Wölfli, il développe une passion pour l’art psychopathologique. A Lausanne il obtient son doctorat en médecine en 1950, avec une thèse sur la schizophrénie et les intoxications mercurielles. Il travaille d’abord comme médecin généraliste à Sainte-Croix, une activité qui l’occupe jusqu’en 1963. Cette année-là, le professeur Christian Müller, directeur de la Clinique psychiatrique universitaire de Lausanne, l’invite à créer le Centre d’expression plastique à Cery, dont il sera le directeur jusqu’en 1984. -

Ernst Herbeck.! I Prefer a Silent Language October 22 2015 – May 22 2016 Press Conference: October 20, 10 A.M
Exhibition opens on October 21, 7p.m. ernst herbeck.! I prefer a silent language October 22 2015 – May 22 2016 Press conference: October 20, 10 a.m. ©Heinz Bütler For the first time the museum gugging is devoting an exhibition to Ernst Herbeck (1920- 1991), a witty, eloquent and yet silent poet among the Gugging artists. At the heart of the show is the distinctive poetic voice of Ernst Herbeck. Moderated by selected text quotes and accompanied by images, film and sound documents, and memorabilia, different chapters of the story of his life and authorship will be opened. For the first time a large number of drawings, which have a close relationship with Herbeck’s poetic work, are to be displayed. The architecture and design of the exhibition reflect Herbeck’s thematic world and his poetic method. In close cooperation, curator Gisela Steinlechner and exhibition designer Peter Karlhuber have brought to life an atmospheric presentation devoted to the poet from Gugging. The exhibition combines documentation and installation, and leaves visitors plenty of room to make their own associations. The curtain rises on Ernst Herbeck! Curator: Gisela Steinlechner Exhibition Designer: Peter Karlhuber PICTURE DOWNLOAD: https://celum.noeku.at/pindownload/login.do?pin=52NTX museum gugging PRESS CONTACT Am Campus 2 , A-3400 Maria-Gugging Mag.a Edith Wildmann Tel.: +43 (0)2243 / 87087 Fax: +43 (0)2243 T: +43 (0) 664 60499374 87087-372 E-Mail: [email protected] [email protected] www.gugging.at The Curator Gisela Steinlechner about Ernst Herbeck: “I was born in Stockerau on 4 June 1920 and did not learn anything because I could not deal with it. -

Kunst Im Psychiatrischen Kontext: August Walla, Oswald Tschirtner, Johann Hauser Und Ernst Herbeck
Kunst im psychiatrischen Kontext: August Walla, Oswald Tschirtner, Johann Hauser und Ernst Herbeck Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magistra artium (Mag.a art.) in den Studienrichtungen Unterrichtsfach Kunst und kommunikative Praxis und Unterrichtsfach Textil - Freie angewandte und experimentelle künstlerische Gestaltung eingereicht an der Universität für angewandte Kunst Wien am Institut für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung bei Univ.-Prof. Mag.art. Dr.phil. Marion Elias vorgelegt von Caroline Baldt Wien, im November, 2019 2 Ich erkläre hiermit, dass ich die Diplomarbeit selbstständig verfasst, keine andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfen bedient habe, dass diese Diplomarbeit weder im In- noch Ausland (einer Beurteilerin / einem Beurteiler zur Beurteilung) in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt wurde, dass dieses Exemplar mit der beurteilten Arbeit übereinstimmt. Datum Unterschrift 3 4 Danksagung Für die Finalisierung der Diplomarbeit waren Christine, Franz und Bettina Baldt eine besonders große Hilfe. Durch mehrmaliges Korrekturlesen kennen sie meine Arbeit nun in- und auswendig. Diese liebevolle Unterstützung der letzten Wochen zeigt mehr den Regelfall als eine Ausnahme meiner großartigen Familie. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Univ.-Porf. Mag.art. Dr.phil. Marion Elias für die engagierte Betreuung auf dem Weg zu meinem Studienabschluss. Zu guter Letzt möchte ich Sarah Steiner nennen, meine größte mentale Stütze -

Lives and Works of Artists in German, Swiss and Austrian Psychiatries in the 19Th and 20Th Century
Between Ingenuity and Madness - Lives and Works of Artists in German, Swiss and Austrian Psychiatries in the 19th and 20th Century A Master thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of a Master of Art In the Graduate Academic Unit of the History Department of the Paris-Lodron University of Salzburg By Daniela Vordermaier, BA BA Supervisor: Ass. Prof. Dr. Alfred Stefan Weiß Salzburg, September 2019 Contents 1. Introduction .......................................................................................................................... 4 1.1 Topical Introduction ......................................................................................................... 4 1.2 State of Research: Art and Artists in Psychiatries - An Approach ................................... 6 1.3 Questions and Structure ................................................................................................. 18 1.4 Methodical Frame .......................................................................................................... 21 1.4.1 Historical Criticism by Johann Gustav Droysen and the Method of the Historical Comparison ...................................................................................................................... 22 1.4.2 Erwin Panofsky’s Iconographical-Iconological Method ......................................... 25 1.4.3 Wolfgang Kemp’s Aesthetic of Reception .............................................................. 28 2. The Pathologisation of the Artist - The Connex -
Art Brut“ and “Outsider Art“ – Consisting “Heterotopia“ of the Art World?
Paper prepared for The 7th Euroacademia International Conference Identities and Identifications: Politicized Uses of Collective Identities Lucca, Italy 14 – 15 June 2018 This paper is a draft Please do not cite or circulate 1 “Art Brut“ and “Outsider Art“ – Consisting “heterotopia“ of the art world? Author: Maria Höger, research assistant Association – Friends of the Gugging House of Artists / Private Foundation - Gugging Artists / doctoral candidate Academy of Fine Arts , Vienna. Author´s bio: Maria Höger, born in Rosenheim (Germany) in 1987; lives in Vienna. Studied art education and art history in Munich at the Ludwig-Maximilians-Universität München. Has worked for the Association – Friends of the Gugging House of Artists since 2013. Has additionally worked as a research associate at the Center for Museum Collections Management of the Danube University Krems since 2015 and also in art education at the museum gugging . Her main interests are art from Gugging, contemporary art, and so called “Art Brut” of the past and present. Since 2018 research assistant for the Association – Friends of the Gugging House of Artists and the Private Foundation - Gugging Artists and doctoral candidate at the Academy of Fine Arts , Vienna, working on her PHD- project “`Raw or cooked?` The history of reception of artworks from Gugging (working title)“. 1. Abstract 2. Art Center Gugging 2.1. Gugging status quo 2.2. A brief history of art from Gugging and its reception 3. Questions of perspective? “Art Brut” – “Outsider Art” – contemporary art 4. Gugging as “heterotopia”? 5. Looking for prospects 1. Abstract Key words: contemporary art – “Art Brut” – “Outsider Art” – art and psychiatry – reception history Artists who are creating in places which you can, following one of Michel Foucault´s theses from 1967, define as “heterotopia“, are still unequally dependent regarding the reception and distribution of their artworks. -

Accidental Genius: Art from the Anthony Petullo Collection Biographies of the Artists
Accidental Genius: Art from the Anthony Petullo Collection Biographies of the Artists Consuelo Amézcua American, b. Mexico, 1903–1975 Born in Piedras Negras, Mexico, Consuelo ―Chelo‖ González Amézcua moved to Del Rio, Texas, with her parents and five siblings in 1913. Her parents were storytellers, musicians, and teachers. Amézcua intended to study art at the Academy of San Carlos in Mexico City, but she forfeited her scholarship due to the death of her father. Amézcua started drawing in 1964 and first exhibited in 1968. Her intricate early drawings are in black ballpoint pen on card. She subsequently incorporated colored inks, crayon, and felt-tip pen. Many of her drawings feature her poems, for which she received several awards in Mexico. She also took up carving into stone shells in 1956. Amézcua mapped out her drawings in her head, then filled the surrounding page with lines reminiscent of the filigree jewelry that she often wore. These lines recall the decorative arts of pre-Columbian cultures and Mexican textiles. Her subjects include colonial architecture, exotic locales, biblical iconography, Mexican folklore, Native American heroes, and decorative elements such as flowers, fans, and peacocks. Amézcua continued to live in Del Rio with her sister until her death. Eddie Arning American, 1898–1993 Eddie Arning was born in Germania, Texas. His parents, both German immigrants of Lutheran faith, had five children. In 1905 the couple purchased a farm. Arning lived and worked on the farm until 1928, when the Austin County Court sent him to the state hospital because of violent behavior. In 1934 he was committed to the Texas Confederate Home for Men, where staff member Helen Mayfield provided art materials to the patients. -

Ernst Herbeck
Universität Paderborn Fakultät für Kulturwissenschaft Dissertation im Promotionsfach Musikwissenschaft zum Thema Die Oper ‚Das stille Zimmer’ von Michael Hirsch Dipl.-Ing. Jürgen Rinneberg Freibadstraße 39a 32758 Detmold 1 Vorbemerkung Im Mai des Jahres 2000 hatte ich Gelegenheit, die Uraufführung der Oper „Das stille Zimmer“ im Theater Bielefeld unter der Regie des Komponisten, Michael Hirsch, zu erle- ben. Das Werk hat mich so beeindruckt, dass ich mir vornahm, den Grund für die Faszina- tion von Text und Musik zu erschließen. Herr Prof. Gerhard Allroggen hat mein Vorhaben positiv aufgenommen und mich ermuntert, dem Projekt den Rahmen einer Dissertation zu geben. Dafür und für seine geduldige und ermunternde Begleitung dieser Arbeit über den unge- wöhnlichen Stoff bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Gerhard Allroggen sehr herzlich. Frau Dr. Irmlind Capelle danke ich für ihr Interesse an und ihre kritischen, aber außero- ordentlich hilfreichen Hinweise zu dieser Arbeit. Herrn Michael Hirsch, dem Autor der Oper „Das stille Zimmer“, und dem Theater Biele- feld, dort insbesondere Frau Sandra Meurer und Herrn Roland Quitt, habe ich wertvolle Arbeitsmaterialien und fachliche Anregungen zu verdanken. Für Effi. Detmold, im Juni 2004 Jürgen Rinneberg 2 Inhaltsverzeichnis Seite Deckblatt 1 Vorbemerkung 2 Inhaltsverzeichnis 3 Einführung 5 Introduction 6 Das Musiktheater in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 7 Boris Blacher 7 Mauricio Kagel 8 György Ligeti 10 Karlheinz Stockhausen 12 Michael Hirschs Oper 15 Ernst Herbeck 15 Zur Person 15 Zum Werk 16 Michael Hirsch 21 Zur Person 22 Zum Werk 23 Zur Oper „Das stille Zimmer“ 25 Das Libretto 27 Prolog: Das stille Zimmer – der Traum 27 1. -

Lives and Works of Artists in German, Swiss and Austrian Psychiatric Clinics in the 20Th Century
Art as a Type of Therapy – Lives and Works of Artists in German, Swiss and Austrian Psychiatric Clinics in the 20th Century Daniela Vordermaier* Abstract After avant-garde artists had widened the use of traditional materials, styles and groups of creators to support the upgrading of psychotic artworks, psychi- atric clinics became places of art production in the 20th century. As creative de- signing was institutionally embedded within these facilities from the 1950s on- wards, questions about its functions within these contexts arose. This paper ex- amines the lives and works of three non-professional artists living in German, Swiss and Austrian clinics by analysing six of their paintings and drawings. It asks about the reasons that led to the emergence of creative drives within them, about the needs they hereby satisfied and about the functions art had in their lives. In order to integrate their works within interdisciplinary research, the ar- ticle draws on Erving Goffman’s theory of total institutions to examine whether the case studies used art to express autonomy and self-determination within their socially, locally and economically restricted environment. 1. Introduction 1.1 Topical Introduction In her book Once a girl, now a woman1 Australian artist Nikki Rowe described the power of art as a healing mechanism after a car accident had left her with complex regional pain syndrome causing severe movement disorders.2 With her statement that art is a “cure to all this madness, sadness and loss of belonging”,3 she outlined the concept of art as a type of therapy which aims at the liberation of a person’s feelings, traumata and concerns through the media of art * Daniela Vordermaier, BA BA MA MA, completed her master studies in History and Art History at the Paris Lodron Universität Salzburg. -

JÄNNER 2017 Rückblick Auf Das Auktionsjahr 2016
JÄNNER 2017 Rückblick auf das Auktionsjahr 2016 Rekordauktionen und die Kunst des Erfolgs Die Fotografien des Malers Alfons Walde Kunstgenuss in der Galerie Gugging Babette Mangolte in der Kunsthalle Wien KUNST.INVESTOR Editorial Liebe Leserinnen und Leser!.. Heute halten Sie die erste Ausgabe des Magazins Käufer weniger zählt. Wie schade. Und wie KUNSTINVESTOR im Jahr 2017 in „Händen“. bezeichnend. Viele Sammler scheinen in Bilder wie in Innovativ, exklusiv und stets mit dem richtigen Riecher Aktien zu investieren. Käufer haben eben nicht nur für aktuelle Entwicklungen informieren wir Sie rund um wieder viel Geld, sie kultivieren auch einen sehr alle wichtigen Themen, die nationalen und selektiven Blick. Mehr noch: Dieser Boom ist noch internationalen Kunstmärkte betreffend. Kunst ist ein lange nicht an seine Grenzen gestoßen. Bilder, interessantes Portfolio und unbestritten die schönste Antiquitäten und andere Sammelobjekte nehmen im Beimischung für Ihr Investment- inspirierend, nicht Rahmen der Veranstaltungen einen immer höheren allein in ideeller Hinsicht. Besonders in Zeiten, da Stellenwert ein. Dies bestätigen die hervorragenden Bullen auf sich warten lassen und Renditen an der Ergebnisse der Auktionshäuser. Weil es bei allen Nulllinie kratzen, etablieren sich Kunstwerke als stabile, Dingen des Lebens immer auf den richtigen Mix vor allem aber als rentable Assets. Eine Tatsache, der ankommt, wollen wir Sie nicht nur mit fundierten sich selbst hartgesottene Aktionäre nicht entziehen Hintergrundberichten, präzise recherchierten Topstorys, können. Außenseiter der Kunstgeschichte profitieren wichtigen Nachrichten und aktuellen Interviews davon nicht substanziell in Kunst interessiert zu sein, begeistern. Lesen Sie die aktuelle Ausgabe weil die zeitlichen Intervalle von einer Aktienbaisse zur KUNSTINVESTOR, wo Sie sich ein aktuelles Bild über nächsten immer wieder kürzer werden- wäre auch zu den Kunst- & Geldmarkt verschaffen können- eine erwarten, dass die persönliche Entscheidung dieser wirklich gute Investition.