Franz Schubert Eine Sendereihe Von Christine Lemke-Matwey
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schubert: the Nonsense Society Revisited
© Copyright, Princeton University Press. No part of this book may be distributed, posted, or reproduced in any form by digital or mechanical means without prior written permission of the publisher. Schubert: The Nonsense Society Revisited RITA STEBLIN Twenty years have now passed since I discovered materials belonging to the Unsinnsgesellschaft (Nonsense Society).1 This informal club, active in Vienna from April 1817 to December 1818, consisted mainly of young painters and poets with Schubert as one of its central members. In this essay I will review this discovery, my ensuing interpretations, and provide some new observations. In January 1994, at the start of a research project on Schubert ico- nography, I studied some illustrated documents at the Historisches Museum der Stadt Wien (now the Wienmuseum am Karlsplatz), titled “Unsinniaden.”2 The documents comprise forty-four watercolor pictures and thirty-seven pages of text recording two festive events celebrated by the Nonsense Society: the New Year’s Eve party at the end of 1817 and the group’s first birthday party on 18 April 1818.3 The pictures depict various club members, identified by their code names and dressed in fan- ciful costumes, as well as four group scenes for the first event, including Vivat es lebe Blasius Leks (Long live Blasius Leks; Figure 1), and two group scenes for the second event, including Feuergeister-Scene (Fire Spirit Scene; Figure 6 below).4 Because of the use of code names—and the misidentifi- cations written on the pictures by some previous owner of the -

January – February 2018 Concert Diary
JAN/ FEB 2017/18 SEASON www.wigmore-hall.org.uk How to Book Wigmore Hall Box Office TICKETS 36 Wigmore Street, London W1U 2BP Unless otherwise stated, tickets are divided into five prices ranges: In Person Stalls C – M Highest price 7 days a week: 10am – 8.30pm. Stalls A – B, N – P 2nd highest price Days without an evening concert 10am – 5pm. Balcony A – D 2nd highest price No advance booking in the half hour prior to Stalls BB, CC, Q – S 3rd highest price a concert. Stalls AA, T – V 4th highest price Stalls W – X Lowest price By Telephone: 020 7935 2141 7 days a week: 10.00am–7.00pm. AA AA Days without an evening concert: AA STAGE AA AA AA 10.00am–5.00pm. BB BB There is a non-refundable £3.00 administration CC CC A A charge for each transaction. B B C C D D Online: www.wigmore-hall.org.uk E E F FRONT FRONT F STALLS STALLS 7 days a week; 24 hours a day. G G There is a non-refundable £2.00 administration H H I I charge. J J K K L L Standby Tickets M M N N Standby tickets for students, senior citizens and O O P P the unemployed are available from one hour Q Q before the performance (subject to availability) R R S S with best available seats sold at the lowest price. REAR REAR T STALLS STALLS T U U NB standby tickets are not available for V V Lunchtime and Coffee Concerts. -
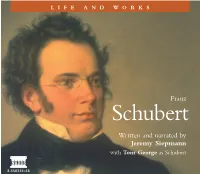
Franz Schubert Written and Narrated by Jeremy Siepmann with Tom George As Schubert
LIFE AND WORKS Franz Schubert Written and narrated by Jeremy Siepmann with Tom George as Schubert 8.558135–38 Life and Works: Franz Schubert Preface If music is ‘about’ anything, it’s about life. No other medium can so quickly or more comprehensively lay bare the very soul of those who make or compose it. Biographies confined to the limitations of text are therefore at a serious disadvantage when it comes to the lives of composers. Only by combining verbal language with the music itself can one hope to achieve a fully rounded portrait. In the present series, the words of composers and their contemporaries are brought to life by distinguished actors in a narrative liberally spiced with musical illustrations. Unlike the standard audio portrait, the music is not used here simply for purposes of illustration within a basically narrative context. Thus we often hear very substantial chunks, and in several cases whole movements, which may be felt by some to ‘interrupt’ the story; but as its title implies the series is not just about the lives of the great composers, it is also an exploration of their works. Dismemberment of these for ‘theatrical’ effect would thus be almost sacrilegious! Likewise, the booklet is more than a complementary appendage and may be read independently, with no loss of interest or connection. Jeremy Siepmann 8.558135–38 3 Life and Works: Franz Schubert © AKG Portrait of Franz Schubert, watercolour, by Wilhelm August Rieder 8.558135–38 Life and Works: Franz Schubert Franz Schubert(1797-1828) Contents Page Track Lists 6 Cast 11 1 Historical Background: The Nineteenth Century 16 2 Schubert in His Time 26 3 The Major Works and Their Significance 41 4 A Graded Listening Plan 68 5 Recommended Reading 76 6 Personalities 82 7 A Calendar of Schubert’s Life 98 8 Glossary 132 The full spoken text can be found on the CD-ROM part of the discs and at: www.naxos.com/lifeandworks/schubert/spokentext 8.558135–38 5 Life and Works: Franz Schubert 1 Piano Quintet in A major (‘Trout’), D. -

Ilker Arcayürek Ilker Arcayürek
FRANZ SCHUBERT : DER EINSAME ILKER ARCAYÜREK ILKER ARCAYÜREK tenor SIMON LEPPER piano FOREWORD TRACK LISTING FRANZ SCHUBERT (1797 –1828) Schubert and the feeling of solitude have been my companions for many years. We can 1 Frühlingsglaube D686 03’13 find ourselves alone as the result of many different circumstances in life – unhappiness 2 Nachtstück D672 05’51 in love, a bereavement, or simply moving to another country. For me, however, being 3 Sehnsucht D879 02’46 alone has never meant being ‘lonely’. 4 Schäfers Klagelied D121 03’36 As in Schubert’s song Der Einsame , I try to enjoy the small things in life, and, 5 Der Musensohn D764 02’14 especially in those times when I am alone, to consciously take time out of 6 Romanze zum Drama ‘Rosamunde’ D797/3b 03’49 everyday life and reflect on my own experiences. I find that making music is 7 Der Schiffer D536 02’00 a particularly good way of occupying myself in moments of solitude. 8 Der Jüngling an der Quelle D300 01’45 9 Über Wildemann D884 02:19 A running brook, a broken heart, the bitter-sweet release of death – few 10 Abendstern D806 02’29 composers have succeeded in setting these varied images to music as Drei Gesänge des Harfners D478 transparently as Schubert did. His diverse emotional and musical world had 11 i Wer sich der Einsamkeit ergibt 04’03 me under its spell from an early age. This developed into such a thirst for 12 ii Wer nie sein Brot mit Tränen a ß 04’46 more that now I can hardly wait to sing works by Schubert that are new to 13 iii An die Türen will ich schleichen 02’21 me. -

A Guide to Franz Schubert's Religious Songs
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by IUScholarWorks A GUIDE TO FRANZ SCHUBERT’S RELIGIOUS SONGS by Jason Jye-Sung Moon Submitted to the faculty of the Indiana University Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music in Voice December 2013 Accepted by the faculty of the Indiana University Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music in Voice. __________________________________ Mary Ann Hart, Chair & Research Director __________________________________ William Jon Gray __________________________________ Robert Harrison __________________________________ Brian Horne ii Copyright © 2013 by Jason Jye-Sung Moon All rights reserved iii Acknowledgements I would like to express my deepest gratitude to my committee chair and research director, Professor Mary Ann Hart, for the excellent guidance, caring, patience, and encouragement I needed to finish this long journey. I would also like to thank Dr. Brian Horne, who supported me with prayers and encouragement. He patiently corrected my writing even at the last moment. I would like to thank my good friend, Barbara Kirschner, who was with me throughout the writing process to help me by proofreading my entire document and constantly cheering me on. My family was always there for me. I thank my daughters, Christine and Joanne, my parents, and my mother-in-law for supporting me with their best wishes. My wife, Yoon Nam, deserves special thanks for standing by me with continuous prayers and care. I thank God for bring all these good people into my life. -

The Singer's Guide to German Diction: Supplements
The Singer’s Guide to German Diction Supplements Valentin Lanzrein and Richard Cross The Singer's Guide to German Diction: Supplements Contents LYRIC DICTION IN MUSICAL CONTEXT Vowels in Singing The Glottal Separation in Singing Diphthongs in Singing Schwa and Vocalic-R in Singing Word Stress in Singing Consonants in Singing Initial Consonant Anticipation Final Consonant Suspension Consonant Clusters Consonant Assimilation: Merges and Implosions Anticipation of Sustainable Consonants for Expressiveness SUPPLEMENTAL EXERCISES AND WORKSHEETS Musical Exercises Musical Exercises for [iː], [i], [i̯], and [ɪ] Musical Exercises for [eː], [ɛː], [ɛ], and [ə] Musical Exercises for [ɑː] and [a] Musical Exercises for [oː] and [ɔ] Musical Exercises for [uː] and [ʊ] Musical Exercises for [øː] and [œ] Musical Exercises for [yː] and [ʏ] Musical Exercises for [a͡e], [ɑ͡o], and [ɔ͡ø] Musical Exercises for [f] and [v] Musical Exercises for [s] and [z] Musical Exercises for [ʃ] and [ʒ] Musical Exercises for [ʝ], [ç], and [x] Musical Exercises for [h] and [ǀ] Musical Exercises for [p] and [b] Musical Exercises for [t] and [d] Musical Exercises for [k] and [ɡ] Musical Exercises for [m], [n], and [ŋ] Musical Exercises for [l] Musical Exercises for [r], [ɾ], and [ɐ] Musical Exercises for [p͡s], [p͡f], [ts],͡ [tʃ͡ ], [k͡s], and [k͡v] Worksheets Worksheet 2.5: Word Structure Worksheet 2.6: Word Stress Worksheet 4.1: [iː], [i], [i̯], and [ɪ] Worksheet 4.2: [eː], [e], [ɛː], [ɛ], and [ə] Worksheet 4.3: [ɑː] and [a] The Singer's Guide to German Diction: Supplements Worksheet 5.1: [oː], [o], and [ɔ] Worksheet 5.2: [uː], [u], and [ʊ] Worksheet 6.1: [øː] and [œ] Worksheet 6.2: [yː], [y], and [ʏ] Worksheet 7.1: [a͡e], [ɑ͡o], and [ɔ͡ø] Worksheet 9.1: [f] and [v] Worksheet 9.3: [s], [z], [ʃ], and [ʒ] Worksheet 9.4: [ʝ], [ç], and [x] Worksheet 9.6: [h] and [ǀ] Worksheet 10.3: [p], [b], [t], [d], [k], and [ɡ] Worksheet 11.3: [m], [n], and [ŋ] Worksheet 12.2: [l], [r], [ɾ], and [ɐ] Worksheet 13.1: [p͡s], [p͡f], [ts],͡ [tʃ͡ ], [k͡s], and [k͡v] Worksheet: Review Section II. -

570764Bk Schubert US 18/9/09 11:02 Page 8
570764bk Schubert US 18/9/09 11:02 Page 8 Morten Schuldt-Jensen A graduate of the Royal Danish Academy of Music, Morten Schuldt- SCHUBERT Jensen holds a Master’s degree in musicology from the University of Copenhagen. Post-graduate courses include study with, among others, Sergiù Celibidache and Eric Ericson. He forged an early career in successful performances with internationally acclaimed Danish choirs and orchestras, culminating in his appointment as Representative Mass in C major • Mass in G major Conductor for Denmark (Nordic-Baltic Choral Festival). He is also a regular guest conductor for various distinguished German orchestras and choirs including the RIAS-Kammerchor, Berlin; the MDR Deutsche Messe Rundfunk-Chor, Leipzig; the NDR-Chor, Hamburg; the Akademie für Alte Musik, Berlin; the Gewandhausorchester, Leipzig and the Helsingborgs Symfoniorkester. He has also worked frequently with the Immortal Bach Ensemble • Leipziger Kammerorchester Danish National Radio Choir and the Philharmonic Orchestra of Copenhagen. As a chorus master he has worked with conductors Morten Schuldt-Jensen including Sir Simon Rattle, Herbert Blomstedt, Philippe Herreweghe, Vladimir Ashkenazy, Lothar Zagrosek and many others. From 1999 to 2006 he was director of choirs at the Gewandhaus in Leipzig, where he founded the Gewandhaus Chamber Choir in 2001, an ensemble known now as the Immortal Bach Ensemble. In 2000 he was appointed principal conductor and artistic director of the Leipzig Chamber Orchestra. Wide ranging and unusual repertoire, accurate sense of style and a broad variety of interpretation characterise his work with both ensembles, documented in a number or recordings and broadcasts. In his home country of Denmark he founded and conducts the chamber choir Sokkelund Sangkor, with which he has won several international awards. -

Angelika Kirchschlager, Mezzo-Soprano Malcolm Martineau
Cal Performances Presents Program Sunday, April 19, 2009, 3pm Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) Five Songs, Op. 38 (1948) Hertz Hall Glückwunsch Der Kranke Alt-Spanisch Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano Alt-English My Mistress’ Eyes Malcolm Martineau, piano Kurt Weill (1900–1950) Stay Well, from Lost in the Stars (1949) Complainte de la Seine (1934) Der Abschiedsbrief (1933) PROGRAM Je ne t’aime pas (1934) Franz Schubert (1797–1828) Fischerweise, D. 881, Op. 96, No. 4 (1826) The concert is part of the Koret Recital Series and is made possible, in part, Der Wanderer an den Mond, D. 870 (1826) by Patron Sponsors Nancy and Gordon Douglass, in honor of Robert Cole. Bertas Lied in der Nacht, D. 653 (1819) Wehmut, D. 772, Op. 22, No. 2 (1823) Cal Performances’ 2008–2009 season is sponsored by Wells Fargo Bank. Frühlingsglaube, D. 686 (1820) Im Frühling, D. 882, Op. 101, No. 1 (1826) Schubert Die Sterne, D. 939, Op. 96, No. 1 (1815) Lied der Anne Lyle, D. 830, Op. 85, No. 1 (1825) Abschied, D. 475 (1816) Rastlose Liebe, D. 138 (1815) Klärchen’s Lied, D. 210 (1815) Geheimes, D. 719 (1821) Versunken, D. 715 (1821) INTERMISSION CANCELED CANCELED 6 CAL PERFORMANCES CAL PERFORMANCES 7 Program Notes Program Notes Franz Schubert (1797–1828) suggests both the vigorous activity and the deep fashionable music lovers, and, in appreciation, his verses when Johann Schickh published some of Selected Songs contentment of the trade. he set five of Collin’s poems, including Wehmut them in his Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater Johann Gabriel Seidl (1804–1875), teacher, (“Sadness”) in 1823. -

Late Style and the Paradoxical Poetics of the Schubert–Berio Renderings Lorraine Byrne Bodley
Chapter 14 Late style and the paradoxical poetics of the Schubert–Berio Renderings Lorraine Byrne Bodley The artistic career of Franz Schubert still presents a strange paradox. Some scholars have regarded him almost as an empyrean figure who has written the best Lieder in vocal literature.1 But even that is sometimes held against him. In a discussion of the “Unfinished” Symphony Carl Dahlhaus criticizes the static lyricism of Schubert’s themes, which he considers self-contained and incapable of development—an opinion contradicted by Gustav Mahler when he declared: “You could easily take up a theme by Schubert and develop it for the first time. You wouldn’t even do any harm to the themes: they are so undeveloped.”2 Meanwhile questions about Schubert’s sexuality have been raised because of his entanglements with Vogl as well as epistolary relations with members of the reading circle.3 And then there was his bachelor life with Franz Schober.4 And his alleged devotion to Therese Grob, the soprano who was “the first and most ardent love of his life,” as Brian Newbould writes in his richly informative biography.5 An artistic figure who practices concealment attracts all the more interest, as many artists know. In contrast to the voluminous correspondence, diaries, and recorded conversations with Goethe, less than a hundred Schubert letters survive. So we have unanswered questions about Schubert’s life: his journeyman years; his romantic relationships; his preoccupation with death; the counter-images of the 1 For an example of such clichéd portraits, see such older biographies as Hans Gál, Franz Schubert and the Essence of Melody (London: Victor Gollancz Ltd, 1974), p. -

University of Cincinnati
UNIVERSITY OF CINCINNATI Date: May 26, 2004 I, Amanda Marie Roggero _____________________________________________________, hereby submit this work as part of the requirements for the degree of: Doctor of Musical Arts in: Piano Performance It is entitled: “RETRACING THE JOURNEY OF FRANZ SCHUBERT’S WANDERER: MUSICAL FINGERPRINTS IN THE B-FLAT PIANO SONATA, D. 960” This work and its defense approved by: Chair: Mr. Frank Weinstock Dr. Stephanie Schlagel Dr. Edward Nowacki RETRACING THE JOURNEY OF FRANZ SCHUBERT’S WANDERER: MUSICAL FINGERPRINTS IN THE B-FLAT PIANO SONATA, D. 960 A document submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS in the Division of Piano Performance of the College-Conservatory of Music 2004 by Amanda Roggero B.M. Rice University, 1998 M.M. University of Cincinnati, 2000 Committee Chair: Frank Weinstock ABSTRACT Franz Schubert’s last piano Sonata in B-flat, major, D. 960, has always remained an intriguing piece of music for me ever since hearing it for the first time when I was an undergraduate at Rice University. Even though the technique required within the B-flat Sonata is not as difficult as other Schubert piano works, a performance of this piece cannot be approached lightly considering the emotional concentration that the music demands. This document is dedicated to exploring the source of the Sonata in B-flat’s emotional content, which will involve Schubert’s failing health, his depression, and his preoccupation with a popular character in German Romanticism, the Wanderer. -

Franz Schubert's Chamber Music with Guitar: a Study of the Guitar's Role in Biedermeier Vienna Stephen Mattingly
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2007 Franz Schubert's Chamber Music with Guitar: A Study of the Guitar's Role in Biedermeier Vienna Stephen Mattingly Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC FRANZ SCHUBERT’S CHAMBER MUSIC WITH GUITAR: A Study of the Guitar’s Role in Biedermeier Vienna By STEPHEN MATTINGLY A Treatise submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music Degree Awarded: Spring Semester, 2007 Copyright © 2007 Stephen Mattingly All Rights Reserved The members of the Committee approve the treatise of Stephen Mattingly defended on March 26, 2007. ______________________________ Michael Buchler Professor Directing Treatise ______________________________ Nancy Rogers Outside Committee Member ______________________________ Bruce Holzman Committee Member ______________________________ Melanie Punter Committee Member ______________________________ Larry Gerber Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii ACKNOWLEDGEMENTS The following organizations deserve special thanks for their material support of this project: the Presser Foundation for their generous grant to fund the recording and research of “Schubert’s Complete Chamber Music with Guitar”, the Vienna Schubertbund and the Schubert Institute of the United Kingdom for their -

Robert Schumann and the Gesangverein: the Dresden Years (1844 - 1850) Gina Pellegrino Washington University in St
Washington University in St. Louis Washington University Open Scholarship All Theses and Dissertations (ETDs) January 2011 Robert Schumann and the Gesangverein: The Dresden Years (1844 - 1850) Gina Pellegrino Washington University in St. Louis Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/etd Recommended Citation Pellegrino, Gina, "Robert Schumann and the Gesangverein: The Dresden Years (1844 - 1850)" (2011). All Theses and Dissertations (ETDs). 276. https://openscholarship.wustl.edu/etd/276 This Dissertation is brought to you for free and open access by Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in All Theses and Dissertations (ETDs) by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS Department of Music Dissertation Examination Committee: Hugh Macdonald, Chair Garland Allen Todd Decker Martin Kennedy Michael Lützeler Craig Monson John Stewart ROBERT SCHUMANN AND THE GESANGVEREIN: THE DRESDEN YEARS (1844–1850) by Gina Marie Pellegrino A dissertation presented to the Graduate School of Arts and Sciences of Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy May 2011 Saint Louis, Missouri ABSTRACT Nineteenth-century Germany saw an expansion of choral music in a secular context, bringing about changes not only in the nature of the organizations but also in the character of the music. Often depicted in history books as the age of the Lied, the early nineteenth century was also the age of the Chorgesang, creating a demand for music for social gatherings. Amateur choruses and partsinging reached their peak of popularity in nineteenth-century Germany.