Länderreport 36 China (Stand: 05/2021)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Development Projects in Tibetan Areas of China: Articulating Clear Goals and Achieving Sustainable Results
DEVELOPMENT PROJECTS IN TIBETAN AREAS OF CHINA: ARTICULATING CLEAR GOALS AND ACHIEVING SUSTAINABLE RESULTS ROUNDTABLE BEFORE THE CONGRESSIONAL-EXECUTIVE COMMISSION ON CHINA ONE HUNDRED EIGHTH CONGRESS SECOND SESSION MARCH 19, 2004 Printed for the use of the Congressional-Executive Commission on China ( Available via the World Wide Web: http://www.cecc.gov U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 93–221 PDF WASHINGTON : 2004 For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Internet: bookstore.gpo.gov Phone: toll free (866) 512–1800; DC area (202) 512–1800 Fax: (202) 512–2250 Mail: Stop SSOP, Washington, DC 20402–0001 VerDate 11-MAY-2000 11:20 Apr 26, 2004 Jkt 000000 PO 00000 Frm 00001 Fmt 5011 Sfmt 5011 93221.TXT China1 PsN: China1 CONGRESSIONAL-EXECUTIVE COMMISSION ON CHINA LEGISLATIVE BRANCH COMMISSIONERS House Senate JIM LEACH, Iowa, Chairman CHUCK HAGEL, Nebraska, Co-Chairman DOUG BEREUTER, Nebraska CRAIG THOMAS, Wyoming DAVID DREIER, California SAM BROWNBACK, Kansas FRANK WOLF, Virginia PAT ROBERTS, Kansas JOE PITTS, Pennsylvania GORDON SMITH, Oregon SANDER LEVIN, Michigan MAX BAUCUS, Montana MARCY KAPTUR, Ohio CARL LEVIN, Michigan SHERROD BROWN, Ohio DIANNE FEINSTEIN, California DAVID WU, Oregon BYRON DORGAN, North Dakota EXECUTIVE BRANCH COMMISSIONERS PAULA DOBRIANSKY, Department of State GRANT ALDONAS, Department of Commerce LORNE CRANER, Department of State JAMES KELLY, Department of State STEPHEN J. LAW, Department of Labor JOHN FOARDE, Staff Director DAVID DORMAN, Deputy Staff Director (II) VerDate 11-MAY-2000 11:20 Apr 26, 2004 Jkt 000000 PO 00000 Frm 00002 Fmt 0486 Sfmt 0486 93221.TXT China1 PsN: China1 C O N T E N T S Page STATEMENTS Miller, Daniel, agricultural officer, U.S. -

Table of Codes for Each Court of Each Level
Table of Codes for Each Court of Each Level Corresponding Type Chinese Court Region Court Name Administrative Name Code Code Area Supreme People’s Court 最高人民法院 最高法 Higher People's Court of 北京市高级人民 Beijing 京 110000 1 Beijing Municipality 法院 Municipality No. 1 Intermediate People's 北京市第一中级 京 01 2 Court of Beijing Municipality 人民法院 Shijingshan Shijingshan District People’s 北京市石景山区 京 0107 110107 District of Beijing 1 Court of Beijing Municipality 人民法院 Municipality Haidian District of Haidian District People’s 北京市海淀区人 京 0108 110108 Beijing 1 Court of Beijing Municipality 民法院 Municipality Mentougou Mentougou District People’s 北京市门头沟区 京 0109 110109 District of Beijing 1 Court of Beijing Municipality 人民法院 Municipality Changping Changping District People’s 北京市昌平区人 京 0114 110114 District of Beijing 1 Court of Beijing Municipality 民法院 Municipality Yanqing County People’s 延庆县人民法院 京 0229 110229 Yanqing County 1 Court No. 2 Intermediate People's 北京市第二中级 京 02 2 Court of Beijing Municipality 人民法院 Dongcheng Dongcheng District People’s 北京市东城区人 京 0101 110101 District of Beijing 1 Court of Beijing Municipality 民法院 Municipality Xicheng District Xicheng District People’s 北京市西城区人 京 0102 110102 of Beijing 1 Court of Beijing Municipality 民法院 Municipality Fengtai District of Fengtai District People’s 北京市丰台区人 京 0106 110106 Beijing 1 Court of Beijing Municipality 民法院 Municipality 1 Fangshan District Fangshan District People’s 北京市房山区人 京 0111 110111 of Beijing 1 Court of Beijing Municipality 民法院 Municipality Daxing District of Daxing District People’s 北京市大兴区人 京 0115 -

Copy of TCHRD August 2019 Digest
M A R C H 2 0 2 0 Monthly Translation and Analyses Digest A compilation of selected stories, translation and analyses of Chinese government media reports that are otherwise available only in Chinese and Tibetan language. Front page image: A Tibetan nomad in Tsonyi County, Nagchu Prefecture, Tibet Autonomous Region, 30 January 2019. (Xinhua/Purbu Zhaxi) In this issue China's nomad relocation plan displaces more than 130000 Tibetans China's nomad in TAR relocation plan displaces more than Chinese authorities in Tibet Autonomous Region 130000 Tibetans in (TAR) have announced that the Ecological TAR Relocation Plan (2018-2025) for extremely high altitude areas of more than 4,800 meters in Nagchu (Ch: Naqu), Ngari (Ch: Ali), and Shigatse Chinese cadres and (Ch: Xigaze) cities, which will result in the relocation migrants resume work at of more than 130,000 people living in 20 counties, Tibet dam amid 97 townships, and 450 villages, out of which more coronavirus than 100,000 people will be relocated along the banks of Yarlung Tsangpo River (upper stream of fears Brahmaputra), where the government is building a M A R C H 2 0 2 0 “modern town with complete facilities on an unavailable for human activities, a substantial extensive scale”, reported Xinhua on 18 number considering that the combined land March. size of Ngari, Nagchu, and Shigatse is more than 800,000 sq. km. More than 80 per cent The report quoted Tashi Dorjee, director of the of the targeted area under the plan consists Nature Reserve Management Division of the of protected areas from where all grazing is TAR Forestry and Grassland Bureau, as banned and nomadic livelihood is saying that the purpose of the relocation was criminalised. -

1 Tibet Insight, October-December 2020
TIBET INSIGHT, OCTOBER-DECEMBER 2020 1 TAR NEWS Tibet Insight News: October 2020 Head of TAR UFWD inspects Zezhol Monastery in Chamdo October 30, 2020 On October 28, Danke, Standing Committee Member of TAR Party Committee, Minister of TAR United Front Work Department (UFWD) and Vice-Chairman of TAR Political Consultative Conference (PPCC) inspected Zezhol Monastery, an important and one of the oldest monasteries of the Yundrung Bon sect, in Chamdo. The inspection was to evaluate the monastery’s understanding and implementation of the ‘spirit’ of the Seventh Work Forum on Tibet, investigate monastic management and ascertain the “progress” of patriotic re-education activities especially the “four standards to become exemplary monks and nuns”. At a meeting during his visit, Danke shared that a blueprint of how to build a ‘united, prosperous, harmonious and socialist new Tibet’ was drafted after the Seventh Work Forum on Tibet and the TAR Party Committee’s eighth plenary session. He said the primary political task of religious institutions and representatives, at present and in the future, should be to study in-depth and comprehensively of the spirit of the Tibet Work Forum, Xi Jinping’s “strategic exposition” of governing and stabilising Tibet’s borders, and “sinicization of Tibetan Buddhism”. Briefly, the Head of TAR UFWD stressed the following: 1. The need to resolutely study, implement and carry forward the spirit of all the seven work forums on Tibet, unify political positions, unswervingly follow the path of socialism with Chinese characteristics, safeguard national unity and strengthen all propaganda campaigns; 2. The need to reciprocate the love to the “core”, meaning to Xi Jinping and his “special care and love” for Tibet, thereby improving political and ideological consciousness, 3. -

General Assembly Distr.: General 17 February 2021
United Nations A/HRC/46/NGO/18 General Assembly Distr.: General 17 February 2021 English only Human Rights Council Forty-sixth session 22 February–19 March 2021 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development Written statement* submitted by China Society for Human Rights Studies (CSHRS), a non-governmental organization in special consultative status The Secretary-General has received the following written statement which is circulated in accordance with Economic and Social Council resolution 1996/31. [29 January 2021] * Issued as received, in the language(s) of submission only. GE.21-02149(E) A/HRC/46/NGO/18 Various Measures and Targeted Strategy-Enlightenment of Poverty-Alleviation in the Tibet Autonomous Region, China Before the peaceful liberation of the Tibet Autonomous Region, China in the last century, the Tibetan society had been in the long-term isolation and had stagnated. The Tibet Autonomous Region, China was peacefully liberated in 1951. Since then, the central government’s development policy for the Tibet Autonomous Region, China has always followed the development concept of people first, developed Tibet’s social and economic undertakings in an all-round way, and carried out a lot of assistance to the poor. I. Poverty situation in the Tibet Autonomous Region, China Before the peaceful liberation, the Tibet Autonomous Region, China was generally in extreme poverty. In 1951, the number of beggars in the capital city Lhasa accounted for one-tenth of the urban population. When the Tibet Autonomous Region, China was liberated, the broad masses of the people have become the masters of the country, and the people's lives have greatly improved. -
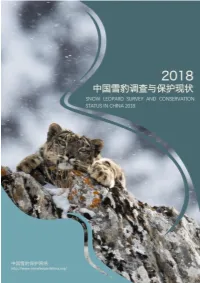
Snow Leopard Survey and Conservation Status in China 2018
1 / 100 Snow Leopard China is a network of research institutions, non-government organizations, and nature reserves dedicated to sharing and promoting snow leopard research and conservation in China through various means, such as reporting and website presentation, online and land-based communication, technical support, training, and forum-based exchange. This report is jointly prepared by the members of Snow Leopard China with respect to snow leopards in China. Contributors hereto are listed as follows (in no particular order): Guangzhou Yuanwang Wildlife Conservation Services; WWF; Wild Xinjiang; Chinese Felid Conservation Alliance (CFCA); Qinghai Yuan Shang Cao Conservation Center; Sichuan Green River Environmental Protection Initiative; Beijing Qiaonyu Foundation; Sanjiangyuan (Three-River-Source) National Park Administration; Wolong National Nature Reserve; Gongga Mountain National Nature Reserve; the government of Sojia Town, Zhidoi County (Tongtian Snow Leopard Group); Peking University Center for Nature and Society; Peking University Wildlife Ecology and Conservation Research Group; Chinese Academy of Sciences Northwest Institute of Plateau Biology; Chinese Academy of Forestry Institute of Forest Ecology and Conservation; Beijing Forestry University Wildlife Institute; Eco- Bridge Continental; Shanshui Conservation Center (SCC). Snow Leopard China. All rights reserved. Web: http://www.snowleopardchina.org/ This publication may be referenced and used for education, conservation, and other non-commercial purposes, without a copyright -

Poverty Among Tibetan Nomads: Profiles of Poverty And
Poverty Among Tibetan Nomads: Profiles of Poverty and Strategies for Poverty Reduction and Sustainable Development [i] Daniel Miller[ii] Introduction to the Tibetan Pastoral Area The Tibetan nomadic pastoral area, located on the Tibetan plateau in western China, is one of the world’s most remarkable grazingland ecosystems (Ekvall 1974, Goldstein and Beall 1990, Miller 1998c). Stretching for almost 3,000 km from west to east and 1,500 km from south to north and encompassing about 1.6 million sq. km., the Tibetan pastoral area makes up almost half of China’s total rangeland area, equivalent in size to almost the entire land area of the country of Mongolia. As such, the Tibetan pastoral area is one of the largest pastoral areas on earth. The Tibetan pastoral area sustains an estimated two million nomads and an additional three million agro- pastoralists and supports a large livestock population of some 10 million yaks and 30 million sheep and goats. Tibetan nomadic pastoralism is distinct ecologically from pastoralism in most other regions of the world (Ekvall 1968, Miller 2000). The key distinguishing factors that separate Tibetan nomadic areas from cultivated areas are altitude and temperature, in contrast to most other pastoral areas where the key factor is usually the lack of water. Tibetan nomads prosper at altitudes from 3,000 to 5,000 m in environments too cold for crop cultivation. Yet, at these elevations there is still extensive and very productive grazing land that provides nutritious forage for nomads’ herds. Tibetan pastoralism has flourished to this day because there has been little encroachment into the nomadic areas by farmers trying to plow up the grass and plant crops. -

County-Level Heat Vulnerability of Urban and Rural Residents in Tibet, China Li Bai1, Alistair Woodward2, Cirendunzhu3 and Qiyong Liu1,4*
Bai et al. Environmental Health (2016) 15:3 DOI 10.1186/s12940-015-0081-0 RESEARCH Open Access County-level heat vulnerability of urban and rural residents in Tibet, China Li Bai1, Alistair Woodward2, Cirendunzhu3 and Qiyong Liu1,4* Abstract Background: Tibet is especially vulnerable to climate change due to the relatively rapid rise of temperature over past decades. The effects on mortality and morbidity of extreme heat in Tibet have been examined in previous studies; no heat adaptation initiatives have yet been implemented. We estimated heat vulnerability of urban and rural populations in 73 Tibetan counties and identified potential areas for public health intervention and further research. Methods: According to data availability and vulnerability factors identified previously in Tibet and elsewhere, we selected 10 variables related to advanced age, low income, illiteracy, physical and mental disability, small living spaces and living alone. We separately created and mapped county-level cumulative heat vulnerability indices for urban and rural residents by summing up factor scores produced by a principal components analysis (PCA). Results: For both study populations, PCA yielded four factors with similar structure. The components for rural and urban residents explained 76.5 % and 77.7 % respectively of the variability in the original vulnerability variables. We found spatial variability of heat vulnerability across counties, with generally higher vulnerability in high-altitude counties. Although we observed similar median values and ranges of the cumulative heat vulnerability index values among urban and rural residents overall, the pattern varied strongly from one county to another. Conclusions: We have developed a measure of population vulnerability to high temperatures in Tibet. -
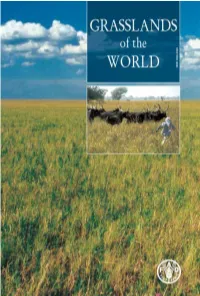
Grasslands of the World.Pdf
The views expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. The mention or omission of specific companies, their products or brand names does not imply any endorsement or judgement by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. ISBN 92-5-105337-5 All rights reserved. Reproduction and dissemination of material in this information product for educational or other non-commercial purposes are authorized without any prior written permission from the copyright holders provided the source is fully acknowledged. Reproduction of material in this information product for resale or other commercial purposes is prohibited without written permission of the copyright holders. Applications for such permission should be addressed to the Chief, Publishing Management Service, Information Division, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy or by e-mail to [email protected] © FAO 2005 CONTENTS Foreword xiii Acknowledgements xv Contributors xvii Glossary of technical terms and abbreviations used in the text xviii Chapter 1 – Introduction 1 Purpose of the book 13 Structure of the book 13 Complementary information resources 16 References 17 Chapter 2 – The changing face of pastoral systems in grass-dominated ecosystems of eastern Africa 19 R.S. -

2019 July Tibet Digest Final
Tibet Digest July 2019 FOUNDATION FOR NON-VIOLENT ALTERNATIVES Tibet Digest is a monthly publication brought out by FNVA containing relevant news pertaining to Tibet, Chinese politics and Sino Indian relations that appear mostly but not restricted to the Chinese state media. www.fnvaworld.org (under update) 143, 4th Floor, Uday Park, New Delhi, 49 offi[email protected] TIBET DIGEST, JULY 2019 ! !1 July 2019 1 China’s Tibet Policy 6 320 villages listed as key rural tourism spots 6 China dispatches 2,307 young cadres in aid for Tibet, Qinghai 6 Tibet relics to be exhibited in Beijing 7 Tibetans Beaten, Detained in Kardze Over Dalai Lama Photos 7 11th Panchen Lama goes to Ngari for Buddhist activities 8 Tibetan Jailed in Qinghai For Listening to Foreign News Broadcasts is Freed Early For ‘Good Behavior’ 9 26 prehistoric human activity sites discovered on Qinghai-Tibet Plateau 9 Tibet funds poor students through paper recycling 10 Reservation required for visiting Potala Palace 10 Top political advisor stresses ethnic, religious affairs, poverty alleviation 10 Tibetan Buddhism Suppressed: Lamas Closely Monitored, Temple Destroyed 11 Lhasa posts double-digit increase of visitor arrivals 12 Travel Restrictions Imposed on Sichuan’s Yachen Gar Buddhist Center 12 Communist China to provide ‘guidance’ to temples, churches 13 China denies reports of having Xinjiang-like mass detention camps in Tibet 14 Top political adviser praises work of religious committee 14 China forces tourists to install an app that steals data 15 Thousands of Monks, Nuns ‘Politically -

VOLUME 20 • ISSUE 17 • SEPTEMBER 28, 2020 The
VOLUME 20 • ISSUE 17 • SEPTEMBER 28, 2020 IN THIS ISSUE: The CCP’s New Directives for United Front Work in Private Enterprises By John Dotson………………………………………………………pp. 1-6 Xinjiang’s System of Militarized Vocational Training Comes to Tibet By Adrian Zenz………………………………………………………..pp. 7-17 India’s “Tibet Card” in the Stand-Off with China: More Provocative than Productive By Sudha Ramachandran…………………………………………….pp. 18-23 Understanding the Intersection of the Belt and Road Initiative and China’s Supply-Side Structural Reform By Jon (Yuan) Jiang……………………………………………………pp. 24-29 The CCP Extends Its Policies of Forced Ethnic Assimilation to Inner Mongolia By Willy Lam……………………………………………………………pp. 30-34 The CCP’s New Directives for United Front Work in Private Enterprises By John Dotson Introduction On September 15, the Chinese Communist Party (CCP) Central Committee Office published a document titled Opinions Concerning Strengthening New Era United Front Work in the Private Economy (关于加强新 时代民营经济统战工作的意见, Guanyu Jiaqiang Xinshidai Minying Jingji Tongzhan Gongzuo de Yijian) (hereafter “Opinions”) (CCP Central Committee, September 15). This document, which lays out directives for CCP organs to take a closer and more direct role in supervising China’s private sector enterprises, is but the latest development in the steadily increase of the roles and responsibilities of the CCP United Front Work 1 ChinaBrief • Volume 20 • Issue 17 • September 28, 2020 Department (UFWD) during the tenure of CCP General Secretary Xi Jinping (China Brief, April 24, 2018; China Brief, May 9, 2019). The Opinions echo earlier statements by CCP leaders about the centrality of united front work (China Brief, May 9, 2019) by asserting that “private economy united front work is a major effort for the entire party” (民营 经济统战工作是全党的重要工作, minying jingji tongzhan gongzuo shi quandang de zhongyao gongzuo) (Opinions, section 8). -

William N. Brown Four Decades of Following China's War
William N. Brown Chasing the Chinese Dream Four Decades of Following China’s War on Poverty Chasing the Chinese Dream William N. Brown Chasing the Chinese Dream Four Decades of Following China’s War on Poverty “China’s targeted poverty alleviation is the world’s only way to help the poor and reach the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development.” UN Secretary-General Antonio Guterres, 2017. William N. Brown MBA Center Xiamen University Xiamen, China ISBN 978-981-16-0653-3 ISBN 978-981-16-0654-0 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-981-16-0654-0 Jointly published with NewChannel International Education Group Limited The print edition is not for sale in China Mainland. Customers from China Mainland please order the print book from NewChannel International Education Group Limited. © NewChannel International Education Group Limited 2021. This book is an open access publication. Open Access This book is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc- nd/4.0/), which permits any noncommercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license and indicate if you modified the licensed material. You do not have permission under this license to share adapted material derived from this book or parts of it. The images or other third party material in this book are included in the book’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material.