Worte Trennen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Alice Creischer Culturgest Lisbon 2017
KOW BRUNNENSTR 9 D–10119 BERLIN ALICE CREISCHER +49 30 311 66 770 GALLERY@KOW–BERLIN.COM CULTURGEST LISBON 2017 „It is March, 24th 2000 which is compelling to be prospective“ The work was exhibited at Culturgest in Lisbon, curated by Miguel Wandschneider, in Alice Creischer February 2017 - among other works ( His Master´s Voice, 2015, and The Greatest Hap- piness Principle Party, 2002). The issue of the work gathers personal and historical as- pects which are leading to the so called „debt crisis“ in Portugal and the „PIGS“ States. It starts with the construction of the Agenda 2010 (inaugurated at the Lisbon Council 2000) which led to the German financial hegemony and its austerity dictat 10 years later. Therefore, I would like to show the work not only in Lisbon but also in the other „PIGS“ states. This discriminating term was invented by the rating agencies for the indebted countries Portugal, Ireland, Greece, Spain in 2011. I would like to show and modify the work in the special local contexts as well as to cooperate with other artists who are working about the same issue. This issue of indebtness and debt economy might be now pushed to the news of yesterday but is dominating seriously the daily life of many people. I believe also that artistic work has certain difficulties to react imme- diatly to political actuality. It needs time to „digest“ and find its ways of reflection and clarity. The work connects personal memories and images with so called scientific facts of the „debt crisis“ and dismantles them as (what Bourdieu called in his critique to the German finance technocrat Thietmeyer) a „deliberate delirium“. -

The Vienna Method in Amsterdam: Peter Alma's Office for Pictorial Statistics Benjamin Benus, Wim Jansen
The Vienna Method in Amsterdam: Peter Alma’s Office for Pictorial Statistics Benjamin Benus, Wim Jansen The Dutch artist and designer, Peter Alma (see Figure 1), is today remembered for his 1939 Amstel Station murals, as well as for Downloaded from http://direct.mit.edu/desi/article-pdf/32/2/19/1715594/desi_a_00379.pdf by guest on 24 September 2021 his earlier involvement with the Cologne-based Gruppe progres- siver Künstler [Progressive Artists’ Group]. Yet Alma also pro- duced an extensive body of information graphics over the course of the 1930s. Working first in Vienna at the Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum [Social and Economic Museum] (GWM) and later setting up an independent design firm in Amsterdam, Alma became one of the principal Dutch practitioners and promoters of the design approach known as the “Vienna Method of Picto- rial Statistics.” To date, most accounts of this method’s history have focused on its chief inventor, Austrian social scientist Otto Figure 1 Neurath, and his principal collaborators, Germans Marie Neurath August Sander, photograph of Peter Alma, (née Reidemeister) and Gerd Arntz.1 Yet Alma’s work in pictorial late 1920s. Private collection. Reproduced by permission from Sinja L. Alma and statistics also constitutes a substantial chapter in this history, Peter L. Alma. although it has not yet been fully appreciated or adequately docu- mented.2 In addition to providing an account of Alma’s role in the 1 For a detailed history of the Vienna development and dissemination of the Vienna Method, this essay Method, see Christopher Burke, Eric assesses the nature of Alma’s contribution to the field of informa- Kindel, and Sue Walker, eds., Isotype: tion design and considers the place of his pictorial statistics work Design and Contexts, 1925–1971 within his larger oeuvre. -
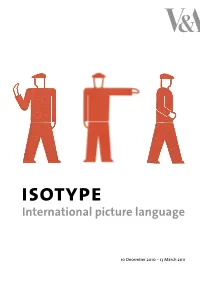
Gallery Guide 7
���������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������� isotype International picture language 10 December 2010 – 13 March 2011 isotype Society and economy (International System Of TYpographic Picture Education) was a method for assembling, configuring and disseminating Isotype was forged in the optimism of the first Austrian information and statistics through pictorial means. Republic. It was developed from 1924 at the Social and Economic Museum of Vienna, where it was first called the Its initiator, Otto Neurath, described it as a ‘language-like Vienna Method of Pictorial Statistics. technique’ characterised by consistency in the use of graphic elements. The basic elements are pictograms – simplified The Social and Economic Museum was funded by the Social pictures of people or things, designed to function as repeat- Democratic municipality of Vienna and shared its socialist able units. agenda. It was not what is usually thought of as a museum: its director Otto Neurath stated that instead of a treasure From its beginnings in Vienna of the 1920s, Isotype spread to chest of rare objects, it should be a teaching museum. The the Netherlands, Britain, the Soviet Union, the United States principal exhibits were charts made with the Vienna Method and elsewhere. Its potential for communicating with people in order to ‘represent social facts pictorially’, as a way of of all ages and nationalities was explored in a wide range of Chart from Gesellschaft communicating with both young people and adults. projects and publications through the 1960s. und Wirtschaft (Society The museum had a global-historical outlook, which it The story of Isotype presents a case study of the Modern and Economy). 1930. -

Art and the Crisis of the European Welfare State Addresses Contemporary Art in the Context of Changing European Welfare States
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO No Such Thing as Society: Art and the Crisis of the European Welfare State A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Art History, Theory and Criticism by Sarah Elsie Lookofsky Committee in charge: Professor Norman Bryson, Co-Chair Professor Lesley Stern, Co-Chair Professor Marcel Hénaff Professor Grant Kester Professor Barbara Kruger 2009 Copyright Sarah Elsie Lookofsky, 2009 All rights reserved. The Dissertation of Sarah Elsie Lookofsky is approved, and it is acceptable in quality and form for publication on microfilm and electronically: Co-Chair Co-Chair University of California, San Diego 2009 iii Dedication For my favorite boys: Daniel, David and Shannon iv Table of Contents Signature Page…….....................................................................................................iii Dedication.....................................................................................................................iv Table of Contents..........................................................................................................v Vita...............................................................................................................................vii Abstract……………………………………………………………………………..viii Chapter 1: “And, You Know, There Is No Such Thing as Society.” ....................... 1 1.1 People vs. Population ............................................................................... 2 1.2 Institutional -

Pictorial Statistics Following the Vienna Method1 Otto Neurath
DOCUMENT picTorial sTaTisTics folloWing The Vienna MeThod1 otto Neurath Science tells us about stars, stones, plants, and animals, and likewise about people and their life together. Science supports its laws and observations based on experience. In its most modern incarnation, science is especially interested in preserving facts visually. Astronomical facts are being photographed directly, while the trajectories of stars, specters, and crystalline struc- tures are captured by photography in an indirect way. Photography shows us the behavior of ants and children, and even with audio recordings we are being acquainted through visualization. Where static photography is not suffi cient, cinema jumps into the fray. A fl eeting comparison between older and more recent research will teach us about this expansion of the visual protocol, with recording machines taking the place of manual entries. However, it is not only protocols that are using visual devices; the representation of results also increasingly uses them. Pedagogy seeks to invigorate the students’ activity not least by sub- jecting simple observations or scientifi c results to analysis, which in some cases may also include the combination of new forms. Especially since Comenius’s Orbis Pictus the problem of how to 1 “Bildstatistik nach Wiener Methode,” Die Volksschule 27, no. 12 (1931): 569–79. 108 © 2017 arTMargins and the Massachusetts institute of Technology doi:10.1162/arTM_a_00169 spread enlightenment with the help of methods of visualization has been treated again and again. The drawing and the image are being joined by the model. We won’t be able to show successfully how gradually a system emerges from the depiction of individual things and assorted oddities until we have fur- ther developed our means of visual representation. -

Grafická Tvorba Augustina Tschinkela V Kontextu Moderního Designu
Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění Eliška Kapounová (DU-OT, bakalářské kombinované studium) Grafická tvorba Augustina Tschinkela v kontextu moderního designu (1928 – 1940) (bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce: PhDr. Alena Pomajzlová, PhD. Praha 2009 Děkuji paní doktorce Pomajzlové za vedení mé bakalářské práce. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci napsala samostatně a uvedla všechny použité zdroje. V Praze dne 15. dubna 2009 Eliška Kapounová 2 Obsah Úvod .................................................................................................................................................. 4 1. Kolínští progresivní umělci (Die Gruppe progressiver Künstler) ........................................ 6 2. Sociální grafika v tvorbě Augustina Tschinkela ................................................................... 10 3. Otto Neurath a vídeňská metoda obrazové statistiky ......................................................... 15 4. ISOTYPE ..................................................................................................................................... 18 5. Historie zobrazování statistických dat ................................................................................... 20 6. Grafické oddělení muzea ve Vídni ......................................................................................... 22 7. Jako průkopník obrazové statistiky ........................................................................................ 25 8. Malá vlastivěda (1935) ............................................................................................................. -

Collection 1880S–1940S, Floor 5 Checklist
The Museum of Modern Art Fifth Floor, 1880s-1940s 5th Fl: 500, Constantin Brancusi Constantin Brâncuși Bird in Space 1928 Bronze 54 x 8 1/2 x 6 1/2" (137.2 x 21.6 x 16.5 cm) Given anonymously 153.1934 Fall 19 - No restriction Constantin Brâncuși Fish Paris 1930 Blue-gray marble 21 x 71 x 5 1/2" (53.3 x 180.3 x 14 cm), on three-part pedestal of one marble 5 1/8" (13 cm) high, and two limestone cylinders 13" (33 cm) high and 11" (27.9 cm) high x 32 1/8" (81.5 cm) diameter at widest point Acquired through the Lillie P. Bliss Bequest (by exchange) 695.1949.a-d Fall 19 - No restriction Constantin Brâncuși Mlle Pogany version I, 1913 (after a marble of 1912) Bronze with black patina 17 1/4 x 8 1/2 x 12 1/2" (43.8 x 21.5 x 31.7 cm), on limestone base 5 3/4 x 6 1/8 x 7 3/8" (14.6 x 15.6 x 18.7 cm) 17 1/4 × 8 1/2 × 12 1/2" (43.8 × 21.6 × 31.8 cm) Other (bronze): 17 1/4 × 8 1/2 × 12 1/2" (43.8 × 21.6 × 31.8 cm) 5 3/4 × 6 1/8 × 7 3/8" (14.6 × 15.6 × 18.7 cm) Other (approx. weight): 40 lb. (18.1 kg) Acquired through the Lillie P. Bliss Bequest (by exchange) 2.1953 Fall 19 - No restriction Constantin Brâncuși Maiastra 1910-12 White marble 22" (55.9 cm) high, on three-part limestone pedestal 70" (177.8 cm) high, of which the middle section is Double Caryatid, c. -

Actually, the Dead Are Not Dead: Una Forma De Ser October 17, 2020 – July 11, 2021
Actually, the Dead Are Not Dead: Una forma de ser October 17, 2020 – July 11, 2021 Gerd Arntz, Daniel Baker, Canciones de la guerra social contemporánea, Joy Charpentier, Ines Doujak, El Solitario / Francisco Lameyer, Toto Estirado, Flo6x8, Robert Gabris, María García Ruiz, Gonzalo García-Pelayo, Israel Galván, Tony Gatlif, Helios Gómez, Francisco de Goya, Isaias Griñolo, Julio Jara, Hiwa K, Teresa Lanceta, Darcy Lange / Maria Snijders, Delaine Le Bas, Los Putrefactos, Máquinas de vivir, Ocaña, Otto Pankok, PEROU, Ragel, Pedro G. Romero, August Sander, Franz W. Seiwert, SEM/EN, Stalker, Ceija Stojka, Mario Maya y Teatro Gitano Andaluz, Luca Vitone, Rosario Weiss et al. Curators: María García Ruiz and Pedro G. Romero Contents Short Introduction.………………………………………………………………………………………………………………..3 Introduction……………….………………………………………………………………………...……………………………….4 The Curators………………………………………………………………………………………………………………………….6 Works in the Exhibition..……………………………………………………………………………………………………..….7 Wording………………………………………………………………………………………………………………………….……31 The Stuttgart Vagabond Congress………………………………………………………………………………………….33 Bergen Assembly 2019: Actually, the Dead Are Not Dead…………………………………………………..…...38 Dates and Credits………………………………………………………………………………………………………………....40 Events……………………………………………………………………………………………………………………….…………41 2 Short Introduction The exhibition Actually, the Dead Are Not Dead: Una forma de ser (A Form of Being or Life) deals with the relations between the festival and the field of the political. It examines the feast as a social and collective stage of emancipation and self-determination, and it explores the aesthetic and poetic forms that have emerged from this since the nineteenth century, especially in the environment of the subcultures of the Rom*nja, Flamencos, and Bohèmes. The festival as an aesthetic framework for the reversal of social relations (carnival) and the interpenetration of exuberance and rebellion, folklore and avant-garde, is explored not only historically, but especially in relation to the present. -

Index Figures in Bold Refer to the Biographies and / Or Illustrations A
Index Figures in bold refer to the biographies Kenneth Arrow 406 Beau 87 and / or illustrations H.C. Artmann 418, 481,481 Gottfried Bechtold 190, 221,356, 362, Boris Arvatov 61 362, 418, 498, 499, W.R. Ashby 328 499 a Michael Atiyah 255 Johannes R. Becker 58 Karl Abraham 522, 523, 528, 530- Carl Aub6ck 68 Konrad Becker 294, 364, 364 532 Augustine 209 Otto Beckmann 294, 357, 357, 546, Raimund Abraham 546, 574, 575, 574, Amadeo Avogadro 162 580 575 R. Axelrod 408 Richard Beer-Hoffmann 448 Antal Abt 241 Alfred Julius Ayer 456 Adolf Behne 67 Friedrich Achleitner 418, 481,481,483, Peter Behrens 66 484, 485, 488, 570 b L~szl6 Beke 504 J~nos Acz~l 251 Johannes Baader 59 Man6 Beke 245 Andor Adam 61 Baader-Meinhof group 577 GySrgy von B~k~sy 32, 122, 418, 431, Alfred Adler 66, 518, 521,521, Mihaly Babits 513 433, 433, 434 529, 533 G~bor Bachman 546, 559, 559, 560, John Bell 189, 212-217, 218 Bruno Adler 71 561 Therese Benedek 522 Raissa Adler 521 Ernst Bachrich 67 Tibor Benedek 522 Theodor W. Adorno 26, 142, 402, 447, Ron Baecker 343 Otto Benesch 473 478 Roger Bacon 185 Walter Benjamin 70, 476 Marc Adrian 106, 106, 142, 146, Alexander Bain 352 Gottfried Benn 589 148, 148, 355 BEla Bal&sz 66, 84, 338-341, 418, Max Bense 108 Robert Adrian X 363,363 444-447,446, 44 7, Jeremy Bentham 405 Endre Ady 442, 444 449-454, 513, 529 Vittorio Benussi 23-26, 24, 25, 29 August Aichhorn 521,524, 527, 528 Nandor Balasz 238 Sophie Benz 525 Howard Aiken 323 Alice B~lint 514, 515, 517-519, Bal&zs BeSthy 418, 504, 505, 504, Alciphon 166 521,521,522 505 Josef Albers 123 Mihaly Balint 513-516, 518, 522, (:tienne BEothy 55, 57, 69, 368, 384, David Albert 188 522 385, 384-386 Leon Battista Alberti 166, 354 Hugo Ball 525 Anna B~othy-Steiner 55, 384 Bernhard Alexander 521 Giacomo Balla 19,41 Gyula Benczur 71 Franz Gabriel Alexander 521,522 Richard Baltzer 242 Max Benirschke 38 J.W. -

Isotype: Representing Social Facts Pictorially
Isotype representing social facts pictorially Christopher Burke (Paper given at the conference ‘Data Designed For Decisions’, OECD, Paris, June 2009) Keywords: Isotype, Otto Neurath, pictograms, strong emphasis on cultural and educational projects, symbols, transformer, visual communication, graphic hence the generous funding for the Gesellschafts- und design, Red Vienna, decision making, economics Wirtschaftsmuseum. It was not what one usually thinks of as a museum. In developing Isotype, Otto Neurath and his In his opening statements about it Neurath declared colleagues were the first to systematically explore a that it was not a treasure chest of rare objects, but a consistent visual language as part of an encyclopedic teaching museum. The aim was to ‘represent social approach to representing all aspects of the physical facts pictorially’ (Neurath, 1926) and to bring ‘dead world. The pictograms used in Isotype have a statistics’ to life by making them visually attractive and secure legacy in today’s public information symbols, memorable (Neurath, 1925, p.5). In order to do this the but Isotype was more than this: it was designed museum also innovated with interactive models and to communicate social facts memorably to less- other attention-grabbing devices, such as metal maps educated groups, including schoolchildren and covered with magnetic symbols, and there were even workers, reflecting its initial testing ground in the some early experiments with animated films. socialist municipality of Vienna during the 1920s. The areas of society that were represented make clear The social engagement and methodology of Isotype how embedded the museum’s work was in the context are examined here in order to draw some lessons for of Red Vienna. -

Klimt Is T Nicht Das Ende
Mitteleuropa Aufbruch in in Aufbruch ENDE DAS DAS NICHT IST KLIMT KLIMT IST NICHT DAS ENDE Bedeutet der Tod von Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser Austausch und stehen im Widerspruch zu den politischen und und Otto Wagner 1918 für die Kunst in den Ländern der ehemaligen ideologischen Grenzziehungen. Gemeinschaft stiften beispielsweise Donaumonarchie einen Epochenbruch? Welche neuen Wege Künstler gruppen, Zeitschriften wie MA, die Internationale Ausstellung sind schon vor 1914 und in der Kriegszeit erkennbar? Wie wirken neuer Theatertechnik in Wien oder Schulen wie das Bauhaus in sich die neuen Nationalstaaten auf die gemeinsamen Interessen Weimar. Die Gewalt der Diktaturen, die zum Zweiten Weltkrieg führt, der Künstlerinnen und Künstler aus, und wie reagieren diese darauf? beendet 1938 diese schöpferisch reiche Zeit und verschattet das Denn die progressiven künstlerischen Entwicklungen suchen den Verständnis der kulturellen Gemeinsamkeiten. KLIMT IST NICHT DAS ENDE Gustav Klimt Der goldene Ritter, 1903 Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoya Aufbruch in KLIMT Mitteleuropa IST NICHT DAS ENDE Inhalt ∙ Vorwort 6 ∙ Der Zerfall der Habsburgermonarchie und seine Auswirkungen Arnold Suppan 8 in der Zwischenkriegszeit A KREATIVE VIELFALT. PLURALISMUS 1914–18 ∙ Gustav Klimts letzte Schaffensjahre und seine Beziehung Franz Smola 24 zur jungen Avantgarde in Wien ∙ Auf der Suche nach einer Tradition der Zukunft. Markéta Theinhardt 34 Anmerkungen zu einigen tschechischen Künstlern — von Preisler zu Filla ∙ Über Rippl-Rónai hinaus. Gergely Barki 40 Expressionistische Tendenzen in der ungarischen Kunst ∙ „Alle streben sie aber hinaus.“ Stephanie Auer 48 Der Zusammenbruch der Donaumonarchie und seine Auswirkungen auf den österreichischen Expressionismus ▪ Tafelteil 58 B VOM HURRA ZUM LEICHENFELD. KRIEG UND ERNÜCHTERUNG ∙ Dokumentation und Propaganda. -

Animationskomponenten in Isotype Infografiken Und Ihr Einfluss Auf Die Informationsverarbeitung
Animationskomponenten in Isotype Infografiken und ihr Einfluss auf die Informationsverarbeitung Diplomarbeit Ausgeführt zum Zweck der Erlangung des akademischen Grades Dipl.-Ing. für technisch-wissenschaftliche Berufe am Masterstudiengang Digitale Medientechnologien an der Fachhochschule St. Pölten, Masterklasse Grafik Design von: Corinna Gerhold, BA dm171530 Betreuer/in und Erstbegutachter/in: Mag. Jochen Elias Zweitbegutachter/in: Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Aigner, M.Sc. [Wien, 18.05.2020] I Ehrenwörtliche Erklärung Ich versichere, dass - ich diese Arbeit selbständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe. - ich dieses Thema bisher weder im Inland noch im Ausland einem Begutachter/einer Begutachterin zur Beurteilung oder in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe. Diese Arbeit stimmt mit der vom Begutachter bzw. der Begutachterin beurteilten Arbeit überein. Wien, am 18.05.2020 ................................................ Ort, Datum Unterschrift II Kurzfassung In dieser Arbeit geht es um den Vergleich von animierten und nicht animierten Isotype Infografiken. Isotype Infografiken sind Infografiken, die den von Otto Neurath und seinem Team in den 1920-er und 1930-er Jahren entwickelten Gestaltungsregeln folgen. Es handelt sich um Infografiken, die hauptsächlich aus Piktogrammen bestehen. Isotype war gleichzeitig auch eine Bildsprache und eine Designphilosophie. Animation wurde schon von Neurath im Zusammenhang mit Isotype verwendet, weswegen im Rahmen dieser Arbeit mittels eines A/B-Tests getestet wurde, ob Animation die Wirkung der Infografik auf das Publikum beeinflusst. Die Hypothese, dass Animationen dem Publikum helfen, die Inhalte der Infografik besser zu verstehen, wurde nicht verifiziert. III Abstract This thesis is about the comparison of animated and non-animated Isotype infographics.