Animationskomponenten in Isotype Infografiken Und Ihr Einfluss Auf Die Informationsverarbeitung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Vienna Method in Amsterdam: Peter Alma's Office for Pictorial Statistics Benjamin Benus, Wim Jansen
The Vienna Method in Amsterdam: Peter Alma’s Office for Pictorial Statistics Benjamin Benus, Wim Jansen The Dutch artist and designer, Peter Alma (see Figure 1), is today remembered for his 1939 Amstel Station murals, as well as for Downloaded from http://direct.mit.edu/desi/article-pdf/32/2/19/1715594/desi_a_00379.pdf by guest on 24 September 2021 his earlier involvement with the Cologne-based Gruppe progres- siver Künstler [Progressive Artists’ Group]. Yet Alma also pro- duced an extensive body of information graphics over the course of the 1930s. Working first in Vienna at the Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum [Social and Economic Museum] (GWM) and later setting up an independent design firm in Amsterdam, Alma became one of the principal Dutch practitioners and promoters of the design approach known as the “Vienna Method of Picto- rial Statistics.” To date, most accounts of this method’s history have focused on its chief inventor, Austrian social scientist Otto Figure 1 Neurath, and his principal collaborators, Germans Marie Neurath August Sander, photograph of Peter Alma, (née Reidemeister) and Gerd Arntz.1 Yet Alma’s work in pictorial late 1920s. Private collection. Reproduced by permission from Sinja L. Alma and statistics also constitutes a substantial chapter in this history, Peter L. Alma. although it has not yet been fully appreciated or adequately docu- mented.2 In addition to providing an account of Alma’s role in the 1 For a detailed history of the Vienna development and dissemination of the Vienna Method, this essay Method, see Christopher Burke, Eric assesses the nature of Alma’s contribution to the field of informa- Kindel, and Sue Walker, eds., Isotype: tion design and considers the place of his pictorial statistics work Design and Contexts, 1925–1971 within his larger oeuvre. -
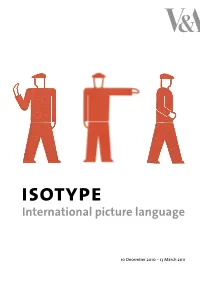
Gallery Guide 7
���������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������� isotype International picture language 10 December 2010 – 13 March 2011 isotype Society and economy (International System Of TYpographic Picture Education) was a method for assembling, configuring and disseminating Isotype was forged in the optimism of the first Austrian information and statistics through pictorial means. Republic. It was developed from 1924 at the Social and Economic Museum of Vienna, where it was first called the Its initiator, Otto Neurath, described it as a ‘language-like Vienna Method of Pictorial Statistics. technique’ characterised by consistency in the use of graphic elements. The basic elements are pictograms – simplified The Social and Economic Museum was funded by the Social pictures of people or things, designed to function as repeat- Democratic municipality of Vienna and shared its socialist able units. agenda. It was not what is usually thought of as a museum: its director Otto Neurath stated that instead of a treasure From its beginnings in Vienna of the 1920s, Isotype spread to chest of rare objects, it should be a teaching museum. The the Netherlands, Britain, the Soviet Union, the United States principal exhibits were charts made with the Vienna Method and elsewhere. Its potential for communicating with people in order to ‘represent social facts pictorially’, as a way of of all ages and nationalities was explored in a wide range of Chart from Gesellschaft communicating with both young people and adults. projects and publications through the 1960s. und Wirtschaft (Society The museum had a global-historical outlook, which it The story of Isotype presents a case study of the Modern and Economy). 1930. -

University of Groningen Neurath, Arntz, and ISOTYPE Jansen
University of Groningen Neurath, Arntz, and ISOTYPE Jansen, Wim Published in: Journal of Design History DOI: 10.1093/jdh/epp015 IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Publication date: 2009 Link to publication in University of Groningen/UMCG research database Citation for published version (APA): Jansen, W. (2009). Neurath, Arntz, and ISOTYPE: The Legacy in Art, Design, and Statistics. Journal of Design History, 22(3), 227-242. https://doi.org/10.1093/jdh/epp015 Copyright Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Take-down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum. Download date: 25-09-2021 Journal of Design History Vol. 22 No. 3 doi:10.1093/jdh/epp015 Neurath, Arntz and ISOTYPE: The Legacy in Art, Design and Statistics Wim Jansen To remember simplifi ed pictures is better than to forget accurate fi gures. 1 In the fi rst decades of the twentieth century, Otto Neurath and Gerd Arntz invented the ‘ Vienna Method of Pictorial Statistics ’ (Wiener Bildstatistik). -

OTTO NEURATH Mo
Weitere Angebote Öffnungszeiten OTTO NEURATH Mo. – Do.: 8.00 – 18.00 Uhr Wirtschaftslehrpfad Fr.: 8.00 – 14.00 Uhr SPRECHENDE ZEICHEN Aktuelle Informationen aus Wirtschaft und Gesellschaft werden anschaulich und leicht verständlich dargestellt. Kein Besucher/-innen-Betrieb während der Wiener Schulferien Computer- und Medienraum und an Feiertagen. 40 iMacs mit interaktiven Multimedia-Programmen und Internetanschluss stehen für Sie bereit. Gruppenführungen und Seminare Gruppenführungen und Seminare sind ab zehn 100 Jahre Leben und Wohnen in Wien Personen nach tele foni scher Vereinbarung Besucher/-innen haben die Möglichkeit, Lebens- und jederzeit möglich. Wohnverhältnisse sinnlich nachzuempfinden. Eintritt LÖWE – Lernwerkstatt Österreichs € 2,50 pro Person Wirtschaft Elementar Führungsgebühr für Gruppen: Schüler/-innen von 9 bis 12 Jahren werden hier altersgerecht € 2,50 pro Person Begriffe der Wirtschaft vermittelt. Dr. Carl Auer von Welsbach-Erlebnisausstellung Anhand von anschaulichen Exponaten und Experimenten wird das Schaffen eines der größten Genies Österreichs „beleuchtet“. Galerie der Sammler/-innen In diesem Ausstellungsforum zeigen private Sammler/-innen im Halbjahresrhythmus ihre „Schätze“. Wanderausstellungen an Schulen Referent(en)innen informieren im Rahmen von Vortragsveran- staltungen junge Menschen in Schulen in ganz Österreich. Otto Neuraths Bildunterschrift österreichisches gesellschafts- und wirtschaftsmuseum vogelsanggasse 36 | 1050 wien tel +43(0)1-545 25 51 www.wirtschaftsmuseum.at [email protected] @Wirtschaftsmuseum Wirtschaftsmuseum_Wien Eine Ausstellung im (@wirtschaftsmuseum) Indoor | Otto Neurath – Sprechende Zeichen Was man mit einem Bild zeigen kann, OTTO NEURATH 1882 – 1945 muss man nicht mit Worten sagen. SOZIOLOGE, ÖKONOM, VOLKSBILDNER, UNIVERSALGENIE Piktogramme im Wandel der Zeit VOM ZUNFTZEICHEN Otto Neurath wird am 10. Dezember 1882 in Wien geboren. Schon als Kind interessiert er sich in der Bibliothek seines Vaters, ZUM LEITSYSTEM ein Wirtschaftswissenschafter, für bildliche Darstellungen. -

Isotype: Representing Social Facts Pictorially
Isotype representing social facts pictorially Christopher Burke (Paper given at the conference ‘Data Designed For Decisions’, OECD, Paris, June 2009) Keywords: Isotype, Otto Neurath, pictograms, strong emphasis on cultural and educational projects, symbols, transformer, visual communication, graphic hence the generous funding for the Gesellschafts- und design, Red Vienna, decision making, economics Wirtschaftsmuseum. It was not what one usually thinks of as a museum. In developing Isotype, Otto Neurath and his In his opening statements about it Neurath declared colleagues were the first to systematically explore a that it was not a treasure chest of rare objects, but a consistent visual language as part of an encyclopedic teaching museum. The aim was to ‘represent social approach to representing all aspects of the physical facts pictorially’ (Neurath, 1926) and to bring ‘dead world. The pictograms used in Isotype have a statistics’ to life by making them visually attractive and secure legacy in today’s public information symbols, memorable (Neurath, 1925, p.5). In order to do this the but Isotype was more than this: it was designed museum also innovated with interactive models and to communicate social facts memorably to less- other attention-grabbing devices, such as metal maps educated groups, including schoolchildren and covered with magnetic symbols, and there were even workers, reflecting its initial testing ground in the some early experiments with animated films. socialist municipality of Vienna during the 1920s. The areas of society that were represented make clear The social engagement and methodology of Isotype how embedded the museum’s work was in the context are examined here in order to draw some lessons for of Red Vienna. -

O'neill, Jesse. “Book Review – Isotype: Design and Contexts 1925–1971”
Page !1 of !4 O’Neill, Jesse. “Book Review – Isotype: Design and Contexts 1925–1971”, Architectural Theory Review 19:2 (2014), pp. 259–262. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13264826.2014.968954 ISSN 1326-4826 Christopher Burke, Eric Kindel and Sue Walker (eds.), Isotype: Design and Contexts 1925–1971, London: Hyphen, 2013. ISBN 978-0-907259-47-3 Reviewed by Jesse O'Neill After returning to Vienna in the early 1920s, the social scientist Otto Neurath established the Museum for Settlement and Town Planning, a small organization intent on guiding the citizen- led building campaign then taking place on the outskirts of the city. In 1925 the institute became the Museum for Society and Economy, reflecting Neurath’s growing ambitions. He began by organizing exhibits on urban life in Vienna, its physical and human infrastructures, social insurance, and hygiene. By the end of his life, Neurath had compiled educational material on merchant navies, unemployment, life in India, women’s underwear, shoe production in the USSR, war-time recycling, and many other topics loosely classified under the catch-all terms, society and economy. Driving this production was Neurath’s consolidation of a new approach to visual display, first known as the Vienna Method of Pictorial Statistics, and now remembered for its later title Isotype, the International System of Typographic Picture Education. A product of 1920s central European thought, Isotype is imprinted with three major influences: post-war utopianism, logical positivism, and the internationalist drive of the political Left. Through their work, Neurath and his collaborators – chiefly the mathematician Marie Reidemeister (later Marie Neurath) and illustrator Gerd Arntz – were constructing a system of universal graphic principles. -

Otto Neurath, Isotype Picture Language and Its Reflections on Recent Design
The Online Journal of Communication and Media – July 2015 Volume 1, Issue 3 OTTO NEURATH, ISOTYPE PICTURE LANGUAGE AND ITS REFLECTIONS ON RECENT DESIGN Banu İnanç Uyan Dur TOBB University of Economics & Technology, Faculty of Fine Arts Design & Architecture, Department of Visual Communication Design, Ankara / Turkey [email protected] Abstract: Sign systems, consist of symbols and pictograms, has a great role in rapidly developing recent technological systems, complicating city life, mutually understanding of people from different cultures and languages. Signs, symbols and pictograms, which are having functions like informing, directing and forming a vernacular, have the aim of providing an universal communication that can be understand by all people despite the language, culture and religion differences. Otto Neurath's ISOTYPE picture language, which is trying to form "a wordless global language", is an important milestone while considering much rapid and effective communication need and the process about developing an easy and universal visual communication system without any needs of words. The aim of this graphic language, which is formed with simple pictograms, is to communicate easily without any needs of knowing any language with removing the borders between cultures and languages. Simple pictograms system, used by Otto Neurath in ISOTYPE, is pioneering the modern data visulization and information graphics as presenting the complicated statistical data in simple graphic forms. Pictograms and data visualizations, prepared by Otto Neurath in social, political, economical, healthcare and education topics are the first ones in this field and also directing more than effecting the pictograms, data visualizations and information graphics in recent visual communication design scope. -

1. Introduction: the Vienna Circle, Carnap and Neurath
doi: 10.5007/1808-1711.2013v17n2p319 THE UTOPIAOF UNIFIED SCIENCE: THE POLITICAL STRUGGLEOF OTTO NEURATH ANDTHE VIENNA CIRCLE IVAN FERREIRA DA CUNHA Abstract. Neurath’s approach to the problem of the unity of science is different from con- ceptions we may call traditional, to know, those that consider that what unites in one single concept the diverse sciences is the adoption of a method, or those that defend that this is carried through by certain characteristics which can be found in the body of knowledge considered scientific. Neurath’s stance also diverges from the standpoint that there is no unifying factor for science, that is, the view that the different sciences are only classified under such concept because of the historical origin of such activities. Neurath’s proposal is to consider science as an attitude, a posture in relation to the problems of the world, the scientific world-conception. This text presents such approach in connection to the aspect of social transformation that can be found in Neurath’s thought. This is done following a comprehension of the ideas of the Vienna Circle, seeking to understand a continuity among the ideas of the members of such group, especially Neurath and Carnap. The present text aims, as well, at recovering the Neurathian idea that we can use a philosophical approach to science to struggle against the problems of the world. Keywords: Unity of science; Neurath; Vienna Circle; philosophy of social sciences; encyclo- pedism. 1. Introduction: the Vienna Circle, Carnap and Neurath This text aims at discussing Neurath’s approach to the problem of the unity of sci- ence. -

Und Städtebau Das Gesellschafts- Und Wirt- Schaftsmuseum in Wien Hervor
GESELLSCHAFTS- UND WIRTSCHAFTSMUSEUM EIN NEUER ORT 1925 ging aus dem Museum für Siedlungs- und Städtebau das Gesellschafts- und Wirt- schaftsmuseum in Wien hervor. Otto Neurath, der Leiter eines Teams von Grafiker- Innen und WissenschaftlerInnen, bezeichnete die neue Institution als ein „sinnliches und klares“ „Lehrmuseum“. Weder seltene Objekte noch wertvolle Sonderbarkeiten sollten hier im Mittelpunkt stehen, sondern empirisches Wissen, das mit neuen Methoden visualisiert werden würde. Die BesucherInnen wurden von der Vergangenheit durch die globale Wirtschafts- und Sozialgeschichte in die Zukunft geführt. Kulturtechniken und Wirtschaftsepochen unterschieden nach Produktionsformen gliederten die Ausstellungen. Neuraths Team war an mehreren Orten in Wien tätig, sowohl in einem Gemeindebau (Fuchsenfeldhof) als auch am Parkring wurden Ausstellungen gemacht. International arbeitete man mit Institutionen in Deutschland, Russland, England und Holland zu- sammen. Das Museum wurde im Austrofaschismus und im Nationalsozialismus unter anderem Namen weitergeführt, bildstatistische Innovationen in Form von bildungs- und demokratiepolitischen Projekten gingen aber 1934 von Neurath selbst und ehemaligen MitarbeiterInnen in England und den USA aus. Die Ausstellung gibt einen kurzen Über- blick über die leitenden Ideen der statistischen Bildsprache ISOTYPE. In 1925, the Museum of Settlement and Urban Development was transformed into the Social and Economic Museum. Otto Neurath, head of a team of graphic artists and scientists, described the new institution as a „visual and lucid“ „museum of learning“. Neither rare objects nor valuable peculiarities would be shown there, but instead empirical knowledge should be visualized with new methods. Visitors were led from the past into the future through a global history of economies and societies. The exhibition was organized according to economic eras, differentiated by forms of production. -

The Linguistic Status of Isotype
The Linguistic Status of Isotype Christopher Burke, Reading In a thorough study titled ‘Neurath’s theory of pictorial-statistical represen- tation’ (published over twenty years ago in Rediscovering the forgotten Vienna Circle) Karl Müller concluded that Otto Neurath never explicitly developed such a theory and questioned Neurath’s claim that Isotype was a language, due to the weakness of evidence for this. In implicit agreement with Müller’s analysis, this essay will draw on Neurath’s correspondence and his ‘visual autobiography’ to show that he deliberately did not develop a theory of picture language, or even fully articulate a method, on the principle that it was too early in the history of visual education to make such definite statements. He also felt that such theorizing would restrict possible, future applications of Isotype. There are some contradictions in the way Otto Neurath discussed Isotype, as perhaps there were in other areas of his work; Thomas Uebel has described him succinctly as ‘a very contrapuntal writer’.1 It seems almost to have been a principle of Neurath’s to be self-contradictory (or at least equivocal). In his 1942 essay ‘International planning for freedom’ he quoted Conrad Meyer: ‘I am not a wittily constructed work of fiction; I am a human being and full of contradiction.’ 2 Neurath’s habit of undermining certainty causes some difficulties of interpretation. He made statements claiming that Isotype was a kind of language, which should be in widespread use, yet he also admitted that it could never be a real language and he wanted to keep close control of how it was produced. -

The Role of Information Design
Effective antimicrobial resistance communication: the role of information design Article Published Version Creative Commons: Attribution 4.0 (CC-BY) Open Access Walker, S. (2019) Effective antimicrobial resistance communication: the role of information design. Palgrave Communcations, 5. 24. ISSN 2055-1045 doi: https://doi.org/10.1057/s41599-019-0231-z Available at http://centaur.reading.ac.uk/81906/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . To link to this article DOI: http://dx.doi.org/10.1057/s41599-019-0231-z Publisher: Nature All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online ARTICLE https://doi.org/10.1057/s41599-019-0231-z OPEN Effective antimicrobial resistance communication: the role of information design Sue Walker 1 ABSTRACT Getting the message across about the dangers of antimicrobial resistance (AMR) and how to prevent it is a global priority. This article discusses the role of information design in the effective communication of information about AMR, and suggests that the 1234567890():,; design process—user input, iteration and consideration of circumstances of use—is key to successful communication. To illustrate this, using material from the Otto and Marie Neurath Isotype Collection at the University of Reading, this article considers the work of Otto and Marie Neurath who developed the Isotype system for visual education in the 1920s. -

Interwar Experiments in Language
CALL: Irish Journal for Culture, Arts, Literature and Language Volume 2 Issue 1 The Cultures of Popular Culture Article 12 2017 Writing in the Language of Reality: Interwar Experiments in Language Robin Fuller Trinity College Dublin, [email protected] Follow this and additional works at: https://arrow.tudublin.ie/priamls Part of the Arts and Humanities Commons Recommended Citation Fuller, Robin (2017) "Writing in the Language of Reality: Interwar Experiments in Language," CALL: Irish Journal for Culture, Arts, Literature and Language: Vol. 2: Iss. 1, Article 12. doi:10.21427/D7GT4B Available at: https://arrow.tudublin.ie/priamls/vol2/iss1/12 This Article is brought to you for free and open access by the Ceased publication at ARROW@TU Dublin. It has been accepted for inclusion in CALL: Irish Journal for Culture, Arts, Literature and Language by an authorized administrator of ARROW@TU Dublin. For more information, please contact [email protected], [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License Fuller: Writing in the Language of Reality: Interwar Experiments in Langu Writing in the Language of Reality: Interwar Experiments in Language Robin Fuller School of Languages, Literatures and Cultural Studies Trinity College Dublin, Ireland [email protected] Abstract This paper examines projects in universal communication from the interwar period, including Charles Kay Ogden’s Basic English, Otto Neurath’s Isotype, and László Moholy-Nagy’s typo-photo. The projects under discussion — experiments in language reform, graphic design and photography — were all born from a dissatisfaction with the imprecise, arbitrary and historically-contingent nature of established languages and semiotic systems.