Universität Augsburg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

61574447.Pdf
Title Towards a regional understanding of Irish traditional music Author(s) Kearney, David Publication date 2009-09 Original citation Kearney, D. 2009. Towards a regional understanding of Irish traditional music. PhD Thesis, University College Cork. Type of publication Doctoral thesis Link to publisher's http://library.ucc.ie/record=b1985733~S0 version Access to the full text of the published version may require a subscription. Rights © 2009, David Kearney http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Item downloaded http://hdl.handle.net/10468/977 from Downloaded on 2017-02-12T14:09:41Z Towards a regional understanding of Irish traditional music David Kearney, B.A., H.Dip. Ed. Thesis presented for the award of Doctor of Philosophy (Ph.D.) National University of Ireland, Cork Supervisors: Professor Patrick O’Flanagan, Department of Geography Mel Mercier, Department of Music September 2009 Submitted to National University of Ireland, Cork 1 Abstract The geography of Irish traditional music is a complex, popular and largely unexplored element of the narrative of the tradition. Geographical concepts such as the region are recurrent in the discourse of Irish traditional music but regions and their processes are, for the most part, blurred or misunderstood. This thesis explores the geographical approach to the study of Irish traditional music focusing on the concept of the region and, in particular, the role of memory in the construction and diffusion of regional identities. This is a tripartite study considering people, place and music. Each of these elements impacts on our experience of the other. All societies have created music. Music is often associated with or derived from places. -
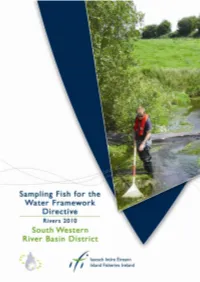
Table of Contents
The Central and Regional Fisheries Boards ACKNOWLEDGEMENTS The authors wish to gratefully acknowledge the help and co-operation of the regional director Dr. Pat Buck and staff from IFI Macroom as well as various other offices throughout the region. The authors also gratefully acknowledge the help and cooperation of colleagues in IFI Swords. We would like to thank the landowners and angling clubs that granted us access to their land and respective fisheries. Furthermore, the authors would like to acknowledge the funding provided for the project from the Department of Communications, Energy and Natural Resources for 2010. PROJECT STAFF Project Director/Senior Research officer: Dr. Fiona Kelly Project Manager: Dr. Andrew Harrison Research Officer: Dr. Ronan Matson Research Officer: Ms. Lynda Connor Technician Mr. Rory Feeney Technician: Ms. Emma Morrissey Technician: Ms. Róisín O’Callaghan Technician: Mrs. Ciara Wögerbauer Technician / Fisheries Assistant: Ms. Gráinne Hanna GIS Officer: Mr. Kieran Rocks Fisheries Assistant: Mr. Kevin Gallagher (Oct 2010 – Dec 2010) The report includes Ordnance Survey Ireland data reproduced under OSi Copyright Permit No. MP 007508. Unauthorised reproduction infringes Ordnance Survey Ireland and Government of Ireland copyright. © Ordnance Survey Ireland, 2010 ACKNOWLEDGEMENTS The authors wish to gratefully acknowledge the help and co-operation of the regional director Dr. Patrick Buck and staff from IFI Macroom as well as various other offices throughout the region. The authors also gratefully acknowledge the help and cooperation of colleagues in IFI Swords. We would like to thank the landowners and angling clubs that granted us access to their land and respective fisheries. Furthermore, the authors would like to acknowledge the funding provided for the project from the Department of Communications, Energy and Natural Resources for 2010. -
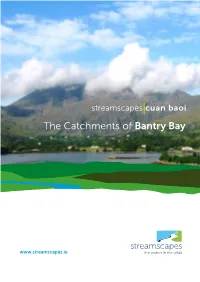
The Catchments of Bantry Bay
streamscapes cuan baoi The Catchments of Bantry Bay www.streamscapes.ie “To protect your rivers, protect your mountains.” - Emperor Yu (1600BC) Foreword: What is a Catchment? When you think of it, we all live in valleys, no matter how steep or broad, SAFETY FIRST!!! The ‘StreamScapes’ programme involves a hands-on survey of your local landscape and and all of our valleys have streams and rivers. From the hills above us to waterways...safety must always be the underlying concern. If you are undertaking aquatic survey, remember that all bodies of water are potentially dangerous places. the sea below, these watercourses make their way across our landscape and Slippery stones and banks, broken glass and other rubbish, polluted water courses which may host disease, poisonous plants, barbed wire in riparian zones, fast moving currents, misjudging the depth of water, cold temperatures...all of these are hazards to be minded! define the Catchment in which we live. Here a mountain stream runs If you and your group are planning a visit to a stream, river, canal, or lake for purposes of assessment, ensure that you have a good ratio of experienced and water-friendly adults swiftly and tumbles over waterfalls, there a wide river flows easily past to students, keep clear of danger, and insist on discipline and caution! green fields, through our communities and down to the sea. In that river, along its banks and into the surrounding landscapes, may be Welcome to StreamScapes, a dynamic environmental education programme for schools, community groups, and individual citizens. Undertaking a StreamScapes project will give you a deeper understanding of: found a wealth of biodiversity; fish, birds, insects, animals, trees, wild • How your local (rural or urban) catchment environment functions flowers, and people, but only if our waters run pure and clean. -

Site Synopsis
SITE SYNOPSIS SITE NAME: MULLAGHANISH TO MUSHERAMORE MOUNTAINS SPA SITE CODE: 004162 The Mullaghanish to Musheramore Mountains SPA comprises a substantial part of the Boggeragh/Derrynasaggart Mountains in Co. Cork. It is divided roughly into two sectors by the R582 road between Macroom and Millstreet. Most of the site is over 200 m in altitude, rising to heights of 475 m in the eastern sector (Musherabeg) and 462 m in the western sector (Knockullane). Several important rivers rise within the site, notably the Foherish and Awboy. The site is underlain by Old Red Sandstone. The site consists of a variety of upland habitats, though approximately one-third is afforested. The coniferous forests include first and second rotation plantations, with both pre-thicket and post-thicket stands present. The principal tree species present are Sitka Spruce (Picea sitchensis) and Lodgepole Pine (Pinus contorta). Almost one-third of the site is unplanted blanket bog and heath, with both wet and dry heaths present. The vegetation is characterised by such species as Ling Heather (Calluna vulgaris), Cross-leaved Heath (Erica tetralix), Bilberry (Vaccinium myrtillus), Common Cottongrass (Eriophorum angustifolium), Deergrass (Scirpus cespitosus) and Purple Moor-grass (Molinia caerulea). The remainder of the site is mostly rough grassland that is used for hill farming. This varies in composition and includes some wet areas with rushes (Juncus spp.) and some areas subject to scrub encroachment. The site is a Special Protection Area (SPA) under the E.U. Birds Directive, of special conservation interest for Hen Harrier. This site is a stronghold for Hen Harrier. A survey in 2005 recorded 5 pairs, which represents over 2% of the all-Ireland total. -

The 2015 National Survey of Breeding Hen Harrier in Ireland
ISSN 1393 – 6670 The 2015 National Survey of Breeding Hen Harrier in Ireland Irish Wildlife Manuals No. 93 The 2015 National Survey of Breeding Hen Harrier in Ireland Ruddock, M., Mee, A., Lusby, J., Nagle, T., O’Neill, S. & O’Toole, L. Golden Eagle Trust, Irish Raptor Study Group & BirdWatch Ireland Citation: Ruddock, M., Mee, A., Lusby, J., Nagle, A., O’Neill, S. & O’Toole, L. (2016). The 2015 National Survey of Breeding Hen Harrier in Ireland. Irish Wildlife Manuals, No. 93. National Parks and Wildlife Service, Department of the Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland. Keywords: Hen harrier, Circus cyaneus, Special Protection Area (SPA), national survey, population estimates, pressures, productivity, habitats Site list: 004160; 004161; 004162; 004165; 004167; 004168. Cover photo: © Marc Ruddock The NPWS Project Officer for this report was: David Tierney; [email protected] Irish Wildlife Manuals Series Editors: R. Jeffrey & F. Marnell © National Parks and Wildlife Service 2016 ISSN 1393 – 6670 Ireland Hen Harrier Survey 2015 ____________________________ Contents Contents .......................................................................................................................................................... i Executive Summary ...................................................................................................................................... iii Acknowledgements ..................................................................................................................................... -

Múscraí Gaeltacht Conservation, Management and Interpretation Plan
MÚSCRAÍ GAELTACHT CONSERVATION, MANAGEMENT AND INTERPRETATION PLAN PREPARED: DECEMBER, 2014 CLIENT: CORK COUNTY COUNCIL AND ACADAMH FÓDHLA RESEARCH + DIG Conservation/Heritage/Archaeology 1 Contents page 1.0 Introduction 3 2.0 Historical and archaeological profile 7 3.0 The natural heritage of the Múscraí Gaeltacht 17 4.0 Intangible heritage 26 5.0 Assessment of significance 37 2 1.0 Introduction 1.1 Background This Conservation Management and Interpretation Plan was commissioned by Cork County Council in conjunction with Acadamh Fódhla. The main aim of the project is to highlight the importance and heritage significance of the Múscraí Gaeltacht and to devise a number of heritage objectives and actions to ensure that the area is appropriately conserved, managed and maintained into the future. The word ‘Gaeltacht’ is used for areas where the Irish language is, or was until the recent past, the main spoken language. Gaeltacht areas are defined by Government order. One of them is Múscraí. 1.2 Site Identification and Profile Lying along the Cork / Kerry border, the Múscraí Gaeltacht is located 48kms to the west of Cork City (fig 1). Its population of 3,895 (CSO, 2011), represents 4% of the total number of Gaeltacht inhabitants. The Cork Gaeltacht encompasses a geographical area of 262km2. This amounts to 6% of the total Gaeltacht area. The largest settlements are the villages of Baile Mhic Íre/Baile Bhuirne and Béal Átha an Ghaorthaidh. Other significant settlements include Cúil Aodha, Réidh na nDoirí, and Cill na Martra. The landscape is dominated by numerous high craggy hills and the Derrynasaggart Mountains. -

The Central and Regional Fisheries Boards
The Central and Regional Fisheries Boards 1 The Central and Regional Fisheries Boards PROJECT PERSONNEL This report was written and researched by Dr. Fiona Kelly, Dr. Ronan Matson, Mr. Glen Wightman, Ms. Lynda Connor, Mr. Rory Feeney, Ms. Emma Morrissey, Ms. Róisín O’Callaghan, Ms. Gráinne Hanna, Mr. Kieran Rocks and Dr. Andrew Harrison, Central Fisheries Board, under the direction of Dr. Cathal Gallagher, Director of Research and Development as part of the Water Framework Directive Fish Surveillance Monitoring Programme, 2007 to 2009. ACKNOWLEDGEMENTS The authors wish to gratefully acknowledge the help and co-operation of the CEO, ACEO and staff from the South Western Regional Fisheries Board. The authors would also like to gratefully acknowledge the help and cooperation from all their colleagues in the Central Fisheries Board. Mr. Trevor Champ, Senior Research Officer with the Central Fisheries Board, who retired in November 2008, championed the use of fish communities in the ecological classification of rivers and lakes for the Water Framework Directive. He worked on the WFD programme since the 1990s and was heavily involved in guiding, implementing and acquiring funding for the programme and his hard work is sincerely acknowledged. We would also like to thank the landowners and angling clubs that granted us access to their land and respective fisheries. Furthermore the authors would also like to acknowledge the funding provided for the project from the Department of Communications Energy and Natural Resources (DCENR) for 2008. The report includes Ordnance Survey Ireland data reproduced under OSi Copyright Permit No. MP 007508. Unauthorised reproduction infringes Ordnance Survey Ireland and Government of Ireland copyright. -
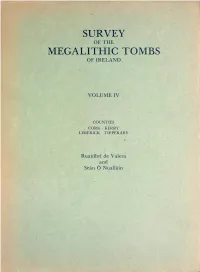
Survey Megalithic Tombs
SURVEY OF THE MEGALITHIC TOMBS OF IRELAND VOLUME IV COUNTIES CORK - KERRY LIMERICK - TIPPERARY Ruaidhri de Valera and Sean O Nuallain • The wedge-tomb, Keamcorravooly (Co. 24), from South. SURVEY OF THE MEGALITHIC TOMBS OF IRELAND Ruaidhri de Valera and Sean 6 Nuallain VOLUME IV COUNTIES CORK - KERRY LIMERICK - T1PPERARY DUBLIN PUBLISHED BY THE STATIONERY OFFICE 1982 To be purchased from th^ GOVERNMENT PUBLICATIONS SALES OFFICE, G-P.O. ARCADE, DUBLIN 1 or through any Bookseller. Price: &5' 00 S.0.179/81.133714.520.Sp.2/82.Mount Salus Press Limited. FOREWORD The untimely death of Professor Ruaidhri de Valera, on the 28th October 1978, brought to an end a fruitful association with the Ordnance Survey which had lasted for more than three decades. He was appointed Placenames Officer in the Ordnance Survey in February 1946, became Archaeology Officer the following year and served in the dual roles of Archaeology Officer and Senior Placenames Officer until he took up his appointment to the Chair of Celtic Archaeology in University College, Dublin in November 1957. Thereafter his connection with the Ordnance Survey was maintained through his constant collaboration in the production of this Survey of the Megalithic Tombs of Ireland. Ruaidhri de Valera's Celtic Studies training together with his love and understanding of the language and culture of Ireland fitted him well for the appointments he held at the Ordnance Survey and enabled him to revive and foster the traditions of scholarship established by his famous predecessors, O'Donovan, O'Curry and Petrie. Throughout his time here he was involved in research on Placenames and when the personnel of An Coimisiun Logainmneacha were attached to this Office it was under his guidance that the work was re-organised and set on its present successful course. -

Laune-Maine-Dingle Bay Catchment Assessment 2010- 2015 (HA 22)
Laune-Maine-Dingle Bay Catchment Assessment 2010- 2015 (HA 22) Catchment Science & Management Unit Environmental Protection Agency December 2018 Version no. 3 Preface This document provides a summary of the characterisation outcomes for the water resources of the Laune-Maine-Dingle Bay Catchment, which have been compiled and assessed by the EPA, with the assistance of local authorities and RPS consultants. The information presented includes status and risk categories of all water bodies, details on protected areas, significant issues, significant pressures, load reduction assessments, recommendations on future investigative assessments, areas for actions and environmental objectives. The characterisation assessments are based on information available to the end of 2015. Additional, more detailed characterisation information is available to public bodies on the EPA WFD Application via the EDEN portal, and more widely on the catchments.ie website. The purpose of this document is to provide an overview of the situation in the catchment and help inform further action and analysis of appropriate measures and management strategies. This document is supported by, and can be read in conjunction with, a series of other documents which provide explanations of the elements it contains: 1. An explanatory document setting out the full characterisation process, including water body, subcatchment and catchment characterisation. 2. The Final River Basin Management Plan, which can be accessed on: www.catchments.ie. 3. A published paper on Source Load Apportionment Modelling, which can be accessed at: http://www.jstor.org/stable/10.3318/bioe.2016.22 4. A published paper on the role of pathways in transferring nutrients to streams and the relevance to water quality management strategies, which can be accessed at: http://www.jstor.org/stable/pdf/10.3318/bioe.2016.19.pdf 5. -

Scottish Canoe Classics (Pesda Press)
Irish Canoe Classics Irishthirty-four Canoe great canoe Classics & kayak trips Eddie Palmer Tony Monaghan Tony Eddie Palmer & & Tony Monaghan 06 Lough Foyle Lower CITY OF DERRY Bann Cairnryan Londonderry Larne Stranraer BELFAST Donegal ULSTER 04 Lough BELFAST CITY Neagh Lower Donegal Bay 05 07 Lough Erne BELFAST INT. Strangford 09 Enniskillen Lough 02 11 SLIGO River Upper Lough Blackwater Erne 01 Lough 08 03 12 Lough Allen Conn KNOCK Carrick-on-Shannon 13 Dundalk Bay Sheelin Clew Bay Lough River River Boyne 29 31 Drogheda CONNAUGHTShannon Lough 30 Mask 14 10 Lough Ree Lough 28 DUBLIN Corrib Lough Royal Liverpool Athlone Ennell DUBLIN Canal 27 GALWAY Dun Laoghaire Grand Canal Shannon Harbour 26 Holyhead Galway Bay River Liffey River Shannon Lough Derg LEINSTER SHANNON River River Nore Barrow Kilkenny Limerick 24 25 Mouth of Cashel the Shannon 23 Carrick-on-Suir Fishguard 22River Wexford Suir Waterford Rosslare MUNSTER WATERFORD KERRY 15 Kilarney Dingle Bay Lough 20 Leane Cork CROSS IRELAND ROUTES CORK 17 Kenmore Bay Bantry 32 Dublin to Waterford 21 Swansea 16 33 Dublin to Limerick Bantry Bay 34 Dublin to Enniskillen 18 Baltimore 19RoaringwaterBay Irishthirty-four Canoe great canoe Classics & kayak trips Eddie Palmer & Tony Monaghan First published in Great Britain 2011 by Pesda Press Unit 22, Galeri Doc Victoria Caernarfon Gwynedd LL55 1SQ © Copyright 2011 Eddie Palmer & Tony Monaghan ISBN: 978-1-906095-13-0 The Authors assert the moral right to be identified as the authors of this work. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the Publisher. -

Conference Brochure the Mills
Conferences | Meetings | Events www.millsinn.ie Welcome to The Mills Inn Conference & Event Destination !The Mills Inn Hotel. The Ideal Hotel Conference Venue Location in beautiful West Cork. The Mills Inn Ballyvourney just outside Macroom, West Cork is the ideal venue for your conference, convention, corporate or showcase events lying halfway between Killarney and Cork City. It is in a very central location to both !Cork and Kerry Airports, with fantastic transport routes to Ballyvourney. The Mills Inn Hotel West Cork is set amidst very beautiful hills and forest countryside, on the banks of the Sullane River and at the foot of the Derrynasaggart Mountains. Whether your need is for a meeting of minds or a meeting of companies our choice of conference rooms is sure to provide you with the perfect setting in an idyllic location. • Superb Location • 3 Conference and Meeting Rooms • Flexible, effective working environment • 2 to 120 Delegates • Dedicated and experienced Management Team • Wheelchair Friendly • Complimentary Parking • The Mills Inn offers complimentary high speed • Flip Chart Stand wireless (wifi) broadband internet access • Projector throughout the hotel. • Conveniently positioned phone and power points • Natural daylight in all meeting rooms • Versatile computer network capability • Fantastic accommodation options • ‘Tool box’ - Paper, Pencils, Pens, paper clips, blue- • Magnificent food offering tac etc At Your Service Technology Services ! Mills Inn conference management team We can offer all that is needed for training understands the importance of state-of-the-art events, seminars, meetings, exhibitions, press technology in order to compete and succeed conferences, product launches and dinners in the modern world. -

Appendix F.1 Site Synopses for Designated Sites
Grousemount Wind Farm, Co. Kerry Environmental Impact Statement - Volume 2 of 3 August 2015 APPENDIX F.1 SITE SYNOPSES FOR DESIGNATED SITES Appendix F: Terrestrial Ecology Grousemount Wind Farm, Co. Kerry Environmental Impact Statement - Volume 2 of 3 August 2015 St. Gobnet’s Wood SAC (Site Code: 000106) Kilgarvan Ice House SAC (Site Code: 000364) Killarney National Park, Macgillycuddy's Reeks and Caragh River Catchment SAC (Site Code: 000365) Slaheny River Bog NHA (Site Code: 000383) Gouganebarra Lake pNHA (Site Code: 001057) Lough Allua pNHA (Site Code: 01065) Roughty River pNHA (Site Code: 001376) Kilgarvan Wood pNHA (Site Code: 001787) Derryclogher (Knockboy) Bog cSAC (Site Code: 001873) Sillahertane Bog NHA (Site Code: 001882) Ballagh Bog pNHA (Site Code: 001886) Mullaghanish Bog SAC (Site Code: 001890 ) Doughill Bog NHA (Site Code: 001948 ) Old Domestic Building, Curraglass Wood SAC (Site Code: 002041) Kenmare River SAC (Site Code: 002158) Blackwater River (Cork/Waterford) SAC (Site Code: 002170 ) Glanlough Woods SAC (Site Code: 002315) Conigar Bog NHA (Site Code: 002386) Boggeragh Mountains NHA (Site Code: 002447) Mullaghanish to Musheramore Mountains SPA (Site Code: 004162) Killarney National Park SPA (Site Code: 0004038) Appendix F: Terrestrial Ecology SITE NAME: ST. GOBNET’S WOOD SAC SITE CODE: 000106 St. Gobnet’s Wood SAC includes St. Gobnet’s Wood itself and an area of woodland to the north, called Cascade Wood. St. Gobnet’s Wood is situated on the north-east side of a hill immediately south of Ballyvourney village in Co. Cork. Cascade Wood is situated immediately to the north of Ballyvourney. Together they form a relatively large but fragmented stand of woodland.