Die Formation Des Literarischen Humors
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lyle Tompsen, Student Number 28001102, Masters Dissertation
Lyle Tompsen, Student Number 28001102, Masters Dissertation The Mari Lwyd and the Horse Queen: Palimpsests of Ancient ideas A dissertation submitted to the University of Wales Trinity Saint David in fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts Celtic Studies 2012 Lyle Tompsen 1 Lyle Tompsen, Student Number 28001102, Masters Dissertation Abstract The idea of a horse as a deity of the land, sovereignty and fertility can be seen in many cultures with Indo-European roots. The earliest and most complete reference to this deity can be seen in Vedic texts from 1500 BCE. Documentary evidence in rock art, and sixth century BCE Tartessian inscriptions demonstrate that the ancient Celtic world saw this deity of the land as a Horse Queen that ruled the land and granted fertility. Evidence suggests that she could grant sovereignty rights to humans by uniting with them (literally or symbolically), through ingestion, or intercourse. The Horse Queen is represented, or alluded to in such divergent areas as Bronze Age English hill figures, Celtic coinage, Roman horse deities, mediaeval and modern Celtic masked traditions. Even modern Welsh traditions, such as the Mari Lwyd, infer her existence and confirm the value of her symbolism in the modern world. 2 Lyle Tompsen, Student Number 28001102, Masters Dissertation Table of Contents List of definitions: ............................................................................................................ 8 Introduction .................................................................................................................. -

Bodacc Bulletin Officiel Des Annonces Civiles Et
o Quarante-neuvième année. – N 113 B ISSN 0298-2978 Lundi 15 et mardi 16 juin 2015 BODACCBULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DE L’INFORMATION Standard......................................... 01-40-58-75-00 LÉGALE ET ADMINISTRATIVE Annonces....................................... 01-40-58-77-56 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 Accueil commercial....................... 01-40-15-70-10 www.dila.premier-ministre.gouv.fr www.bodacc.fr Télécopie........................................ 01-40-58-77-57 BODACC “B” Modifications diverses - Radiations Avis aux lecteurs Les autres catégories d’insertions sont publiées dans deux autres éditions séparées selon la répartition suivante Vente et cessions................................................ Créations d’établissements ............................... Procédures collectives ....................................... BODACC “A” Procédures de rétablissement personnel ....... Avis relatifs aux successions ............................ } Avis de dépôt des comptes des sociétés ....... BODACC “C” Banque de données BODACC servie par les sociétés : Altares-D&B, EDD, Infogreffe, Questel SAS, Tessi (Defitech), Pouey International, Scores & Décisions, Les Echos, Creditsafe France, Coface Services, Cartegie, Infolegale & Marketing, France Telecom SA Kiosque Internet Entreprises, Telino, Docapost, Bureau Van Dijk EE (Bureau Van Dijk Electronic publishing), Tinubu, Data Project, Clic Formalités et Binq Media BV. Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 17 mai 1984 relatif à la constitution et à la commercialisation d’une banque de données télématique des informations contenues dans le BODACC, le droit d’accès prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la Direction de l’information légale et administrative. Le numéro : 3,90 € Avis aux lecteurs Les parutions du BODACC cesseront d’être imprimées à compter du 1er juillet 2015. -

English Spelling in the Seventeenth Century
The copyright of this thesis rests with the author. No quotation from it should be published without his prior written consent and information derived from it should be acknowledged. English Spelling in the Seventeenth Century: A study of the nature of standardisation as seen through the MS and Printed versions of the Duke of Newcastle's "A New Method ...". (Volume One of Two Volumes) by Margaret J—M SOnmez A Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy School of English and Linguistics The University of Durham 1993 0 - 4 FEB 1994 English Spelling in the Seventeenth Century: A study of standardisation as seen through the MS and printed versions of the Duke of Newcastle's "A New Method Margaret J-M SOnmez PhD thesis, 1993 Abstract This thesis investigates 17th century English spelling from the points of view of variation and standardisation. Following a survey of both contemporary and present-day commentaries on Early Modern English spelling, the linguistic nature and social contexts of the standardisation of written English are examined. In accordance with Milroy 1992's research, it is found that this process may usefully be studied as a form of language change. Unlike this earlier study, however, it is postulated that the standardisation of spelling itself (rather than of speech) will show patterns in variation that are similar to those found in the spoken language where change is in progress. The comparative analysis of the spellings of manuscript and printed versions of the first Duke of Newcastle's English book on Horsemanship shows variation at a number of different textual and linguistic levels, conforming to sociolinguistic the- ories of variation patterning in accordance with formality. -

HOBBY HORSE RIDER Preserves Many Delightful Hobby Horse Rides Which Contributed to Lilburn Kingsbury Becoming a “Living Legend” Well Before His Death
Table of Contents Dedication To My wife of 68 years Madeleine Huppert Kingsbury Without whose unfaltering love, understanding and encouragement, this book would never have been completed. Inside Front Jacket Lilburn Adkin Kingsbury (October 14, 1884 - July 1, 1983) Alex Hailey, author of Roots wrote: “When an old person dies, it is like a small library burning.” This was not true of Lilburn Adkin Kingsbury. I found his writings to be a small but very precious library. These writings include much of his historical research covering 150 years of life in Missouri’s historic Boonslick country. They tell much of the mores and activities of its interesting people. I believe the nucleus of this material should be preserved as Lilburn’s legacy to those who shared his love for the historic area. From early childhood Lilburn always had one or more hobby horses to ride. These included collecting antique furniture, pressed glass, bottles, jugs, clocks and ultimately buttons. Other hobbies were genealogy, history, talking to groups, and writing articles and columns. All these are described voluminously in his principal hobby, letter writing. His history hobby led to his becoming the first president of the Boonslick Historical Society. In 1977 the Boonslick Historical Society, relatives, and friends gave Lilburn a surprise 93rd birthday party honoring him for his forty years of service to the society and his many contributions to the community. –Warren Taylor Kingsbury Inside Back Jacket Excerpts from the Letters from Lilburn “In anticipation of the hanging excitement, a group of men arranged for an excursion train to be run from Sedalia to Boonville to accommodate those who wished to witness the event....” • • • “The next day our minister felt impelled to tell Mrs. -

Linden Corner School Mummers Play
1 Linden Corner School Mummers Play Cast: Fool Father Christmas Johnny Jack Hobby Horse Dragon Good King Wenceslas Saint George Doctor Townspeople Fool Room, room, make room, Linden Corner friends and families all! Pray, give us room to rhyme! We come to show activity In this glorious wintertime! Activity of youth! Activity of age! Such activity as you’ve never seen on stage. (singing) Though some of us be little, And some of a middle sort, We all desire your favor, To see our pleasant sport! Step in, Father Christmas! Father Christmas In comes I, Old Father Christmas Welcome or welcome not. I hope Old Father Christmas Will never be forgot! Christmas comes but once a year But when it comes, it brings good cheer! Roast beef! Plum pudding! Wassail! And mince pie! Who likes that better than I ?! Though they call me ‘Old’ Father Christmas, I have but a short time to stay. I’ve come to bring pleasure, and pastime, Before I go away. Walk in, Johnny Jack I say! And tell us… what are we doing here today? 2 Johnny Jack (Sweeping the stage) In comes I, poor Johnny Jack With me wife and me family on me back. My family’s large, and I am small. I’ve brought my broom to sweep your hall. Fool That’s my broom! (Fool and Johnny Jack struggle over broom. Father Christmas steps in, takes broom.) Johnny Jack (sniffing) Roast beef! Plum pudding! Wassail! And mince pie! Who likes that better than Old Father Christmas and I ?! Father Christmas Nobody! Fool & Johnny Jack (singing) Fal de ral, de riddle al de rey do, Fal de ral, de riddle al de rey! Fal de ral, -

The Mummers' Play St. George and the Fiery Dragon And
Jennifer C. Vaught. “The Mummers’ Play St. George and the Fiery Dragon and Book I of Spenser’s Faerie Queene. LATCH 3 (2010): 85-106. The Mummers’ Play St. George and the Fiery Dragon and Book I of Spenser’s Faerie Queene Jennifer C. Vaught University of Louisiana at Lafayette Abstract This essay examines Book I of Spenser’s Faerie Queene in relation to its rich, English and Irish festive and performative context. In “A Letter to the Authors” addressed to Sir Walter Raleigh, which was part of the prefatory material to his epic, Spenser envisions including twelve books that correspond to the “Faery Queene” keeping her “Annual feaste xii. dayes.” This phrase most likely refers to Queen Elizabeth’s annual feast of the Twelve Days of Christmas. The Mummers’ Play St. George and the Fiery Dragon was traditionally performed during the Christmas holiday season. In one version of this popular, comic play St. George engages in a slap-stick battle with a dragon that roars, demands meat, and performs a summersault. Throughout Book I of The Faerie Queene featuring Redcrosse who develops into the legendary St. George, Spenser appropriates elements from English Mummers’ plays about St. George, his Turkish opponent, and the Dragon in keeping with his larger Protestant agenda. His doing so contributes to the comedic dimension of Redcrosse’s battle with the dragon toward the end of Book I. Spenser’s surprising addition of comedy to this battle of biblical proportions further links Redcrosse with popular versions of legendary St. George well-known in comic, holiday performances and thereby distances his Protestant figure from the more serious Catholic Saint by this name. -

Winchester News
Winchester Road Methodist Church Winchester Road, Highams Park London, E4 9JP Minister: Rev Hilary Cheng [email protected] Tel Church 020 8531 8663 Tel Home 020 8524 3649 www.winchesterroadchurch.org.uk @winroadmeth Group: Winchester Road Methodist Church Dear All, May is a month when I think of elections and the FA cup! This year, we do indeed have local elections for the position of Mayor of London. These will take place at the beginning of the month when we are invited to vote. Later in the month, the FA cup is held as the football season comes to a close for another year. Normally crowds pour into Wembley Stadium to watch the big event. This year however, I am sure spectators will be scaled down considerably, with most viewers watching on television. Like me, you may have appreciated the bright, sunny weather of recent days, with endless blue skies, and then cold temperatures at night, typical of this time of year. It is good to watch nature unfold as trees come into leaf and flowers adorn gardens and parks. The spring is a wonderful season, and so welcome after the long dark winter months. So far, the roadmap out of lockdown is going according to schedule, with the promise of further unlocking in the middle of the month, giving greater freedom, and a more normal feel to life. We are told that at the same time as restrictions are lifted, we still need to be vigilant as we move towards greater freedom. Whilst we may not have appreciated the restrictions through the winter months, they have been effective in reducing the virus numbers, for which we must be grateful. -
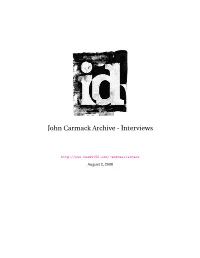
John Carmack Archive - Interviews
John Carmack Archive - Interviews http://www.team5150.com/~andrew/carmack August 2, 2008 Contents 1 John Carmack Interview5 2 John Carmack - The Boot Interview 12 2.1 Page 1............................... 13 2.2 Page 2............................... 14 2.3 Page 3............................... 16 2.4 Page 4............................... 18 2.5 Page 5............................... 21 2.6 Page 6............................... 22 2.7 Page 7............................... 24 2.8 Page 8............................... 25 3 John Carmack - The Boot Interview (Outtakes) 28 4 John Carmack (of id Software) interview 48 5 Interview with John Carmack 59 6 Carmack Q&A on Q3A changes 67 1 John Carmack Archive 2 Interviews 7 Carmack responds to FS Suggestions 70 8 Slashdot asks, John Carmack Answers 74 9 John Carmack Interview 86 9.1 The Man Behind the Phenomenon.............. 87 9.2 Carmack on Money....................... 89 9.3 Focus and Inspiration...................... 90 9.4 Epiphanies............................ 92 9.5 On Open Source......................... 94 9.6 More on Linux.......................... 95 9.7 Carmack the Student...................... 97 9.8 Quake and Simplicity...................... 98 9.9 The Next id Game........................ 100 9.10 On the Gaming Industry.................... 101 9.11 id is not a publisher....................... 103 9.12 The Trinity Thing........................ 105 9.13 Voxels and Curves........................ 106 9.14 Looking at the Competition.................. 108 9.15 Carmack’s Research...................... -

Beginners' Guide to English Folk Dance
Beginners’ Guide to English Folk Dance A brief introduction to the vibrant and diverse English folk dance traditions Maltby Phoenix Sword, rapper sword dance EFDSS in partnership with Youth Dance England, U.Dance 2012, Southbank Centre, London 2012 Photo EFDSS; Photographer: Roswitha Chesher Introduction English folk dance encompasses a rich diversity of dance forms that have developed over many centuries in communities throughout England. These traditions are alive and thriving as part of a living and evolving tradition, alongside many other forms of traditional dance present in England today. This presentation aims to show both traditional folk dance and its contemporary interpretations. Morris Offspring, Cotswold morris Sidmouth Folk Week 2012 Photo: Sue Swift Introduction English folk dance spans a hugely varied range of activities, from solo dancing in informal social settings to elaborately costumed and choreographed group dances. Dances can be spontaneous or ritualised, fixed or improvised, irreverent or solemn and all points in-between. This presentation introduces some of the distinctive features of English folk dance and its most popular forms. Thousands of people, of varied ages and backgrounds, perform and enjoy English folk dance in its many guises. Ceilidh dancing The Big Session Festival, Leicester, 2010 Photo: Bryan Ledgard Introduction English folk dance is colourful, exhilarating, exciting and diverse! Although distinctive, it has surprising similarities to traditional dances from across the British Isles, Europe, and other parts of the world. For example, stick dances that share visible similarities to morris dancing can be found as far afield as the Basque country and Kerala in Southern India. Appalachian clogging combines British roots with Native American and African influences: it evolved in the Southern Appalachian Mountains of the USA, and is now a popular performance dance form in England. -

AMN, November/December 1997, Vol. 20, No. 3
American Morris Newsletter November-December 1997 Volume 20, Number 3 Bdfton of'*- ucdk'kdlknlm, Peter &H1IL#, &!lw*lRey- nddr: Conrrpa~~~ahra~urt#aiption~iairiaWbt dclrestcdko AhMorrb NemleCtrrr c/o kadyn ReJnddr,nm WUIArc. 'Sur Prmc&oS$A.~,(gphone (&73i-7104; mil fal$pcs&- rmue Cdg-JdLIUQ~psndSimmyCaxcr'Rcgkd editon arc lohncDcxtcr+~~), john Ma- (Ontario), Mkm:Moslront$:(bi~.),-mdlKmSmitklw~]. C"oycrs rccks@&ila1993 byiThPdabduoE1-W Wildin(liupon the orjgiarll aedgar af,BarbmlPrentkeilO;'Ro~~ofBrmpton~Engtuwi: Hot Air from an Editor Alisa Dodson Editor Peter ffoulkes noted in this space last time that, due to finan- cial constraints, it was necessary to defer some articles to the follow- ing issue-and here we are, complete with those formerly missing articles (not to mention our missing paragraph from Geoff Hughes' Abram Circle Dance piece!). This issue continues the saga of the Abram Circle Dance, this time in America, in an article by Julia Schult. I have found both Geoff's article last issue and Julia's in this one to be very interesting. I was in that crowd of 150 morris dancers she mentions in her first paragraph, and at the time had no idea what we were doing or how to do it (watch carefully and do what they do was my motto!)-but it sure was memorable. I wrote in my diary of the trip, "those guys (the bride and groom) ought to have triplets at least." Also in this issue, we have the return of Jocelyn's oral history series, this time an interview with John Hodgkin; "The Golden Age of Rapper" by Phil Heaton; a book review by Steve Corrsin; and a dance by Rudd Rayfield. -

PULLMAN SENIOR CITIZENS ASSOC. May 2021
PULLMAN SENIOR CITIZENS ASSOC. May 2021 REPORT FROM THE BOARD There is so much going on that Association news is taking over the front page! We were hoping to have meals “in person” starting May 4, but now that seems uncertain as the Covid numbers in Whitman County have not improved as much as we had hoped. COA is ready to go with the Center to be open on Tuesday’s and Friday’s with limited hours, 11:00am – 1:00pm. We are prepared to get creative to comply with occupancy restrictions and maybe a reservation system. But, as of this newsletter we just don’t know what is going to happen. However, as always, all those who wish to have a meal will get a meal. When we do get back open, transportation to the Center will be available as before, and delivery of meals will also continue. Updated information will be sent to members in a separate mailing. WATCH FOR A FLYER! We are going day by day on this, and you can always call the Rec. office at 509-338-3227. The Association has agreed to accept a bid for $1,660.00 to purchase a sound system for the new enter. Terry Buffington’s son, Kwasi, is acting as our agent on this matter and is donating his time and professional expertise. Many thanks to Terry and Kwasi!! Garage Sale plans, (Aug. 14, 2021) are well underway. Dave and Vicki Ruddick have already been collecting items. If you have good items to donate, give them a call. -

Laurence Sterne and the Tradition of Christian Folly
LAURENCE STERNE AND THE TRADITION OF CHRISTIAN FOLLY By BYRON PETRAKIS A DISSERTATION PRESENTED TO TIIE GR-\DUATE COUNCIL OF THE UNI\ERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DECREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 1968 Copyright by- Byron Petrakis 1968 Acknowledgments It is a pleasure to acknowledge the assistance which I have received from the members of my supervisory committee, Professor George M. Harper, and Professor E. Ashby Hammond. To Professor Thomas R» Preston, under whose guidance this dissertation was begun, I owe the debt of inspiration and encouragement. To Professor Aubrey L. Williams, I owe the debt of the scholarly example and patient criticism which enabled me to complete this dissertation. Finally, I thank my wife, Gayle, for loving me enough to avoid Mrs. Shandy's error of giving her "assent and consent to any proposition" which her husband "laid before her." iii Preface The subject of this study is Sterne's use of the Pauline con- cept of Christian folly: that is, that wisdom in the eyes of the world may be folly in the eyes of God, while folly in the eyes of the world may lead to wisdom in the eyes of God.. Ity thesis is that the various aspects of the concept of Christian folly which appear throughout Sterne's work reflect traditional Christian attitudes toward what this world calls wisdom and folly. Focusing particularly on in the novel Tristram Shandy , I argue that several of the characters personify various aspects of wisdom and folly, ranging from Walter Shandy's obsession with worldly-wise hypotheses to Parson Yorick's apparently "foolish" martyrdom to truth, and that the novelist- preacher Sterne accomplishes a transvaluation of the terms "wisdom" and "follyo" Because Sterne's employment of the concept of Christian folly is rooted in earlier treatments of the idea of the wise fool in Christ, Chapter I of this study traces the history of the idea of Christian folly from the Middle Ages through the seventeenth century.