Aachen Im Wandel Der Zeit Seite 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
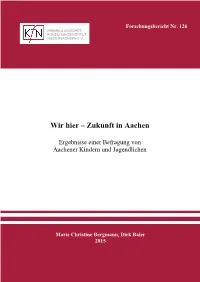
Wir Hier – Zukunft in Aachen
Forschungsbericht Nr. 126 KRIMINOLOGISCHES FORSCHUNGSINSTITUT NIEDERSACHSEN E.V. Forschungsbericht Nr. 102 Wir hier – Zukunft in Aachen Ergebnisse einer Befragung von Aachener Kindern und Jugendlichen Marie Christine Bergmann, Dirk Baier 2015 1 2 __________________________________________________ FORSCHUNGSBERICHT Nr. 126 _____________________________________ _____________ Wir hier – Zukunft in Aachen Ergebnisse einer Befragung von Aachener Kindern und Jugendlichen Marie Christine Bergmann, Dirk Baier 2015 Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN) Lützerodestraße 9, 30161 Hannover Tel. (05 11) 3 48 36-0, Fax (05 11) 3 48 36-10 E-Mail: [email protected] 3 4 Inhaltsverzeichnis 1. Ergebniszusammenfassung ...................................................................................................... 7 2. Befunde der Befragung von Schülern der neunten Jahrgangsstufe ................................... 11 2.1. Methode und Stichprobenbeschreibung ............................................................................. 11 Exkurs: Integration von Migrantenjugendlichen ....................................................................... 17 2.2. Lebenslagen Aachener Jugendlichen ................................................................................. 20 2.2.1. Einschätzungen zu Aachen: Gegenwart und Zukunft ................................................. 20 Gegenwart in Aachen ........................................................................................................ 21 Zukunft in Aachen -

Sozialplanung- Gesamtbericht 2018 (PDF)
Sozialräume der StädteRegion Aachen Anlage zur Sitzungsvorlage± Nr. 2018/0031 B 5 Baesweiler Sozialplanung B 4b B 4a B 3b B 3a B 2 H 3 H 1 B 1 Alsdorf A 1b Herzogenrath H 2 A 11a A 3 A 1a H 4 A 4 A 1b A 2a H 5 A 2b A 5 H 6 A 11b A 6 A 8 H 7 A 10 A 9 A 7 E 2 W 8 H 8 E 1 H 9 W 7 W 1 H 10 Eschweiler AC 9 W 6 W 4 E 3 H 11 E 5 W 2 E 6 E 7 W 5 E 8 E 4 E 9 W 3 Würselen E 10 E 13 E 11 E 12 AC 10 AC 8 AC 1 E 14 S 1 E 15 AC 2 S 2 AC 3 AC 7 S 8 S 6 S 9 AC 11 S 3a S 3b S 5 S 10 S 7 AC 6 AC 12 S 4 AC 4 AC 5 S 13 S 12 S 11 S 14 AC 13 Stolberg Aachen S 15 S 16 AC 14 R 1 R 2 SI 2 Roetgen Sozialräume SI 1 StädteRegion SI 3 Aachen M 1 Legende Simmerath Sozialräume Kommunen Monschau M 2 StädteRegion Aachen km 0 1 2 4 6 8 10 Bearbeiter: Christopher Herb (RWTH Aachen) Datum: 14.12.2017 Sozialberichterstattung StädteRegion Aachen 2018 – Gesamtbericht – Soziale Region Aktive Region Nachhaltige Region BildungsRegion Sozialberichterstattung StädteRegion Aachen 2018 - Gesamtbericht - Impressum ©StädteRegion Aachen (Hrsg.) Amt für Inklusion und Sozialplanung Aachen, Februar 2018 Fördergeber: Gliederung Vorwort und Einleitende Bemerkung der Dezernentin für Soziales und Gesundheit…………………………….. -

Belgien Belgien Niederlande
431 Grotenrath Post Broich Welldorf 1 1 Abzw. Windhausen Floverich Grünstr. 8 P 8 1 Setterich 7 Merzenhausen 2 Ü 2 7 9 2 2 Geilenkirchen 4 Übach-Palenberg4 Scherpenseel Geilenkirchen Geilenkirchen Geilenkirchen Geilenkirchen Linnich Linnich 8 9 Freialdenhoven Linnich Titz 9 Floverich Merzenhausen Denkmal 1 1 4 Puffendorfer Setterich Siedlung Am Erbbusch 3 Geilenkirchen 2 Str. Linnich Jülich Kreuz 3 Jugendtreff 51 151 3 B Frelenberg 69 Rur > Liniennetzplan R 2021 Scherpenseel Sandberg Merzenhausen , Hasenfelder Str. 4 E BW1 Scherpenseel 55 R Paul-Keller-Str. Loverich Schule 78 Scherpenseel Schule Kirche Marienstr. Wurmtal 54 Setterich Setterich Freialdenhoven Freialdenhoven 491 Rathaus Post Koslar Kreisbahnstr. 79 7 An den Aspen Röntgenstr. Wurmtalbrücke Carolus- 1 Loverich Setterich Ost Lindenend Beggendorf Koslar Magnus-Allee 1 7 1 Solar Campus Marienberg Carlstr. W 1 Koslar Bürgerhalle Scherpenseel B 5 1 Wurm ÜP1 5 Städtischer 1 0 Neue Mitte Setterich 491 491 8 2 RB2 Grenze 2 3 431 4 Neue Weide 1 Friedhof Übach-Palenberg 21 Übach-Palenberg Beggendorf 78 430 Lich-Steinstraß Beggendorf Theodor-Heuss-Str. 0 Mühlen- Bahnstr. Jülich Nord 2 Am Wasser- B 0 Am Ringofen S 2 0 Wasserturm Kirche 2 7 Matthiasplatz weg 7 B 1 S Übach-Palenberg Bf turm 270 Zitadelle ÜP1 430 431 Friedrich- Im Weinkeller Titz 21 Schlehdornweg Ebert-Str. Schloss Zweibrüggen 433 491 430 Max-Planck-Str. 21 Talstr. 431 Wehrhahnhof Achtung! Ebene „Druck 2 - Region Aachen“ Borsigstr. 216 220 223 238 270 491 6 0 Place de Montesson 0 431 Gewerbegebiet ITS 2 Übach 2 B 2 Rimburger Ev. Kirche Maastrichter Jülich Krankenhaus S 1 1 0 2 SB20 SB70 1 Markt 1 279 281 284 294 5 8 3 W 7 Holthausen 5 1 Acker Str. -

Dfbnet - Spielplan 26.07.2016 14:20
DFBnet - Spielplan 26.07.2016 14:20 Saison : 16/17 Staffel : 001 Kreisliga D Staffel 1 Verband : Fußball-Verband Mittelrhein Kennung : 230117 Mannschaftsart : 013 Herren Status : Spiele geplant Spielklasse : 058 Kreisliga D Staffelleiter : Yannick Longerich Spielgebiet : 007 Kreis Aachen Telefon : 01578-5075712 Rahmenspielplan : 1 E-Mail : [email protected] Sptg. Spielkennung Heimmannschaft Gastmannschaft Zeit/Tore Spielstätte Spielleitung Assistent 1 Assistent 2 Sonntag, 21.08.2016 1 230117001 Rasensport Brand III Sportfreunde Hörn III 11:00 Sportanlage Wolferskaul (Kunstrasen) 1 230117002 OSV Orsbach II VfL 05 Aachen II 11:00 Sportplatz Bungartsweg 1 230117003 BW Alsdorf II FV Vaalserquartier IV 11:00 Sportplatz Alsdorf-Nord 1 230117004 Borussia Brand II Arminia Eilendorf III 11:00 Schulzentrum Rombachstr. 1 230117005 SV Eilendorf IV VfJ Laurensberg II 13:00 Kunstrasenplatz Halfenstadion 1 230117006 JSC Blau-Weiss Aachen II Schwarz-Rot Aachen 15:00 Ludwig-Kuhnen-Stadion Sonntag, 28.08.2016 2 230117009 FV Vaalserquartier IV OSV Orsbach II 13:00 Kunstrasenplatz Alte Vaalser Str. 2 230117010 VfL 05 Aachen II Rasensport Brand III 13:00 Sportplatz Steinebrück 2 230117011 Munzurspor Aachen Borussia Brand II 15:00 Sportplatz SG Aachen 2 230117012 Rhenania Rothe Erde BW Alsdorf II 15:00 Sportplatz Rothe Erde 2 230117013 Sportfreunde Hörn III JSC Blau-Weiss Aachen II 15:00 Josef Glockner Sportanlage 2 230117014 Schwarz-Rot Aachen SV Eilendorf IV 15:00 Sportplatz Breslauer Str. Sonntag, 04.09.2016 3 230117017 Rasensport Brand III FV Vaalserquartier IV 11:00 Sportanlage Wolferskaul (Kunstrasen) 3 230117018 OSV Orsbach II Rhenania Rothe Erde 11:00 Sportplatz Bungartsweg 3 230117019 BW Alsdorf II Arminia Eilendorf III 11:00 Sportplatz Alsdorf-Nord 3 230117020 Borussia Brand II VfJ Laurensberg II 11:00 Schulzentrum Rombachstr. -

Bus Linie 70 Fahrpläne & Karten
Bus Linie 70 Fahrpläne & Netzkarten 70 Aachen, Bahnhof Rothe Erde (Bus) - Aachen, Im Website-Modus Anzeigen Uniklinik Die Bus Linie 70 (Aachen, Bahnhof Rothe Erde (Bus) - Aachen, Uniklinik) hat 6 Routen (1) Aachen Bf. rothe Erde: 05:47 - 18:06 (2) Aachen, Uniklinik: 06:09 - 18:11 (3) Aachen, Vaalserquartier Vaals Grenze: 09:10 - 16:11 (4) Berensberg: 10:02 - 12:02 (5) Laurensberg Schulzentrum: 07:28 - 13:08 (6) Prager Ring: 19:06 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 70 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 70 kommt. Richtung: Aachen Bf. Rothe Erde Bus Linie 70 Fahrpläne 38 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Aachen Bf. rothe Erde LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 05:47 - 18:06 Dienstag 05:47 - 18:06 Aachen, Vaalserquartier Vaals Grenze Püngelerstraße 1, Aachen Mittwoch 05:47 - 18:06 Aachen, Vaalserquartier Keltenstraße Donnerstag 05:47 - 18:06 Alte Vaalser Straße 50, Aachen Freitag 05:47 - 18:06 Aachen, Vaalserquartier Schmiedgasse Samstag Kein Betrieb Alte Vaalser Straße 10, Aachen Sonntag Kein Betrieb Aachen, Philipp-Neri-Weg (Reutershag) Schurzelter Straße 567, Aachen Aachen, Kullen Hans-Böckler-Allee 2, Aachen Bus Linie 70 Info Richtung: Aachen Bf. Rothe Erde Aachen, Steinbergweg Stationen: 38 Hans-Böckler-Allee 109, Aachen Fahrtdauer: 40 Min Linien Informationen: Aachen, Vaalserquartier Aachen, Uniklinik Vaals Grenze, Aachen, Vaalserquartier Keltenstraße, Aachen, Vaalserquartier Schmiedgasse, Aachen, Aachen, Worringer Weg Philipp-Neri-Weg (Reutershag), Aachen, Kullen, Pauwelsstraße 20, Aachen Aachen, -
Aachen Bushof ˜ Gierstraße ˜ Kellershaustraße ˜ Minoritenstraße ˜ Richterich Vetschauer Weg ˜ Zentis ˜ Driescher Gässchen (Techn
Kohlscheid Bank Brand − Gewerbegebiet Eilendorf Süd − Normaluhr − Aachen Bushof − Laurensberg − Vetschau 27 Richterich Roder Weg Haltestellen: Haltestellen (Fortsetzung): Haltestellen (Fortsetzung): ¸ Brand ˜ Schlossstraße ˜ Vetschau Bocholtzer Straße ˜ Brand Ringstraße ˜ Normaluhr ˜ Vetschau ˜ Richard-Wagner-Str. (Columbarium) ˜ Wallstraße ˜ Vetschau Schmiede ˜ Am Tiergarten ˜ Theater ˜ Richterich Lütterbüschgen ˜ Erberichshofstraße ˜ Elisenbrunnen ˜ Pfalzgrafenstraße ˜ Hermann-Löns-Straße ˜ UM Aachen Bushof ˜ Gierstraße ˜ Kellershaustraße ˜ Minoritenstraße ˜ Richterich Vetschauer Weg ˜ Zentis ˜ Driescher Gässchen (Techn. Hochschule) ˜ Richterich Vetschauer Weg ˜ Debyestraße ˜ Ponttor ˜ Richterich Kirche ˜ Gut Weide ˜ Bendplatz ˜ Hander Weg ˜ Zieglerstraße ˜ Jupp-Müller-Straße ˜ Richterich Rathaus ˜ Rödgerbach ˜ Laurensberg Wildbach ˜ Schloss-Schönau-Straße ˜ Meisenweg ˜ Laurensberg ˜ Richterich Schönauer Friede ˜ Schwalbenweg ˜ Laurensberg Rathaus ¸ Richterich Roder Weg ˜ Drosselweg ˜ Pannhauser Straße ˜ Richterich Dellstraße ˜ Adenauerallee ˜ Laurentiusstraße ˜ Bank Finkenstraße ˜ Zeppelinstraße ˜ Laurensberg Kirche ˜ Bank ˜ Bahnhof Rothe Erde ˜ Laurensberg Schulzentrum ˜ Amstelbach ˜ Goerdelerstraße ˜ Vetschauer Berg ¸ Bank Bachstraße ˜ Viktoriaallee ˜ Niersteiner Höfe Beachten Sie bitte unsere Sonderfahrpläne an Heiligabend/Weihnachten, Silvester/Neujahr und Karneval. 27 313 314 Kohlscheid Bank Brand − Gewerbegebiet Eilendorf Süd − Normaluhr − Aachen Bushof − Laurensberg − Vetschau 27 27 Richterich Roder Weg montags bis freitags -

View Annual Report
For customers, progress. For people, a future. Annual Report 2002_2003 TK C/1 Working for the future ThyssenKrupp aims to achieve continuous improvements in all areas. That’s a message we also want to put across in our annual reports. Whereas last year the focus was on sustainability and active dialogue, this year we want to take a closer look at innova- tions. Innovations at ThyssenKrupp are also the result of dialogue – with customers and employees. Addressing specific subjects from many different angles enables us to develop commercially successful innovations of the highest quality. For our customers, for our stockholders, for our employees. For people. www.thyssenkrupp.com Cover picture: ThyssenKrupp moving walks in the Seceda ski tunnel, St. Ulrich/Italy C/2 ThyssenKrupp in brief ThyssenKrupp is a global concern with business activities focused on the areas of Steel, Capital Goods and Services. We have over 190,000 employees in more than 70 countries developing products and services to meet the challenges of the future. In all five segments – Steel, Automotive, Elevator, Technologies and Services – they provide high- quality solutions to people’s needs and our customers’ requirements. Steel Capital Goods Services Steel Automotive Elevator Technologies Services The Group in figures 2001/2002 2002/2003 Change Order intake million € 36,404 36,047 – 357 Sales million € 36,698 36,137 – 561 EBITDA million € 2,648 2,454 – 194 EBIT million € 1,046 905 – 141 EBT (Income before taxes and minority interest) million € 762 714 – 48 Normalized -

The Imperial City by Bus! LINE 33 + 73
LINE 33 + 73 The imperial city by bus! OMSI 2 Add-on Aachen Developed by: Tobias Müller, Cedric Appel, Florian Wolf, Benedikt Steffens Manual: Tobias Müller / Aerosoft OMSI 2 Aachen Manual Copyright: © 2016 / Aerosoft GmbH Airport Paderborn/Lippstadt D-33142 Buren, Germany Tel: +49 29 55 / 76 03-10 Fax: +49 29 55 / 76 03-33 E-Mail: [email protected] Internet: www.aerosoft.de Add-on for www.aerosoft.com All trademarks and brand names are trademarks or registered of their respective owners. All rights reserved. OMSI 2 2 3 Aerosoft GmbH 2016 OMSI 2 Add-on Aachen Content Preface ......................................................................... 6 System requirements .................................................... 6 Installation .................................................................... 7 Removal ....................................................................... 7 Technical Background ................................................... 8 The City ........................................................................ 8 The Routes ................................................................... 9 An Overview of the routes ................................ 10 The buses ................................................................... 10 Standard bus .................................................... 10 Articulated bus ................................................. 11 High capacity articulated bus ............................ 11 Operation ................................................................... 12 -

Laurensberg Schulzentrum Montags
Abfahrtszeiten www.aseag.de www.avv.de Auskunft: Tel.: 0241/16881 nächste Vorverkaufsstelle: Gültig ab : 10.06.2018 Laurensberg Schulzentrum Dakman, Tabakwaren/Zeitschriften, Änderungen vorbehalten Laurensberg, Schlossparkstr. 11a montags bis freitags Zeit Linie Fahrtziel Zeit Linie Fahrtziel Zeit Linie Fahrtziel Zeit Linie Fahrtziel 5.47 27 Normaluhr 8.40 27 Aachen Bushof 14.20 27 Brand 20.07 27ALT Laurensberg [μ] 6.19 27 Aachen Bushof 9.20 27 Brand Ringstraße [w65] 15.20 27 Brand 21.07 27ALT Laurensberg [μ] 6.50 27 Brand 10.20 27 Brand Ringstraße [w65] 16.20 27 Brand 22.07 27ALT Laurensberg [μ] 7.08 [F] 27 Elisenbrunnen 7.08 [S] 27 Normaluhr (-Ronh.Weg) 11.20 27 Brand 17.20 27 Brand 23.07 27ALT Laurensberg [μ] 7.47 [S] 27 Brand Ringstraße [w15] 7.50 [F] 27 Brand Ringstraße [w15] 12.20 27 Brand 18.20 27 Brand 8.20 27 Brand Ringstraße [w65] 13.20 27 Brand 19.20 27 Brand [F] = nur in den Ferien [S] = nur an Schultagen Sondertage: Heiligabend wie samstags (Ende ab ca. 17 Uhr), Silvester wie samstags (Sonderfpl. Li. 44), 1.Weihnachtstag/Neujahr wie sonntags (Beginn ca. 9 Uhr), Rosenmontag wie sonntags [w15] = ab Brand Ringstraße weiter als Linie 15 in Richtung Krauthausen - Breinig [w65] = ab Brand Ringstraße weiter als Linie 65 in Richtung Niederforstbach [μ] = ALT (Anruf-Linientaxi); fährt nur nach Anmeldung (mindestens 30 Minuten vor der Abfahrtszeit) unter Tel. 0241 4013999. Es gilt der AVV-Tarif. In Laurensberg besteht Anschluss an Linie 47 nach Aachen Bushof. samstags Zeit Linie Fahrtziel Zeit Linie Fahrtziel Zeit Linie Fahrtziel Zeit -

ANNUAL REPORT THYSSENKRUPP AG Developing the Future
2013_2014 ANNUAL REPORT THYSSENKRUPP AG Developing the future. C2 ThyssenKrupp in figures ThyssenKrupp in figures The Group in figures 1) Group total Continuing operations Change Change 2012/2013 2013/2014 Change in % 2012/2013 2013/2014 Change in % Order intake million € 39,774 41,416 1,642 4 38,636 41,416 2,780 7 Net sales total million € 39,782 41,304 1,522 4 38,559 41,304 2,745 7 EBITDA million € 1,212 2,274 1,062 88 1,154 2,088 934 81 EBIT million € (552) 1,151 1,703 ++ (608) 965 1,573 ++ EBIT margin % (1.4) 2.8 4.2 — (1.6) 2.3 3.9 — Adjusted EBIT million € 517 1,333 816 158 586 1,333 747 127 Adjusted EBIT margin % 1.3 3.2 1.9 — 1.5 3.2 1.7 — EBT million € (1,648) 428 2,076 ++ (1,706) 242 1,948 ++ Net income/(loss) / Income/(loss) (net of tax) million € (1,576) 195 1,771 ++ (1,629) 9 1,638 ++ attributable to ThyssenKrupp AG's shareholders million € (1,436) 210 1,646 ++ (1,490) 24 1,514 ++ Basic earnings per share € (2.79) 0.38 3.17 ++ (2.90) 0.04 2.94 ++ Operating cash flow million € 786 887 101 13 981 887 (94) (10) Cash flow for investments million € (1,411) (1,141) 270 19 (1,313) (1,141) 172 13 Free cash flow before divestments million € (625) (254) 371 59 (332) (254) 78 23 Cash flow from divestments million € 1,221 1,053 (168) (14) 1,221 1,053 (168) (14) Free cash flow million € 596 799 203 34 889 799 (90) (10) Employees (September 30) 156,856 160,745 3,889 2 156,856 160,745 3,889 2 Germany 58,164 59,783 1,619 3 58,164 59,783 1,619 3 Abroad 98,692 100,962 2,270 2 98,692 100,962 2,270 2 Dividend per share € — 0.11 2) — — Dividend payout million € — 62 2) — — ROCE % (3.8) 9.0 12.8 — ThyssenKrupp Value Added million € (1,865) 5 1,870 ++ Net financial debt (September 30) million € 5,038 3,488 (1,550) (31) Total equity (September 30) million € 2,512 3,199 687 27 Gearing % 200.6 109.0 (91.6) — 1) The prior-year figures have been adjusted due to the adoption of IAS 19R and the catch-up of depreciation for Berco (cf. -

Stadtteilkonferenzen
Stadtteilkonferenz Vorname Name Institution Strasse PLZ Ort Telefon (0241-) E-Mail Homepage Aachen-Ost/Rothe Erde Gabi Dovern AWO (ASD) - kommissarische Sprecherin Gartenstraße 25 (AWO Hauptsitz) 52064 Aachen 88916-34 [email protected] www.aachenpost.de Aachen-Ost/Rothe Erde Ruth Klöble Caritas (Don Bosco Haus) - kommissarische Sprecherin Robert-Koch-Str. 1 52066 Aachen 978010 [email protected] www.aachenpost.de Aachen-Ost/Rothe Erde Jenny Darkwah OT Josefshaus Kirberichshofer Weg 6a 52066 Aachen 502209 [email protected] www.aachenpost.de Brand Beate Knof-Depenbrock Dr. Berhard-Klein-Str. 133 52078 Aachen 522544 [email protected] Brand Horst Kreutz Ev. Kinder- und Jugendhilfe Brand Freunder Landstraße 60 52078 Aachen 928270 [email protected] Bezirksamt Brand Wolfgang Sanders Bezirksamtsleiter Brand Paul-Küpper-Platz 1 52078 Aachen 432-8126 [email protected] Burtscheid-Frankenberg Michael Prömpeler Gesellschaft für Zeitgeschichte und Gegenwart Ewald-Alertz-Haus, Michaelsbergstr. 12 52066 Aachen [email protected] https://www.stadtteilkonferenz- burtscheid.de/ Burtscheid-Frankenberg Astrid Siemens Burtscheider Heimatfreunde [email protected] https://www.stadtteilkonferenz- burtscheid.de/ Burtscheid-Frankenberg Dr. Klaus-Peter Otto AWO Burtscheid 01755949499 [email protected] https://www.stadtteilkonferenz- burtscheid.de/ Burtscheid-Frankenberg Ingo Klusemann Frankenbuerger e.V. Goffartstraße 45 52066 Aachen 017651067980 [email protected] https://www.stadtteilkonferenz- burtscheid.de/ Eilendorf Julia König Evangelische Familienbildungsstätte Aachen Martin-Luther-Straße 16 52062 Aachen [email protected] Eilendorf Silke Göttgens-Weber Städtische Gemeinschaftsgrundschule Brühlstraße Brühlstr. 2 52080 Aachen 0241/553311 [email protected] Eilendorf Roland Winter-Gerigk Eilendorfer Bündnis für Integration [email protected] Forst/Driescher Hof Simone Jansen OT D-Hof Königsbergerstr. -
(Richterich Schönau) Laurensberg Rahe Laurensberg − Westbahnhof
Q:/Verkehr/VB − Betriebsplanung VBP VBE/Fahrplan 20−21/Fahrplanbuch und Internet 2020/ps/16_P; 20.05.2020 17:50 Linie: 16 Ri 1 Seite 1 260 260 Linie 16 (Richterich Schönau) Laurensberg − Westbahnhof − Aachen Bushof − Europaplatz − Tierpark − Lintert − Schleckheim − Walheim − Sief (− Lichtenbusch) 16 16 Laurensberg Rahe Haltestellen: Haltestellen (Fortsetzung): Haltestellen (Fortsetzung): ¸ Richterich Siedlung Schönau ˜ Blücherplatz ˜ Walheim Friedhof ˜ Schönauer Hang ˜ Ludwig Forum ˜ Hochhausring ˜ Hasenwaldstraße ˜ Wiesental ˜ Walheim ˜ Landgraben ˜ Europaplatz ˜ Prämienstraße ˜ Parkstraße ˜ Hohenzollernplatz ˜ Albert-Einstein-Straße ˜ Richterich Berensberger Straße ˜ Elsassstraße ˜ Walheim Hasbach ˜ Laurensberg Haus Linde ˜ Bahnhof Rothe Erde ˜ Walheim Mütschenpfuhl ˜ Rosenhügel ˜ Zeppelinstraße ˜ Schmithof Ardennenstraße ¸ Laurensberg Rahe Im Ring ˜ Hasencleverstraße ˜ Schmithof Kirche ˜ Am Beulardstein ˜ Tierpark ˜ Vennbahn ˜ Tittardshang ˜ Drimborn ˜ Schmithof Schule ¸ Laurensberg Rahe ˜ Staudenweg ˜ Schmithofer Straße ˜ Schlossweiherstraße ˜ Forster Linde ˜ Sief Radermacher ˜ Adele-Weidtman-Straße ˜ Neuhaus ˜ Pfeiferweg ˜ Laurensberg ˜ Heidbenden ˜ Sief Schule ˜ Teichwinkel ˜ Lintert Schießstand ˜ Baumgartsweg ˜ Laurensberg Viadukt ˜ Lintert ˜ Sief Abzweigung ˜ Gewerbegebiet Schlottfeld ˜ Kreuzerdriesch ˜ Broichhausen ˜ Süsterau ˜ Hitfeld ˜ Lichtenbusch Kirche ˜ Europadorf ˜ Eich ¸ Lichtenbusch ˜ Süsterfeld ˜ Oberforstbach ˜ Sief Schule ˜ Westbahnhof ˜ Schleckheim Kroitzheider Weg ˜ Pfeiferweg ˜ Audimax ˜ Schleckheim Kapelle ˜ Sief